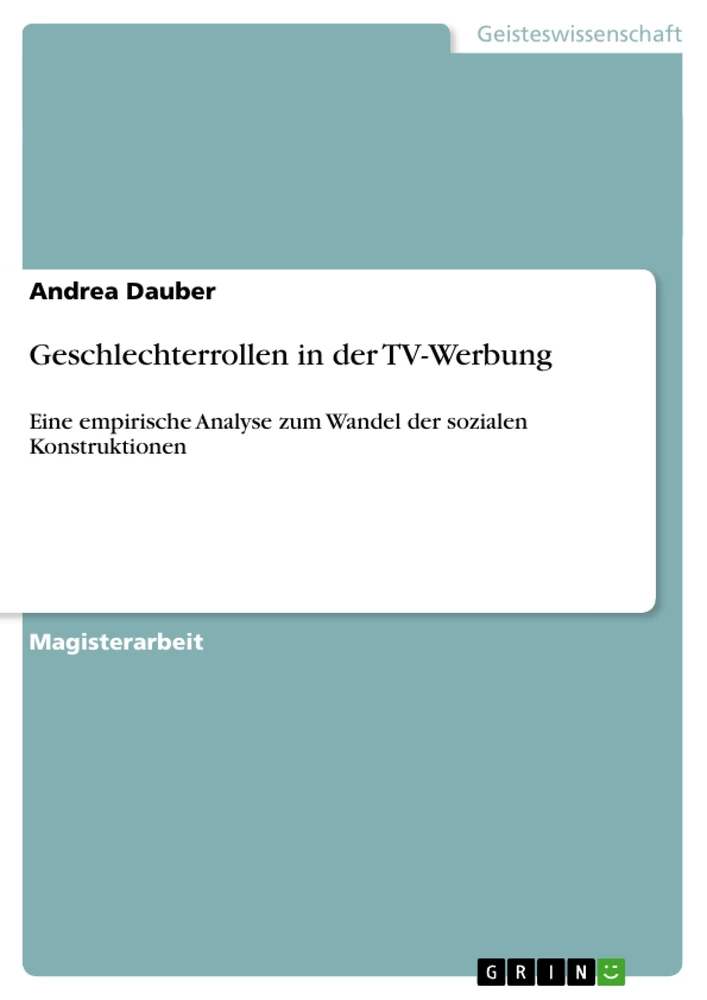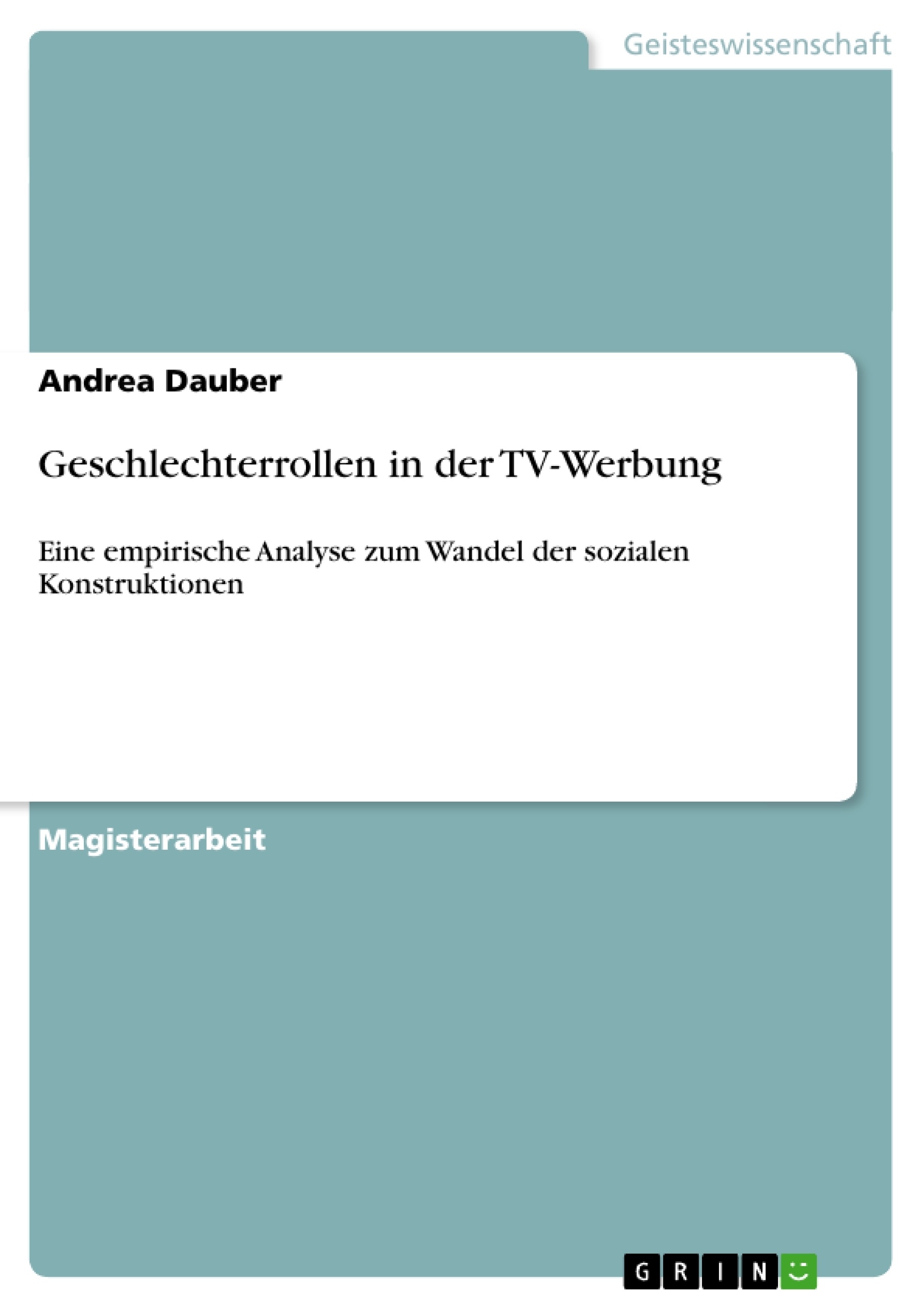„All that’s left in any case, is advertising space“ – diese Zeile aus einem Lied des Sängers Robbie Williams beschreibt recht treffend, mit welchem Umstand sich Menschen in modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften tagtäglich konfrontiert sehen: Werbung umgibt sie überall und zu jeder Zeit.
„SC macht Männer mutig“ – „Puschkin – für harte Männer“ – „Cadum – Die Seife schöner Frauen“ – „Camelia – Gibt allen Frauen Sicherheit und Selbstvertrauen“ – so oder so ähnlich lauten viele Werbeslogans, die uns ständig in allen möglichen Präsentationsformen, sei es im Fernsehen, auf Plakaten, im Internet, im Radio oder in Zeitschriften und Zeitungen begegnen. Doch dies ist lediglich die eine Seite der Medaille. Werden mit solchen Schlagwörtern gewisse Geschlechterstereotypen unterstrichen, die sich im allgemeinen Verständnis auf Charakter und Wesen der Geschlechter beziehen, so leistet Werbung zusätzlich noch etwas anderes. Sie vermittelt und inszeniert Rollen und die damit verbundenen sozialen Positionen, die Individuen zugeschrieben werden.
Thema dieser Arbeit sind Geschlechterrollen, nicht Stereotype im Sinne von charakterlichen Zuschreibungen. Insgesamt jedoch ist schwer zu beurteilen, ob Werbung im Allgemeinen gängige Geschlechterrollen transportiert oder ihnen eher entgegen steuert.
Dieser Aspekt soll, wenn auch nur am Rande, Thema dieser Arbeit sein.
Irene Neverla hat darauf hingewiesen, dass Veränderungen hinsichtlich der Geschlechterrollen nicht unbemerkt von statten gehen. Im Gegenteil, sie werden aufgegriffen und thematisiert:
„Das berufliche Handeln der Medienschaffenden sowie die Angebote der Medien zeigen schlaglichtartig, wie dieser Wandlungsprozess der Geschlechterrollen kommunikativ verarbeitet wird“ (Neverla 1994: 258 f.).
Welche Geschlechterrollen wurden und werden vorzugsweise von Fernsehwerbung innerhalb der letzten 50 Jahre präsentiert? Gibt es gewisse Rollenstereotype, die sich unangefochten halten? Vor allem bezüglich weiblicher Rollen? Oder hat eine Art Anpassung an die vielfältigen Wandlungsprozesse von Geschlechterrollen, sowohl an die männlichen als auch die weiblichen, stattgefunden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur soziologischen Relevanz der Thematik
- 2.1 Die ,,Natur\" der zwei Geschlechter
- 2.2 Kann denn das Geschlecht nur biologisch sein?
- 2.2.1 Aus Eins mach Zwei
- 2.2.2 Anatomische Grundlagen der Geschlechterdifferenz
- 2.3 Geschlechterrollen – reduzierter Biologismus oder soziale Konstruktion?
- 2.4 Der Geschlechterbegriff bei Erving Goffman
- 3. Geschlecht und Werbung
- 3.1 Geschlecht und Werbung als Untersuchungsvariablen
- 3.2 Gender Advertisements bei Erving Goffman
- 3.3 Geschlechterrollen im deutschen Werbefernsehen
- 3.3.1 Einführung in die Werbewirkung
- 3.3.2 Die Rezeption von Geschlechterrollen in der Werbung
- 4. Ziele und Hypothesen
- 4.1 Spezifische Forschungsfragen
- 4.2 Hypothesen zur Konstruktion der Geschlechterrollen
- 4.2.1 Berufliche Arbeitsteilung
- 4.2.2 Häusliche Arbeitsteilung
- 4.2.3 Sexualität
- 4.2.4 Ehe
- 4.2.5 Elternschaft
- 4.2.6 Macht
- 4.2.7 Hypothesen zu ostdeutscher Fernsehwerbung
- 5. Geschlechtsrollenwandel in BRD und DDR
- 5.1 Arbeitsteilung
- 5.1.1 Berufliche Arbeitsteilung
- 5.1.2 Häusliche Arbeitsteilung
- 5.2 Sexualität
- 5.2.1 Die sexuelle Revolution als Wendepunkt
- 5.2.2 Sexuelle Rollenbilder
- 5.3 Paarrelationen
- 5.3.1 Ehe
- 5.3.2 Elternschaft
- 5.4 Macht
- 6. Die Konzeption der Analyse
- 6.1 Methodologische Vorbemerkungen
- 6.2 Erhebung
- 6.2.1 Prinzip der Werbefilmauswahl
- 6.2.2 Betrachtungszeiträume
- 6.3 Analyse
- 6.3.1 Dimensionen
- 6.3.2 Indikatoren
- 7. Umsetzung der Werbefilmanalyse
- 7.1 Periodenimmanente Analyse: 1955-1965
- 7.1.1 Triumph (1955)
- 7.1.2 Frauengold (1955)
- 7.1.3 Sunil (1956)
- 7.1.4 Overstolz (1956)
- 7.1.5 Evidur (1956)
- 7.1.6 Opel Olympia Rekord (1958)
- 7.1.7 Bac 43 (1959)
- 7.1.8 Dr. Oetker (1961)
- 7.1.9 Palmolive (1963)
- 7.1.10 Frauengold (1963)
- 7.1.11 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.2 Periodenimmanente Analyse: 1975-1985
- 7.2.1 Milka (1975)
- 7.2.2 Palmolive (1975)
- 7.2.3 Langnese (1975)
- 7.2.4 Miele (1976)
- 7.2.5 Miele (1977)
- 7.2.6 Pampers (1980)
- 7.2.7 Obstgarten (1983)
- 7.2.8 Fruchtzwerge (1984)
- 7.2.9 Neckermann (1985)
- 7.2.10 Miracoli (1985)
- 7.2.11 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.3 Periodenimmanente Analyse: 1995-2005
- 7.3.1 Wrangler (1995)
- 7.3.2 Fixies (1995)
- 7.3.3 McCain (1997)
- 7.3.4 Deutsche Bank (1997)
- 7.3.5 Zentis (1998)
- 7.3.6 VW (1998)
- 7.3.7 Polaroid (1998)
- 7.3.8 Dea (2000)
- 7.3.9 Wick (2000)
- 7.3.10 Levis (2001)
- 7.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.4 Periodentranszendente Analyse
- 7.4.1 Berufliche Arbeitsteilung
- 7.4.2 Häusliche Arbeitsteilung
- 7.4.3 Sexualität
- 7.4.4 Ehe
- 7.4.5 Elternschaft
- 7.4.6 Macht
- 8. Exkurs: Geschlechterrollen im ostdeutschen Werbefilm
- 9. Gesamtbetrachtung
- 10. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Wandel von Geschlechterrollen in der deutschen Fernsehwerbung anhand einer empirischen Analyse. Ziel ist es, die sozialen Konstruktionen von Geschlechterrollen in der Werbung zu beleuchten und die Veränderungen in den Darstellungsformen über verschiedene Zeiträume hinweg aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Veränderungen in der Arbeitsteilung, der Sexualität, den Paarrelationen und den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern.
- Soziale Konstruktion von Geschlechterrollen
- Darstellung von Geschlechterrollen in der Werbung
- Wandel der Geschlechterrollen in der Werbung
- Vergleich von Geschlechterrollen in der Werbung in BRD und DDR
- Einfluss von Werbung auf die Rezeption von Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Geschlechterrollen in der Werbung im soziologischen Kontext beleuchtet. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich die biologische Unterscheidung der Geschlechter auf die sozialen Rollenkonstruktionen auswirkt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Geschlechterforschung und die Rolle der Werbung als Medium der Sozialisation und Kommunikation erörtert. Das dritte Kapitel analysiert die Ziele und Hypothesen der Arbeit und legt spezifische Forschungsfragen fest, die sich auf die Konstruktion von Geschlechterrollen in der Werbung konzentrieren. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Wandel der Geschlechterrollen in der BRD und der DDR, wobei die Schwerpunkte auf Arbeitsteilung, Sexualität, Paarrelationen und Macht liegen. Das fünfte Kapitel erläutert die Konzeption der Analyse, die methodischen Vorgehensweisen und das Prinzip der Werbefilmauswahl. Das sechste Kapitel zeigt die Umsetzung der Werbefilmanalyse anhand von Beispielen aus verschiedenen Zeiträumen. Das siebte Kapitel bietet einen Exkurs über die Darstellung von Geschlechterrollen in ostdeutscher Fernsehwerbung. Das achte Kapitel fasst die Ergebnisse der Gesamtbetrachtung zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Geschlechterrollen, Werbung, Fernsehwerbung, soziale Konstruktion, Gender Advertisements, Geschlechterwandel, Arbeitsteilung, Sexualität, Paarrelationen, Macht, BRD, DDR, empirische Analyse, Werbewirkung, Rezeption.
- Quote paper
- Andrea Dauber (Author), 2006, Geschlechterrollen in der TV-Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92136