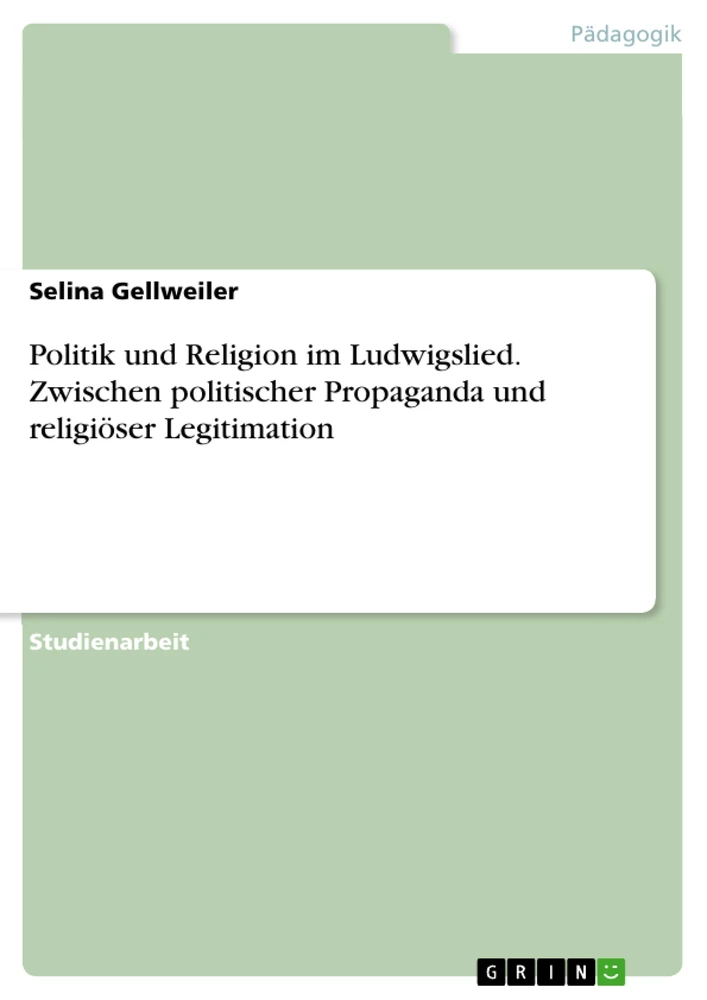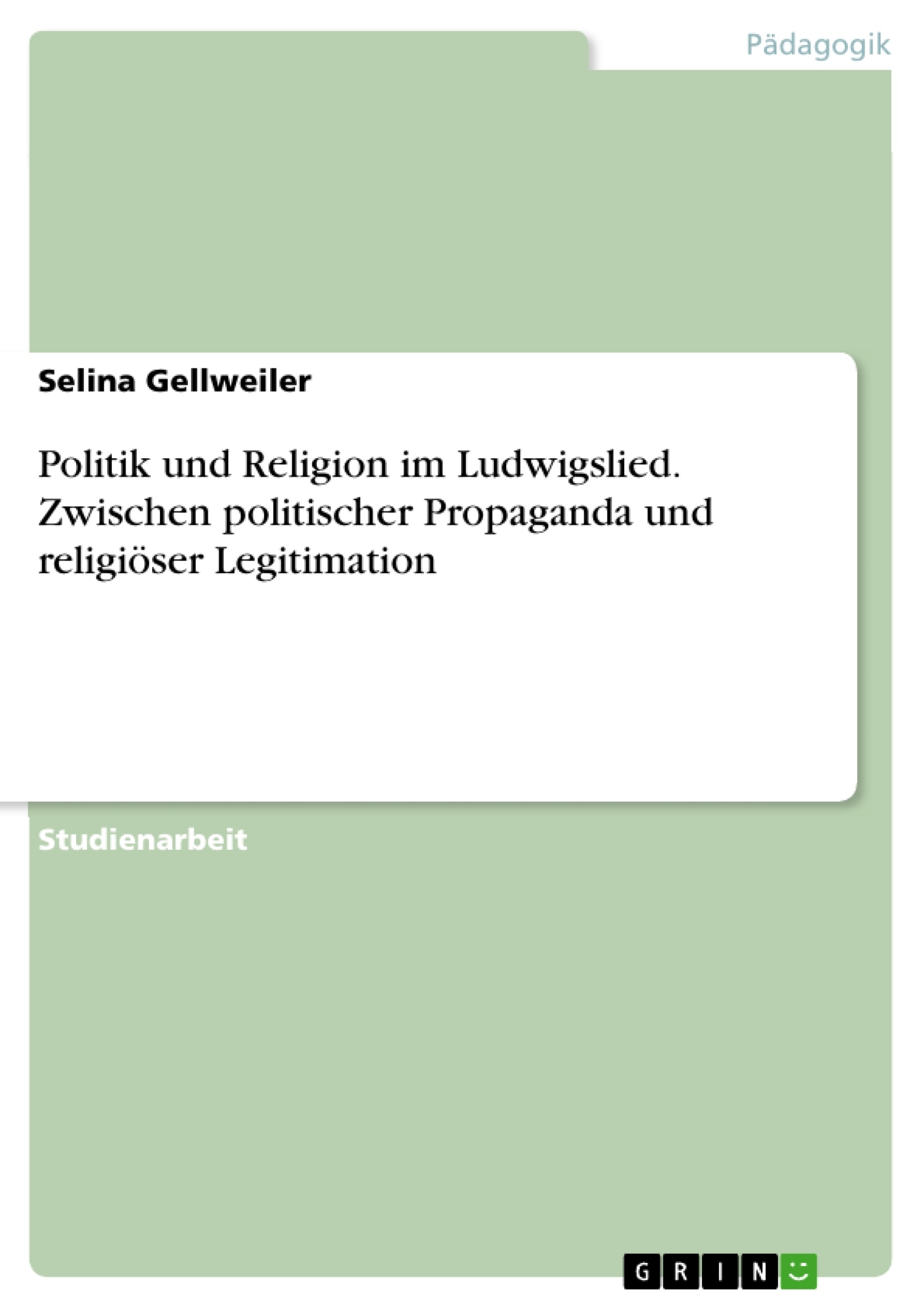Die Arbeit beschäftigt sich mit der wechselseitigen Instrumentalisierung der Aspekte von Politik und Religion im "Ludwigslied". Um eine fundierte Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Stoff garantieren zu können, bildet ein allgemeiner Überblick über das Ludwigslieds den ersten Teil der Arbeit. Dieser geht kurz auf Überlieferung und Forschungsgeschichte ein, thematisiert aber primär die Einordnung in den historischen Kontext sowie Inhalt, Komposition und die formale und sprachliche Gestaltung.
Aufbauend darauf folgt im zweiten Teil eine genaue Betrachtung der wechselseitigen Instrumentalisierung von Politik und Religion. Im Zentrum der Arbeit steht vor allem die Frage, mit welchen Mitteln und Motiven die Königsherrschaft im Ludwigslied religiös legitimiert wird. Im Fazit werden die Untersuchungsergebnisse schließlich zusammenfassend dargestellt.
Das althochdeutsche Ludwigslied besingt den westfränkischen König Ludwig III. und dessen Sieg über die Normannen. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei das Charisma des Königs, welches sich nicht nur aus seinen herrscherlichen Tugenden ergibt, sondern auch aus seiner Gottesfürchtigkeit. Letztere ist vor allem deswegen so ausgeprägt, weil Gott nicht nur als stiller Lenker im Hintergrund auftritt, sondern im Ludwigslied eine sehr reale Position einnimmt. Indem er einen Dialog mit Ludwig III. eingeht und ihm klare Befehle erteilt, erscheint der König als der göttliche Auserwählte, der mit Gottes Hilfe das Volk auf den rechten Weg zurückführt. So gesehen entspricht der Aufbau des Ludwigslieds einem heilsgeschichtlichen Ablauf. Durch den direkten Kontakt zwischen Gott und dem Frankenkönig findet in dem Lied zudem eine Vermischung von Politik und Religion statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ludwigslied
- Historische Einordnung
- Inhalt und Komposition
- Formale und Sprachliche Gestaltung
- Die wechselseitige Instrumentalisierung von Politik und Religion
- Lobpreisung des Herrschers
- Legitimation durch Gott
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem althochdeutschen Ludwigslied, einem Gedicht, das den westfränkischen König Ludwig III. und seinen Sieg über die Normannen besingt. Das Lied zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Politik und Religion aus, wobei das Charisma des Königs sowohl durch seine herrscherlichen Tugenden als auch durch seine Gottesfürchtigkeit betont wird. Die Arbeit analysiert die wechselseitige Instrumentalisierung dieser beiden Aspekte und untersucht, wie die Königsherrschaft im Ludwigslied religiös legitimiert wird.
- Das Ludwigslied im historischen Kontext
- Inhalt und Komposition des Liedes
- Formale und sprachliche Gestaltung
- Die Rolle der Religion in der Legitimation der Königsherrschaft
- Die Darstellung des Königs als Gottes Auserwählter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Ludwigslied und seine Bedeutung im Kontext der althochdeutschen Literatur vor. Sie skizziert die Forschungsergebnisse zu den Themen Überlieferung, Entstehung, Gattungszugehörigkeit und sprachlicher Einordnung des Liedes.
Im zweiten Kapitel wird das Ludwigslied im Detail analysiert. Es werden der Inhalt, die Komposition, die formale und sprachliche Gestaltung sowie die historische Einordnung des Werkes beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der wechselseitigen Instrumentalisierung von Politik und Religion im Ludwigslied. Es werden die Mittel und Motive untersucht, mit denen die Königsherrschaft religiös legitimiert wird. Dabei wird insbesondere auf die Darstellung des Königs als Gottes Auserwählter eingegangen.
Schlüsselwörter
Ludwigslied, althochdeutsche Literatur, König Ludwig III., Normannen, Politik, Religion, Legitimation, Gottesfürchtigkeit, Charisma, Zeitgedicht, Forschung, historische Einordnung, Formale Gestaltung, Sprachliche Gestaltung, Instrumentalisierung, Propaganda
- Quote paper
- Selina Gellweiler (Author), 2020, Politik und Religion im Ludwigslied. Zwischen politischer Propaganda und religiöser Legitimation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/921229