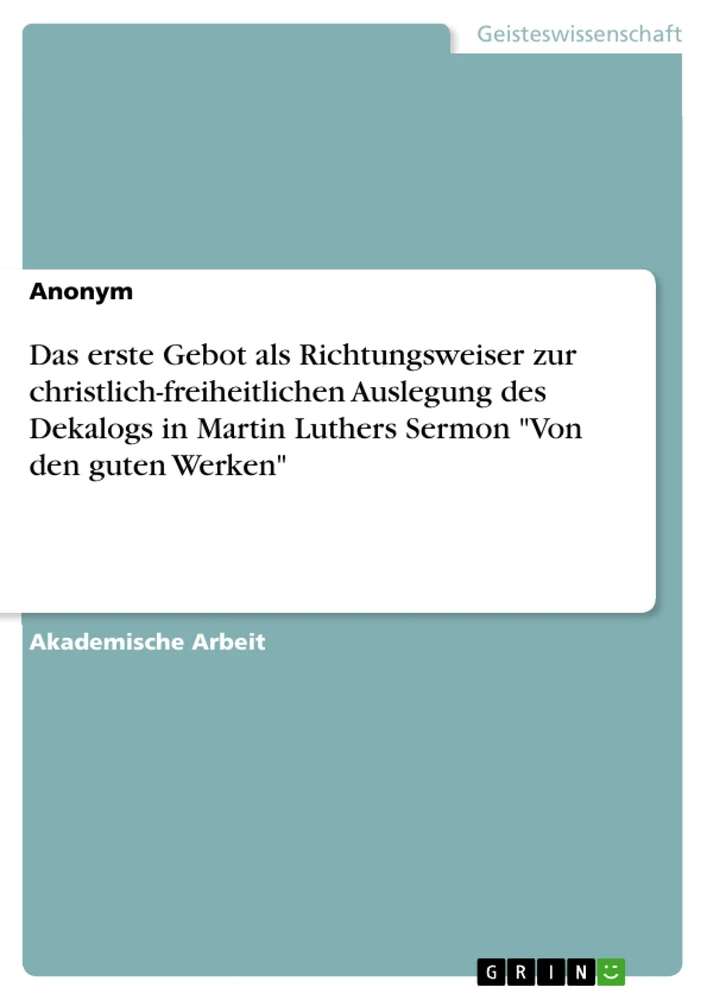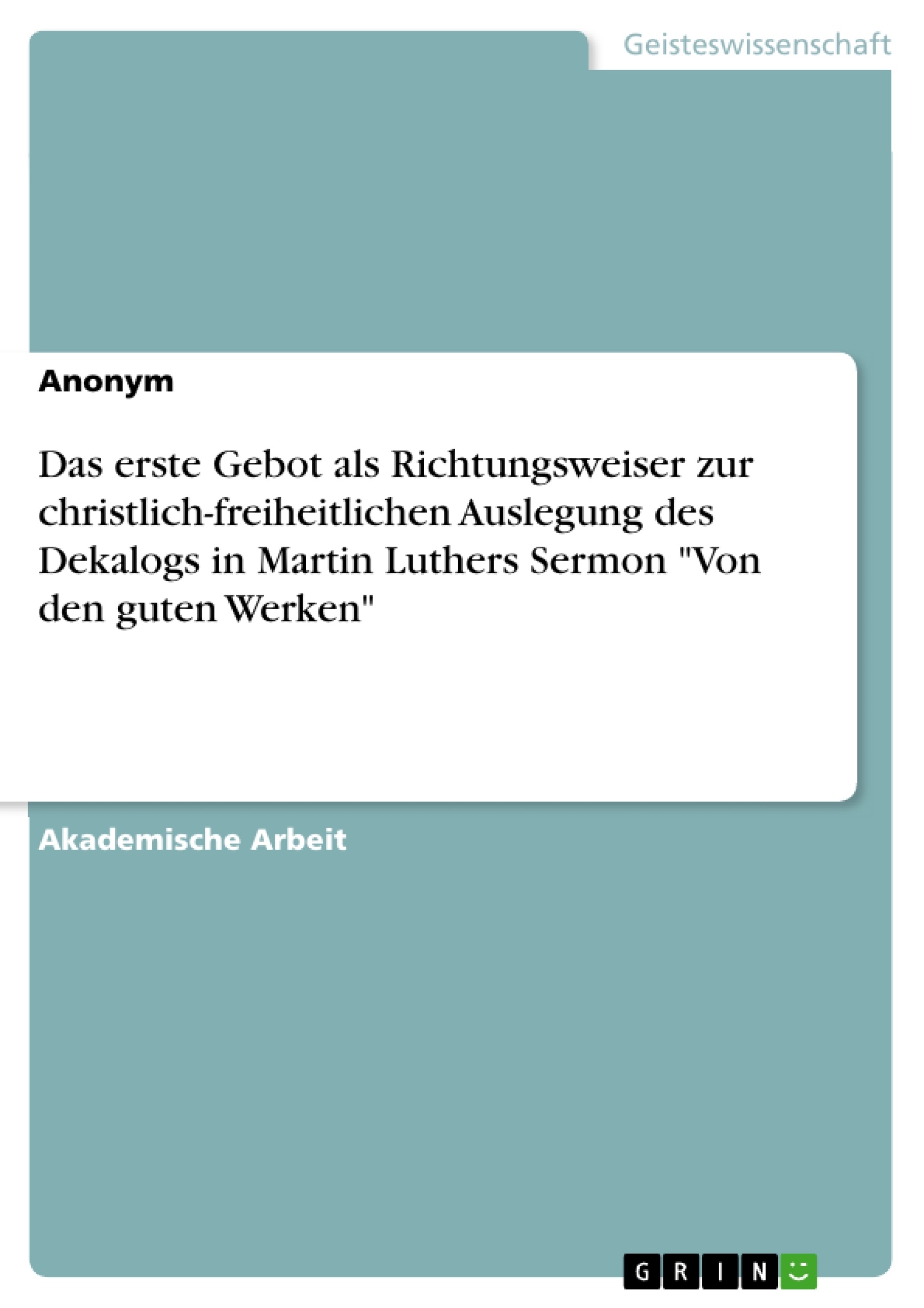Der Dekalog ist doch mehr als eine Sammlung von Verboten, nicht ohne Grund sprechen wir hier von Geboten. Wie können wir also zu einer Auslegung des Dekalogs gelangen, die keine Verbotsreligion propagiert? Wo ist die Freiheit in den göttlichen Geboten? Dieser Frage wird sich die folgende Arbeit annehmen.
Hierzu zieht sie den von Martin Luther verfassten, Sermon "Von den guten Werken" zurate. Dieser versucht, die guten Werke des Christenmenschen anhand des Dekalogs zu erklären und beides in Beziehung zu setzen. Es muss doch als durchaus erstaunlich gelten, dass Luther, der wenig später von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt, zuvor über ebendiese Werke und das göttliche Gesetz des Dekalogs schreibt und dies sogar als Ausgangspunkt seiner ersten ethischen Gedanken wählt. Die Arbeit wird exemplarisch das erste Gebot betrachten, bezieht Luther sich in seinem Sermon doch bei allen folgenden Geboten immer wieder auf dieses erste zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Dekalog im Horizont biblischer Überlieferung
- Der Text des ersten Gebotes im Alten Testament und bei Luther
- Luthers Sermon: Kontexte und Einführung
- Historische Einordnung
- Einführung in Luthers Sermon von den guten Werken
- Betrachtung und Analyse des ersten guten Werks im Sermon
- Gottes Gebote als Maßstab für gute Werke – Luthers Grundannahme
- Das Werk des ersten Gebotes als Ausgangspunkt aller guten Werke
- Der Alltag als gutes Werk im Glauben
- Der christliche Glaube als Kriterium für das gute Werk
- Glaube frei von Werken und doch Werke aus dem Glauben
- Die Qualitätsabstufungen des Glaubens
- Rückbezug auf das erste Gebot und Verortung der Liebe
- Der Bruch des Gebotes im historischen Kontext Luthers
- Gegenentwurf: Gerechtigkeit aus dem Glauben, nicht aus Werken
- Folge: Betonung der Innerlichkeit des Glaubens als Werk
- Die ständige Übung des Glaubens als Werk des ersten Gebotes
- Zeremonien und Gesetze, gefordert von den schwachen Menschen
- Folge: Solidarisierung mit den Schwachen
- Beständigkeit des Glaubens im Angesicht der Sünde
- Der Ursprung der Zuversicht in Christus als Kehrseite des Gebotes
- Der Sermon als reformatorische Auslegung des Dekalogs
- Die Freiheit des Dekaloges als Befreiung des Werkes zu sich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz des Dekalogs in einer liberalen Gesellschaft und erforscht Luthers Auslegung der "Guten Werke" im Kontext des ersten Gebotes. Sie analysiert, wie Luther das erste Gebot als Ausgangspunkt für seine ethischen Überlegungen verwendet und wie er den Dekalog von einer Verbotsreligion zu einer Freiheit des Handelns im Glauben umdeutet.
- Die Relevanz des Dekalogs in der Moderne
- Luthers Interpretation des ersten Gebotes
- Der Zusammenhang zwischen Glauben und guten Werken bei Luther
- Die Freiheit im christlichen Handeln gemäß Luthers Auslegung des Dekalogs
- Die Bedeutung des ersten Gebotes als Grundlage für alle weiteren Gebote
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Relevanz des Dekalogs in einer liberalen Gesellschaft. Sie argumentiert, dass der Dekalog mehr als nur eine Sammlung von Verboten darstellt und zeigt auf, wie Luthers Sermon "Von den guten Werken" als Interpretationsgrundlage dienen wird. Der Fokus liegt auf der Frage nach der Freiheit in den göttlichen Geboten und der exemplarischen Betrachtung des ersten Gebotes als Grundlage für Luthers ethische Überlegungen.
Der Dekalog im Horizont biblischer Überlieferung: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Textfassungen des Dekalogs im Alten Testament (Exodus und Deuteronomium), wobei die marginal unterschiedlichen Formulierungen des ersten Gebotes hervorgehoben werden. Es werden die Unterschiede im Kontext, insbesondere beim Sabbatgebot, diskutiert und die traditionelle Zweiteilung des Dekalogs in zwei Tafeln (Gottesgebote und Gebote des gesellschaftlichen Zusammenlebens) im Kontext Augustins und Luthers erläutert. Der Fokus liegt auf der apodiktischen Formulierung des Dekalogs als universelles Gesetz und der Notwendigkeit einer christlichen Neuinterpretation im Kontext des Neuen Testaments.
Luthers Sermon: Kontexte und Einführung: Dieses Kapitel bietet einen historischen Kontext zu Luthers Sermon "Von den guten Werken" und führt in dessen Thematik ein. Es wird die historische Einordnung des Sermons und die Bedeutung seiner Ausführungen zu den guten Werken im Bezug auf den Dekalog beschrieben. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die detaillierte Analyse des ersten Gebotes in Luthers Sermon vor.
Betrachtung und Analyse des ersten guten Werks im Sermon: Dieses Kapitel analysiert detailliert das erste Gebot in Luthers Sermon. Es untersucht Luthers Grundannahme, dass Gottes Gebote als Maßstab für gute Werke dienen, und die Bedeutung des ersten Gebotes als Ausgangspunkt aller guten Werke. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene Aspekte: den Alltag als gutes Werk im Glauben, den Glauben als Kriterium für gute Werke, das Verhältnis von Glauben und Werken, die Qualitätsabstufungen des Glaubens, die Verortung der Liebe im Kontext des ersten Gebotes, den Bruch des Gebotes im historischen Kontext Luthers, die ständige Übung des Glaubens, die Solidarisierung mit den Schwachen, die Beständigkeit des Glaubens und die Bedeutung der Zuversicht in Christus. Die Kapitelteilaspekte werden synthetisch zu einer umfassenden Darstellung des ersten Gebotes in Luthers Denken zusammengefügt.
Der Sermon als reformatorische Auslegung des Dekalogs: Dieses Kapitel behandelt die reformatorische Bedeutung von Luthers Sermon im Hinblick auf seine Auslegung des Dekalogs. Es analysiert, wie Luther den Dekalog neu interpretiert und ihn von einer jüdisch-traditionellen zu einer christlichen Sichtweise umformuliert. Der Abschnitt fokussiert sich auf den Beitrag Luthers zur Diskussion um die Relevanz des Dekalogs und seiner Interpretation im Kontext des christlichen Glaubens.
Die Freiheit des Dekaloges als Befreiung des Werkes zu sich: Dieses Kapitel untersucht, wie Luthers Auslegung des Dekalogs ein Verständnis von Freiheit im Handeln ermöglicht und die gute Tat nicht als eine unter Zwang stehende Handlung, sondern als eine aus dem Glauben heraus entstehende Handlung darstellt. Es wird die befreiende Wirkung des Dekalogs für das eigene Tun beleuchtet.
Schlüsselwörter
Dekalog, Martin Luther, Gute Werke, Erstes Gebot, Glaube, Freiheit, Reformatorische Theologie, Biblische Überlieferung, Christliche Ethik, Liberalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Luthers Auslegung des ersten Gebotes und der guten Werke
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Relevanz des Dekalogs in einer liberalen Gesellschaft und analysiert Luthers Auslegung der „Guten Werke“ im Kontext des ersten Gebotes. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Luther das erste Gebot als Ausgangspunkt für seine ethischen Überlegungen verwendet und wie er den Dekalog von einer Verbotsreligion zu einer Freiheit des Handelns im Glauben umdeutet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Relevanz des Dekalogs in der Moderne, Luthers Interpretation des ersten Gebotes, den Zusammenhang zwischen Glauben und guten Werken bei Luther, die Freiheit im christlichen Handeln gemäß Luthers Auslegung des Dekalogs und die Bedeutung des ersten Gebotes als Grundlage für alle weiteren Gebote. Sie vergleicht verschiedene Textfassungen des Dekalogs im Alten Testament und untersucht den historischen Kontext von Luthers Sermon „Von den guten Werken“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage stellt. Es folgt ein Kapitel zur biblischen Überlieferung des Dekalogs, ein Kapitel zu Luthers Sermon und seinen Kontexten. Der Hauptteil analysiert detailliert das erste Gebot in Luthers Sermon, einschließlich der Aspekte Glaube und Werke, die Qualitätsabstufungen des Glaubens und die Bedeutung der Liebe. Abschließende Kapitel behandeln den Sermon als reformatorische Auslegung des Dekalogs und die Freiheit des Dekalogs als Befreiung des Werkes zu sich.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Luthers Sermon „Von den guten Werken“. Die Arbeit bezieht sich außerdem auf verschiedene Textfassungen des Dekalogs im Alten Testament und diskutiert die traditionelle Zweiteilung des Dekalogs im Kontext Augustins und Luthers. Weitere Quellen werden implizit durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den genannten Themen erschlossen.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Arbeit zeigt, wie Luther das erste Gebot als Grundlage für sein Verständnis von guten Werken verwendet und wie er den Dekalog als ein System der Befreiung und nicht der Unterdrückung interpretiert. Er argumentiert, dass gute Werke nicht aus dem Zwang, sondern aus dem freien Glauben heraus entstehen. Die Arbeit beleuchtet den Bezug zwischen dem ersten Gebot und der Liebe Gottes, sowie die Bedeutung des Glaubens für ein christliches Handeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Dekalog, Martin Luther, Gute Werke, Erstes Gebot, Glaube, Freiheit, Reformatorische Theologie, Biblische Überlieferung, Christliche Ethik, Liberalismus.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Theologiestudenten, Wissenschaftler, die sich mit Luthers Theologie und der christlichen Ethik befassen, sowie für alle, die sich für die Relevanz des Dekalogs in der modernen Gesellschaft interessieren.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist in der vorliegenden Quelle enthalten (hier sollte ein Link zum vollständigen Text eingefügt werden, falls verfügbar).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Das erste Gebot als Richtungsweiser zur christlich-freiheitlichen Auslegung des Dekalogs in Martin Luthers Sermon "Von den guten Werken", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920509