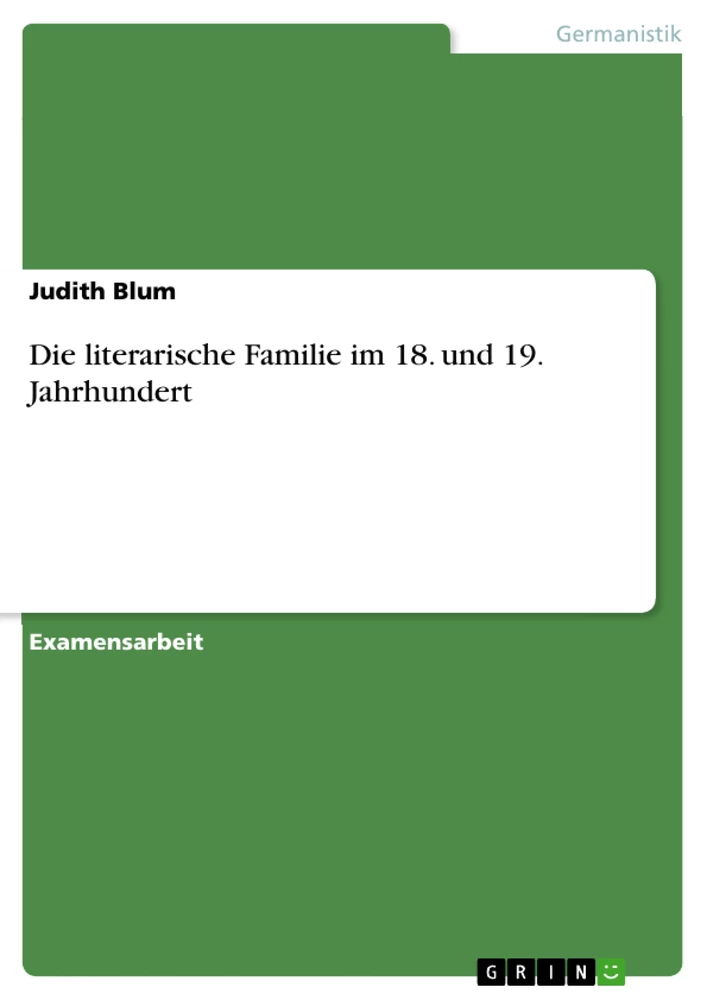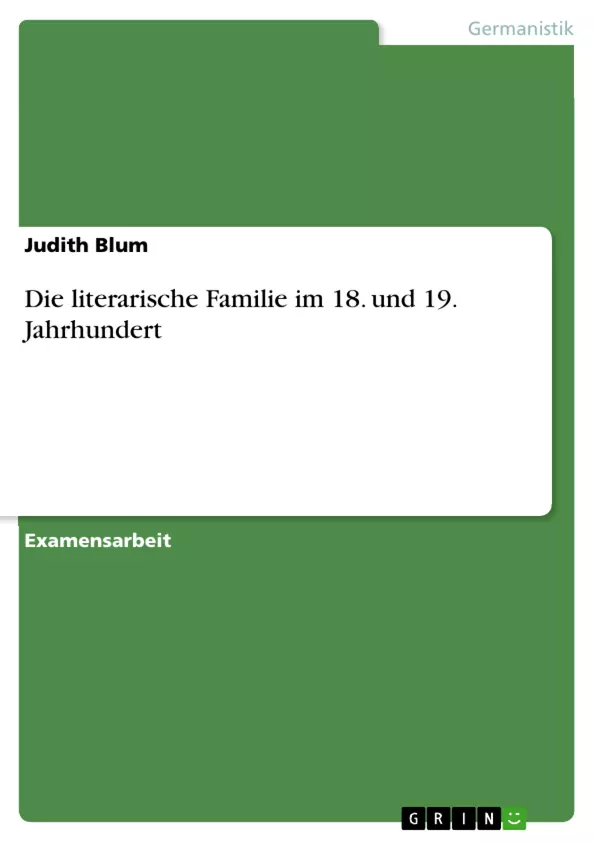Bei der vorliegenden Arbeit mit dem Titel "Literarische Familien im 18. und 19. Jahrhundert" handelt es sich um eine thematisch orientierte literaturwissenschaftliche Studie zur Darstellung der Familie in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Die zentrale Fragestellung ist, wie im 18. beziehungsweise im 19. Jahrhundert Familien in der Literatur dargestellt werden und ob hierbei Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede zwischen den beiden Jahrhunderten feststellbar sind. Analysiert werden exemplarisch für die Literatur des 18. Jahrhunderts "Die zärtlichen Schwestern" von Christian Fürchtegott Gellert und "Emilia Galotti" von Gotthold Ephraim Lessing, für die Literatur des 19. Jahrhunderts "Effi Briest" von Theodor Fontane und "Die Buddenbrooks" von Thomas Mann. Mit Gellerts und Lessings Dramen wurden zwei Werke aus den Anfängen des bürgerlichen Zeitalters ausgewählt, in dem das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie erst entstand. Die Romane von Fontane und Mann stehen am Ende des 19. Jahrhunderts und damit am Ausgang des Jahrhunderts, das man bedingt durch den stetigen Aufstieg des Bürgertums als das eigentliche „bürgerliche Zeitalter“ bezeichnen kann.
Den literaturwissenschaftlichen Analysen geht ein sozial- und kulturgeschichtlicher Überblick über die Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie voraus. Thematisiert werden in diesem Kapitel der Übergang vom „Ganzen Haus“ zur Kernfamilie und der Einstellungswandel in Bezug auf Liebe und Ehe, die Rollen der Geschlechter, die Bedeutung von Kindheit und Erziehung und die Vorstellung von Tugendhaftigkeit. Eingegangen wird sowohl auf die ideologischen Leitbilder als auch auf die historischen Realitäten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie
- 1.1 Die Bedeutung des Bürgertums für die Entstehung der Kleinfamilie
- 1.2 Entstehung und Struktur der Kleinfamilie
- 1.3 Bürgerliches Familienleitbild und bürgerliche Realitäten
- I.3.1 Liebe und Ehe
- I.3.2 Geschlechterordnung
- I.3.3 Kindheit und Erziehung
- I.3.4 Tugendhaftigkeit
- II. Die literarische Familie im 18. Jahrhundert
- II.1 Die Familie der „Zärtlichen Schwestern“
- II.1.1 Die empfindsame Familie
- II.1.2 Die zärtliche Liebe
- II.1.3 Weiblichkeit und Männlichkeit
- II.1.4 Cleon als Vater
- II.1.5 Die Familie als gesellschaftsabgewandter Ort: Sein vs. Schein
- II.2 Die Familie Galotti
- II.2.1 Die separierte Familie
- II.2.2 Odoardo und Claudia: Eine gescheiterte Liebe
- II.2.3 Emilia und Appiani: Eine vernünftige Liebe
- II.2.4 Weiblichkeit und Männlichkeit
- II.2.5 Odoardo und Claudia als Vater und Mutter
- II.2.6 Erziehung zu Tugend und Unmündigkeit
- II.2.7 Die Dialektik des bürgerlichen familialen Wertesystems
- II.1 Die Familie der „Zärtlichen Schwestern“
- III. Die literarische Familie im 19. Jahrhundert
- III.1 Die Familie von Briest
- III.1.1 Die standesbewusste Familie
- III.1.2 Eltern und Erziehung
- III.1.3 Die Standesehe - „Jeder ist der Richtige“
- III.1.4 Das Eheleben der Instettens
- III.1.5 Weiber weiblich“?
- III.1.6 Männer männlich“?
- III.2 Die Familie Buddenbrook
- III.2.1 Die Kaufmannsfamilie
- III.2.2 Die gewinnträchtige Vernunftehe
- III.2.3 Weiblichkeit und Männlichkeit
- III.2.4 Erziehung zum Gehorsam
- III.2.5 Die Brüchigkeit der Familie
- III.1 Die Familie von Briest
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Familien in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie Familien in der Literatur dieser Zeit dargestellt werden und ob sich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den beiden Jahrhunderten feststellen lassen.
- Die Entwicklung der bürgerlichen Kleinfamilie
- Die Rolle der Familie in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts
- Die Darstellung von Liebe und Ehe
- Die Konstruktion von Geschlechterrollen
- Die Bedeutung von Erziehung und Tugendhaftigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der literarischen Familie im 18. und 19. Jahrhundert ein und erläutert die historische und gesellschaftliche Bedeutung der Familie im bürgerlichen Kontext. Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie und analysiert die damit verbundenen Veränderungen in den Bereichen Liebe, Ehe, Geschlechterrollen und Erziehung. Die Kapitel II und III untersuchen die Darstellung von Familien in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Dabei werden anhand ausgewählter Beispiele wie "Die Familie der „Zärtlichen Schwestern“" und "Die Familie Galotti" sowie "Die Familie von Briest" und "Die Familie Buddenbrook" die verschiedenen Aspekte der literarischen Familienkonstellation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Familie, Literatur, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, bürgerliche Familie, Familienleitbild, Liebe und Ehe, Geschlechterrollen, Erziehung, Tugendhaftigkeit, Kleinfamilie, Familienroman, Familiendrama, "Die Familie der „Zärtlichen Schwestern“", "Die Familie Galotti", "Die Familie von Briest", "Die Familie Buddenbrook".
- Citation du texte
- Judith Blum (Auteur), 2007, Die literarische Familie im 18. und 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91990