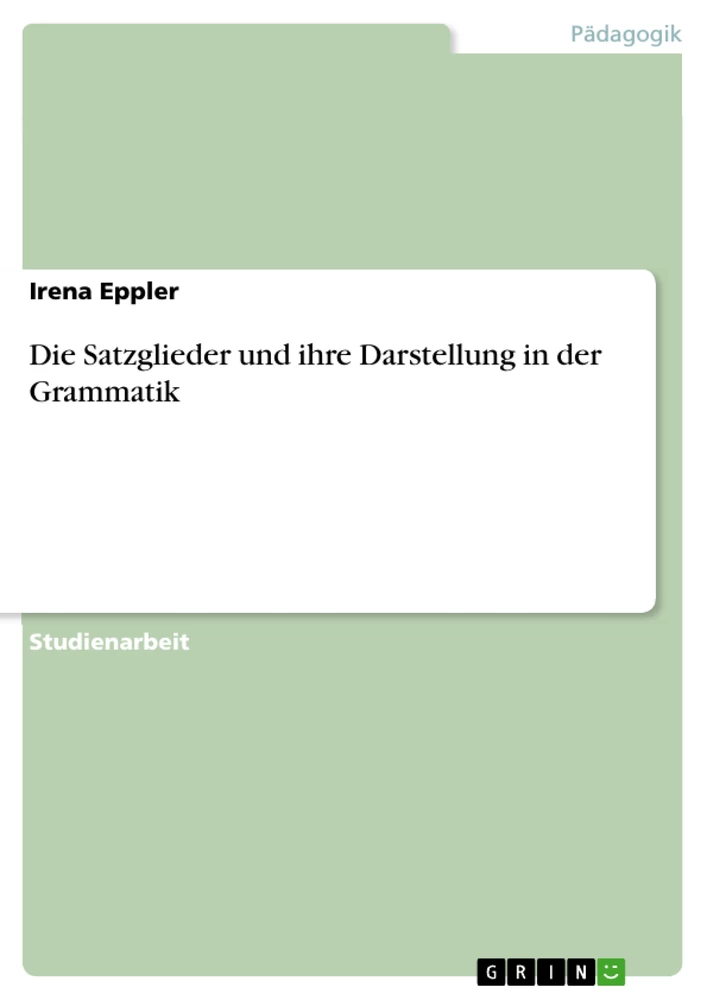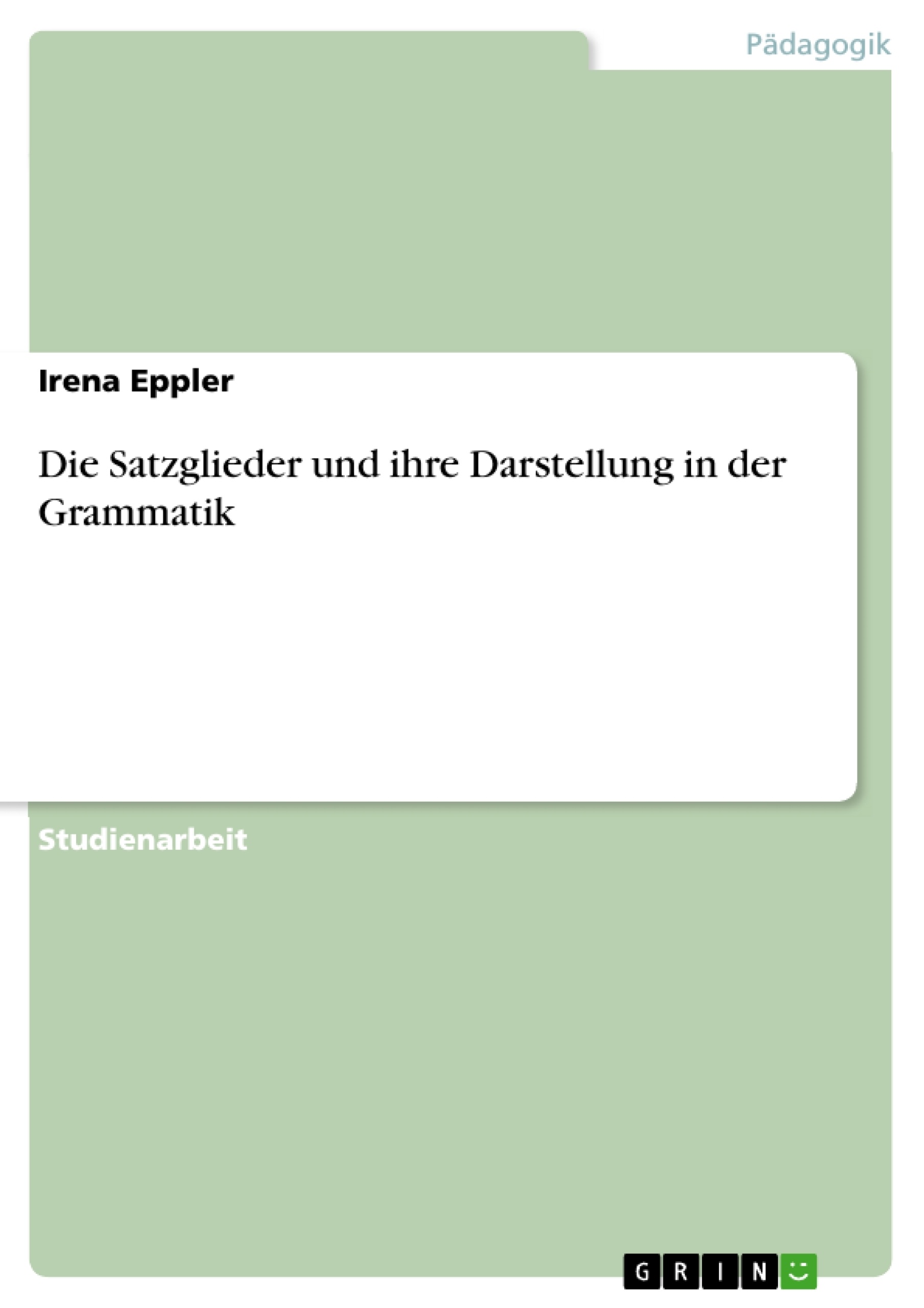Die Satzglieder und ihre Darstellung in der Grammatik
1. Einleitung
„Es gibt bekanntlich nicht nur eine Grammatik (und damit eine Lehre vom Satzbau) für die deutsche Sprache, sondern mehrere, und diese unterscheiden sich voneinander in Vorgehen, Ergebnissen und Terminologie. […]. Man kann das, wenn man will als geistige Vielfalt begrüßen;“1 Diese positiv ausgedrückte Vielfalt hat natürlich auch ihre Kehrseite: Grammatische Phänomene können nicht einheitlich bestimmt, benannt und erklärt werden; es gibt unterschiedliche Definitionen und sogar widersprüchliche Standpunkte, die es nicht ermöglichen grammatische Probleme übereinstimmend zu lösen. Diese wissenschaftlich äußerst heterogene Interpretation der deutschen Grammatik kann zu Verwirrung führen, vor allem bei den jüngeren „Wissenschaftlern“, den Schülern. Lange Zeit war es üblich, dass unterschiedliche und inhaltlich nicht kompatible Sprachbücher entworfen und schulspezifisch nebeneinander eingesetzt wurden, sodass ein Schulwechsel, sogar innerhalb einer Stadt, zum Problem werden konnte. Seit der deutschen Kultusministerkonferenz von 1982 ist ein „Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke“ festgesetzt, und somit auch die Basis für eine einheitliche Schulgrammatik – zumindest, was die wichtigsten Grundbausteine der deutschen Grammatik angeht – gelegt.
Die Wissenschaft hingegen konnte sich nicht so schnell einigen, was auch heute noch die unvereinbare Pluralität fachwissenschaftlicher Termini zur Folge hat.
Bei der anschließenden Untersuchung der Satzglieder und ihrer Darstellung in der Grammatik, werde ich mich im Wesentlichen – aufgrund der lokalen Fakultätszugehörigkeit – auf die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse des Institutes für deutsche Philologie der Universität Würzburg beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes
- 3. Ergänzungen und Angaben
- 3.1 Ergänzungen
- 3.2 Angaben
- 4. Grammatische Proben
- 4.1 Ersatzprobe
- 4.2 Umstellprobe
- 4.3 Weglassprobe
- 4.4 Anreihungsprobe
- 4.5 Prädikationsprobe
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung von Satzgliedern in verschiedenen Grammatiken der deutschen Sprache. Ziel ist es, die Vielfalt und teilweise widersprüchlichen Ansätze in der grammatischen Beschreibung zu beleuchten und die Unterschiede zwischen schulgrammatischen und wissenschaftlichen Perspektiven herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Satzstruktur anhand des Verbs als zentralem Element und der Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben.
- Vielfalt und Heterogenität grammatischer Beschreibungen
- Das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes und seine Valenz
- Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben
- Anwendung verschiedener grammatischer Proben zur Satzgliedbestimmung
- Schulgrammatik im Vergleich zur wissenschaftlichen Sprachwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik unterschiedlicher Grammatiken der deutschen Sprache und deren Auswirkungen auf den Unterricht. Sie betont die Notwendigkeit einer einheitlichen Terminologie, zumindest in der Schulgrammatik, und kündigt die Fokussierung auf die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse des Instituts für deutsche Philologie der Universität Würzburg an. Die Einleitung verweist auf die Komplexität und die teilweise unvereinbare Pluralität fachwissenschaftlicher Termini in der Beschreibung grammatischer Phänomene.
2. Das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes: Dieses Kapitel behandelt das Verb als zentrales Element der Satzstruktur. Es erklärt den Begriff der Valenz und zeigt, wie das Verb die Anzahl und den Kasus der Ergänzungen bestimmt. Anhand von Beispielen wird die Variabilität der Valenz eines Verbs in Abhängigkeit vom Kontext verdeutlicht. Weiterhin werden die besondere Stellung des Verbs im Satz (z.B. im Aussagesatz, Fragesatz, Nebensatz) und die unterschiedlichen Auffassungen in der Linguistik und Schulgrammatik bezüglich der Klassifizierung des Verbs als Satzglied diskutiert. Der Abschnitt erläutert auch den Aufbau des verbalen Kerns, der aus einfachen Verben, Prädikatsklammern oder Verben mit Verbzusätzen bestehen kann.
3. Ergänzungen und Angaben: Dieses Kapitel differenziert zwischen Ergänzungen und Angaben als Satzgliedern. Ergänzungen sind von der Valenz des Verbs abhängig, während Angaben eigenständige syntaktische Konstituenten sind. Die Arbeit beleuchtet die vereinfachte Darstellung in der Schulgrammatik, die diese Unterscheidung oft nicht trifft. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Unterschiede in der wissenschaftlichen und schulischen Grammatik und der daraus resultierenden Vereinfachungen im Schulunterricht. Die Komplexität des Themas wird in Bezug zur Schulgrammatik dargestellt und die Unterschiede in der Betrachtung von Ergänzungen und Angaben herausgearbeitet.
4. Grammatische Proben: In diesem Kapitel werden verschiedene grammatische Proben (Ersatzprobe, Umstellprobe, Weglassprobe, Anreihungsprobe, Prädikationsprobe) zur Bestimmung von Satzgliedern vorgestellt und erläutert. Die Proben dienen der Analyse und helfen, die Satzglieder im Satz zu identifizieren und ihre Funktion zu bestimmen. Der Fokus liegt hier auf der praktischen Anwendung der unterschiedlichen Testverfahren zur Identifizierung der Satzglieder und ihrer Funktionen. Es werden keine konkreten Beispiele aus dem Kapitel wiedergegeben, da der Fokus auf der Beschreibung der einzelnen Methoden liegt.
Schlüsselwörter
Satzglieder, Grammatik, Verb, Valenz, Ergänzungen, Angaben, grammatische Proben, Schulgrammatik, wissenschaftliche Sprachwissenschaft, Satzstruktur, deutscher Satzbau.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Satzglieder im Deutschen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung von Satzgliedern in verschiedenen Grammatiken des Deutschen, insbesondere mit der Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben. Sie vergleicht schulgrammatische und wissenschaftliche Ansätze und untersucht das Verb als zentrales Element der Satzstruktur. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den zentralen Themen, die Zusammenfassung der Kapitel und ein Schlusskapitel. Zusätzlich werden grammatische Proben zur Satzgliedbestimmung vorgestellt und Schlüsselwörter definiert.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Die Vielfalt und Heterogenität grammatischer Beschreibungen, das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes und seine Valenz, die Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben, die Anwendung verschiedener grammatischer Proben zur Satzgliedbestimmung und den Vergleich von Schulgrammatik und wissenschaftlicher Sprachwissenschaft.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes, Ergänzungen und Angaben, grammatische Proben und Schluss. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was versteht die Arbeit unter dem "Verb als strukturelles Zentrum des Satzes"?
Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Valenz und wie das Verb die Anzahl und den Kasus der Ergänzungen bestimmt. Es beleuchtet die Variabilität der Valenz in Abhängigkeit vom Kontext und die unterschiedlichen Auffassungen in Linguistik und Schulgrammatik zur Klassifizierung des Verbs als Satzglied. Der Aufbau des verbalen Kerns (einfache Verben, Prädikatsklammern, Verbzusätze) wird ebenfalls behandelt.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen Ergänzungen und Angaben?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Ergänzungen (valenzabhängig) und Angaben (eigenständige syntaktische Konstituenten). Sie zeigt die vereinfachte Darstellung in der Schulgrammatik auf, die diese Unterscheidung oft nicht klar trennt, und beleuchtet die Unterschiede in der wissenschaftlichen und schulischen Grammatik.
Welche grammatischen Proben werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene grammatische Proben zur Satzgliedbestimmung: Ersatzprobe, Umstellprobe, Weglassprobe, Anreihungsprobe und Prädikationsprobe. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung dieser Methoden zur Identifizierung von Satzgliedern und deren Funktionen.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist es, die Vielfalt und teilweise widersprüchlichen Ansätze in der grammatischen Beschreibung von Satzgliedern zu beleuchten und die Unterschiede zwischen schulgrammatischen und wissenschaftlichen Perspektiven herauszuarbeiten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Satzglieder, Grammatik, Verb, Valenz, Ergänzungen, Angaben, grammatische Proben, Schulgrammatik, wissenschaftliche Sprachwissenschaft, Satzstruktur, deutscher Satzbau.
Wo liegt der Fokus der Seminararbeit?
Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Satzstruktur anhand des Verbs als zentralem Element und der Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vergleich zwischen schulgrammatischen und wissenschaftlichen Ansätzen.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende der Germanistik, Sprachwissenschaft und Lehramt, die sich mit der deutschen Grammatik und Satzanalyse auseinandersetzen. Sie ist auch für Lehrerinnen und Lehrer hilfreich, die ihre Kenntnisse der deutschen Grammatik vertiefen möchten.
- Quote paper
- Irena Eppler (Author), 2007, Die Satzglieder und ihre Darstellung in der Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91964