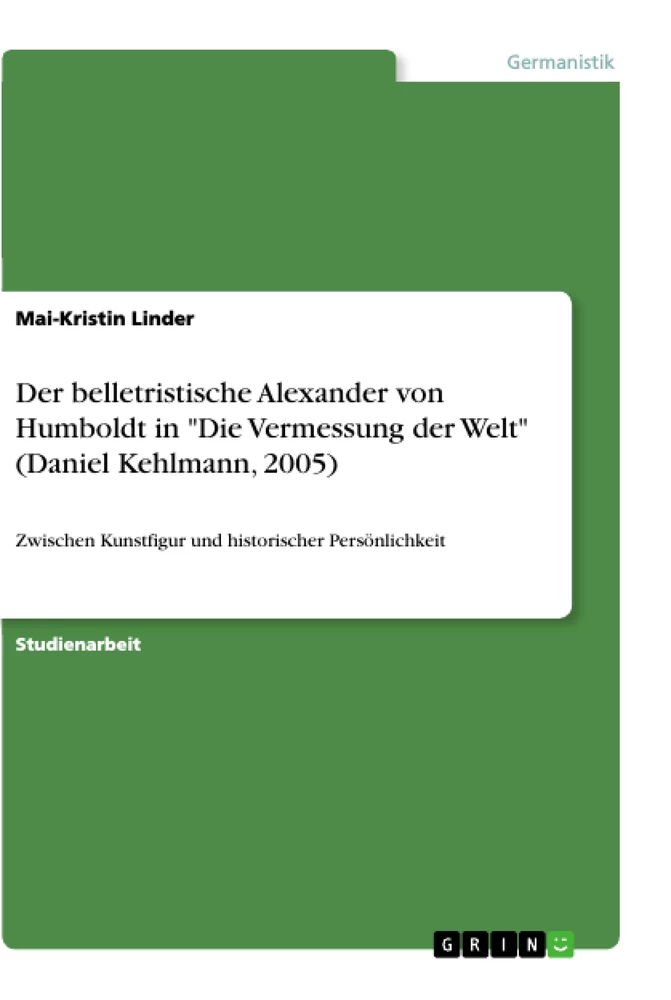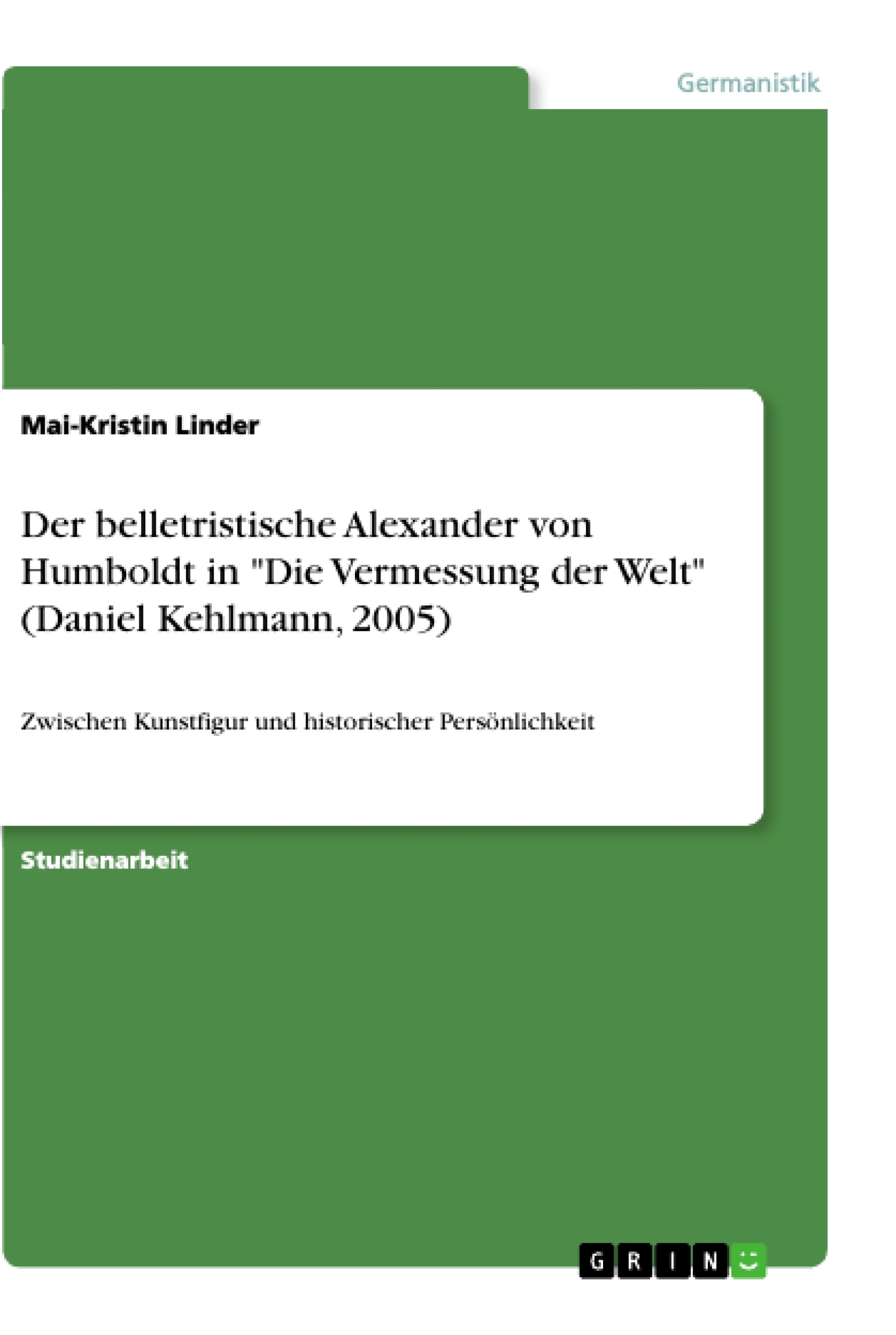In dieser Arbeit wird der Roman "Die Vermessung der Welt" (2005) von Daniel Kehlmann und der darin auf seine Weise beschriebene Charakter des Alexander von Humboldts näher betrachtet. Denn neben dem Erfolg des Werkes suchen sich auch immer wieder kritische Stimmen ihr Gehör. "Die Vermessung der Welt" (im Folgenden abgekürzt: dVdW) ist ein Buch, an dem sich die Geister scheiden.
Nachdem zunächst der Schriftsteller Daniel Kehlmann anhand seines literarischen Werkes vorgestellt wird, um dVdW darin zu verorten und literarische Richtungen sowie Einflüsse festzustellen, werden Fachtexte herangezogen. Diese Texte werden auf die Gattungsfrage zu sprechen kommen, sowie Interviews mit Kehlmann selbst, sodass ein Fazit betreffs der Gattung gebildet werden kann. Mit diesem ist das Fundament für die nächsten Schritte geschaffen: Die Arbeit wendet sich dann dem Charakter Alexander von Humboldts in dVdW und Kehlmanns öffentlichem Umgang damit zu. Dies geschieht ausgehend von seiner auf das Buch bezogenen Aussage: „Im Dienste der Wahrheit musste ich eben hier und da die Richtigkeit manipulieren.“
Wahrheit und Richtigkeit werden einander gegenübergestellt und Kehlmanns „Wahrheit“, hier verstanden als der Kunst- und Symbolcharakter, den er seinem Humboldt angeeignet hat, wird deutlich herausgestrichen. So ist es gegebenenfalls möglich, Einblicke in das der Vermessung der Welt zugrundeliegende Literaturverständnis zu schaffen und Verunsicherungen über Authentizität, bzw. deplatzierten Ansprüchen an die Authentizität dieses und ähnlicher Werke entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Methodisches Vorgehen
2. Kehlmanns literarisches Werk und seine Einflüsse
2.1. Die Romane Daniel Kehlmanns
2.2. Kehlmann und Magischer Realismus
2.3 Die Vermessung der Welt
3. Zur Gattungsfrage der Vermessung der Welt
3.1. Historischer Roman, Biographie, Satire
3.2. Widersprüche um Die Vermessung der Welt
4. Der Charakter Alexander von Humboldts in Die Vermessung der Welt
4.1. Wahrheit und Richtigkeit
4.2. Was Kehlmanns Humboldt symbolisiert
5. Fazit
Verzeichnis der verwendeten Literatur
1. Einleitung
Im Jahr 2005 erschien Daniel Kehlmanns 4. Roman: Die Vermessung der Welt. Er handelt von den Lebensgeschichten zweier Männer, die zur selben Zeit große wissenschaftliche Leistungen erbringen, allerdings auf sehr unterschiedlichen Gebieten und auch auf höchst unterschiedliche Weise: Während der eine in entfernteste Länder reist, um zu forschen, zieht der andere es vor, in ihrer gemeinsamen deutschen Heimat zu bleiben und dort zu neuen mathematischen Erkenntnissen zu gelangen. Die beiden Männer begegnen sich im Buch nur einmal und sind im Wesen so grundverschieden, dass es dem/der Leser/in schon fast wieder leichtfällt, eine Verbindung zwischen ihnen zu knüpfen. Die Namen der beiden Männer kommen vielen Menschen bekannt vor: Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Kehlmanns Roman um jene Protagonisten wurde schnell zum Bestseller. Man übersetzte ihn in 50 Sprachen1 und verkaufte ihn mehr als zwei Millionen Mal.2 Aber neben dem Erfolg suchen sich auch immer wieder kritische Stimmen ihr Gehör. Die Vermessung der Welt (im Folgenden abgekürzt: dVdW) ist ein Buch, an dem sich die Geister scheiden.
1.1. Problemstellung
Schon „ein Blick in die ausländischen - und insbesondere die spanischsprachigen - Feuilletons zeigt, daß nicht überall die Veröffentlichung des Romans euphorisch begrüßt wurde“ (Holl 2012, 48) schreibt der Historiker und Literaturwissenschaftler Frank Holl zu Beginn eines Artikels über die Person des Alexander von Humboldt in Kehlmanns dVdW, in dem er den historischen Alexander von Humboldt kritisch mit dem bei Kehlmann vergleicht. In seinem Artikel will er die mangelnde Authentizität hinter Kehlmanns Roman entlarven. Mit diesem Anliegen ist er nicht allein: „Natürlich lässt sich einwenden, dass vieles von dem, was Kehlmann schreibt, nicht den historischen Tatsachen entspricht. Der Roman ist mit Sicherheit nicht authentisch“3 schreibt der Journalist Uwe Wittstock in einer Laudatio, mit der er Kehlmann den Kleist-Preis verleiht. Kann mangelnde Authentizität jedoch überhaupt ein Einwand sein, wenn es um die Qualität eines Romans geht? „Wenn von Biographie die Rede ist, habe ich nun einmal den Begriff von historischer Wahrheit“,4 schrieb einst Wilhelm von Humboldt an eine Freundin, sicher nicht ahnend, dass der Name seines Bruders einmal Gegenstand einer Diskussion über ebendiese Frage werden würde: Hat ein belletristisches Werk mit historischen Bezügen in diesen auch historisch „wahr“ zu sein? Ist das Buch über Humboldt und Gauß eine „Biografie“, nur weil sie vom Leben zweier, wie es scheint, historischer Persönlichkeiten handelt? Die Bezeichnung fällt durchaus, wenn von dVdW die Rede ist, allerdings spricht man ebenso viel auch von einem „historischen Roman“5 oder nennt das Buch eine „Charakterstudie“.6 Ehe allerdings nicht geklärt ist, welcher Gattung Kehlmanns Text zuzuordnen ist, fällt es schwer, Ansprüche an die Authentizität desselben zu stellen oder diese überhaupt zu „messen“. Das zu tun, erscheint allerdings wichtig, um die Verwirrung auszuräumen, für die ein unterschiedliches und unklares Gattungs- und Kunstverständnis in der Rezeption des Werkes gesorgt hat. Diese geht so weit, dass auf einer Veranstaltung anlässlich des hundertfünfzigsten Todestages Alexander von Humboldts dieser als Päderast beschimpft wird, mit dem Hinweis, es habe so in der Biografie von Kehlmann gestanden,7 während Daniel Kehlmann selbst das Vorwort zu einem tatsächlich historischen Text (zur Neuedition von Charles Darwins Reisetagebuch mit dem Titel Die Fahrt der Beagle) um ein vermeintliches Zitat Humboldts anreichert, das aus seinem eigenen Roman stammt und nie wissenschaftlich belegt worden ist (vgl. Holl 2012, 58). Bei Holl gilt es sogar als ein „erfundenes Humboldt-Zitat“ (ebenda). So sorgt für - oder zeugt von - Verwirrung auch der öffentliche Umgang des Schriftstellers selbst mit seinem Stoff. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, zum Einen, was die Gattungsfrage, zum Anderen, was die Authentizität betrifft. Es wird gefragt, in wie weit Kehlmann mit Humboldt eine literarische Kunstfigur entworfen hat (oder vielleicht auch noch über sein Buch hinaus weiter entwirft) und es wird hinter die Funktionsweise von Kehlmanns literarischem Vorgehen in und um dVdW geblickt.
1.2. Methodisches Vorgehen
Nachdem zunächst der Schriftsteller Daniel Kehlmann anhand seines literarischen Werkes vorgestellt wird, um dVdW darin zu verorten und literarische Richtungen sowie Einflüsse festzustellen, werden Fachtexte herangezogen, welche auf die Gattungsfrage zu sprechen kommen, sowie Interviews mit Kehlmann selbst, sodass ein Fazit betreffs der Gattung gebildet werden kann. Mit diesem ist das Fundament für die nächsten Schritte geschaffen: Die Arbeit wendet sich dann dem Charakter Alexander von Humboldts in dVdW und Kehlmanns öffentlichem Umgang damit zu, ausgehend von seiner auf das Buch bezogenen Aussage: „Im Dienste der Wahrheit musste ich eben hier und da die Richtigkeit manipulie- ren“8 Wahrheit und Richtigkeit werden einander gegenübergestellt und Kehlmanns „Wahrheit“, hier verstanden als der Kunst- und Symbolcharakter, den er seinem Humboldt angeeignet hat, wird deutlich herausgestrichen. So ist es gegebenenfalls möglich, Einblicke in das der Vermessung der Welt zugrundeliegende Literaturverständnis zu schaffen und Verunsicherungen über Authentizität, bzw. deplatzierten Ansprüchen an die Authentizität dieses und ähnlicher Werke entgegenzuwirken.
2. Kehlmanns literarisches Werk und seine Einflüsse
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Romane Kehlmanns gegeben, denen dVdW nachfolgte, um etwaige Zusammenhänge herauszustreichen und dVdW in Daniel Kehlmanns Gesamtwerk zu verorten. Neben Romanen von Kehlmann existieren diverse Erzählungen, Essays und Vorlesungen, welche allerdings aufgrund ihrer abweichenden Textart und ihrer größeren zeitlichen Distanz zum Erscheinungsjahr von dVdW hier nicht mit einbezogen werden.
2.1. Die Romane Daniel Kehlmanns
Der erste erschienene Roman von Kehlmann trägt den Titel Beerholms Vorstellung. Wie bei dVdW geht es darin um eine Lebensgeschichte. Allerdings werden wir nicht mit einer historischen Persönlichkeit konfrontiert, sondern mit einem Magier, der auf der Aussichtsplattform, von der er plant, sich zu stürzen, sein Leben aufschreibt.9 Nach einem Buch mit Erzählungen erscheint Kehlmanns zweiter Roman, Mahlers Zeit, der von einem jungen Physiker handelt, welcher im Traum zur Erkenntnis darüber gelangt, wie sich die Linearität der Zeit aufheben lässt, und der im Anschluss versucht, sein neues Wissen mit der Welt zu teilen.10 Auf eine Novelle folgt der dritte Roman mit dem Titel Ich und Kaminski. Darin versucht ein exzentrischer Kunstkritiker die Biografie eines Künstlers zu schreiben, der ebenso eigen ist wie er selbst.11 Schon das nächste Werk ist dVdW.
Stellt man diese vier Romane nebeneinander, zeigen sich deutliche Parallelen und offenbar bevorzugte Themen Kehlmanns. Bereits ohne eine tiefere Analyse der Werke lassen sich verschiedene Aspekte feststellen, die hier aufgezählt werden:
1. Genialität: In allen vier Romanen hat es der/die Leser/in mit Genies zu tun, begegnet in Beerholms Vorstellung außergewöhnlich begabten Magiern, in Mahlers Zeit einem genialen Physiker, in Ich und Kaminski einem außergewöhnlichen Künstler (welcher sich durch vermeintliche Blindheit entweder als genialer Maler oder aber genialer Täuscher darstellt) und schließlich in dVdW einem genialen Mathematiker und einem herausragenden For- scher.12 Hier haben wir es also mit einem gern aufgegriffenen Thema seitens Kehlmann zu tun.
2. Biografie: In Beerholms Vorstellung, Ich und Kaminski und dVdW lässt sich ein deutlicher Hang zur Beschreibung und Erarbeitung von (fiktiven) Biografien ausmachen. Die Behandlung von Lebensgeschichten in dVdW ist somit für Kehlmann nichts Neues, allerdings handelt es sich dort zum ersten Mal um Personen, die historisch belegt und bekannt sind.
3. Naturwissenschaft: In Beerholms Vorstellung, Mahlers Zeit und dVdW spielen Naturwissenschaften und Naturgesetze eine Rolle: Auf der vom Rowohlt Verlag gepflegten Website zu Daniel Kehlmann wird Beerholms Vorstellung als eine „leise Geschichte von der Magie der Zahlen“13 beschrieben, in Mahlers Zeit geht es, wie bereits erwähnt, um Physik, und mit Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt macht Kehlmann in dVdW zwei Naturwissenschaftler zu seinen Hauptprotagonisten. Wir sehen, dass Kehlmann auch hier seiner Romantradition mit dVdW treu geblieben ist.
4. Gebrochene Wirklichkeit: In Beerholms Vorstellung ist es für den/die Leser/in manchmal schwer zu unterscheiden, was fiktive Wirklichkeit ist und was nicht.14 Die Hauptfigur Beerholm neigt zum Phantasieren und der/die Leser/in wird im Unklaren darüber gelassen, ob sich gewisse Handlungen, Personen und Orte nur in Beerholms Vorstellung abspielen oder in der Romanwelt tatsächlich existieren (ebenda).
Also, in meinen Romanen ging es mir immer um das Spiel mit Wirklichkeit, das Brechen von Wirklichkeit. Und, ich sage das jetzt ganz offen, es gehörte zu meinen bedrückendsten Erleb - nissen als Schriftsteller, daß so etwas in Deutschland einfach nicht verstanden wird,15 so Kehlmann über das Verhältnis von Wirklichkeit und Phantasie in seinen Romanen. Wie diese Worte erwarten lassen, findet sich nicht nur in Beerholms Vorstellung eine Art des Brechens von Wirklichkeit wieder; in Mahlers Zeit beispielsweise entdeckt man sie anhand der Aushebelung der Zeitlinearität (vgl. Halter 1999). Auch in dVdW gibt es diverse Spiele mit der Wirklichkeit, welche in Punkt 2.3. Die Vermessung der Welt anschaulich gemacht werden.
5. Parallelität: Beim Vergleich zwischen Ich und Kaminski und dVdW fällt auf, dass in beiden Werken zwei Charaktere parallel zueinander angelegt sind. Kaminski und sein Gegenspieler Sebastian Zöllner stehen sich im einen,16 Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß im anderen Roman gegenüber (vgl. Kehlmann 2012).
Man darf feststellen, dass dVdW sich thematisch und auch formal nahtlos in die Reihe seiner Vorgänger-Romane einfügt. Umso verwunderlicher ist die plötzliche Verunsicherung und Kritik in Bezug auf Authentizität bei dVdW, welche innerhalb der Rezeption vorangegangener Romane Kehlmanns keine Rolle gespielt zu haben scheint. Unterscheiden lässt sich dVdW von seinen vorangegangen Romanen allerdings darin, dass dieser Roman in der ferneren Vergangenheit (18./19. Jahrhundert) angesiedelt ist und somit der Aspekt der Historie und Historizität eine Rolle spielt (vgl. ebenda). Dies öffnet der Frage nach Authentizität die Tür: Es mag sich der Anspruch entwickeln, dass sich die fiktiven Biografien der beiden Hauptfiguren streng nach der historischen Vorlage richten. Wie es ja bereits Wilhelm von Humboldt ausgedrückt hat: „Wenn von Biographie die Rede ist, habe ich nun einmal den Begriff von historischer Wahrheit“ (Wilhelm von Humboldt 1847, zit. n. Holl 2012, 50). Historische Wahrheit jedoch kann zu einer Wirklichkeit werden, mit der Kehlmann spielt, die er, anders gesagt, „bricht“, womit die Authentizität von dVdW zum Diskussionsthema wird.
2.2. Kehlmann und Magischer Realismus
Der Magische Realismus ist ein Erzählstil, der im zeitgenössischen Roman recht häufig Verwendung findet.17 Er verknüpft das Irreale mit einer Romanwelt, welche auf den/die Leser/in aufgrund bekannter Frames und Skripts realistisch wirkt18 und welche auf eine allgemein leicht verständliche Weise erzählt wird:
Der realistische Text ist mit konventionellen Codes, über die wir aufgrund unseres Alltagswissens und unserer Medienkompetenz selbstverständlich verfügen, problemlos zu lesen. Seine Textur kommt daher bei der Lektüre gar nicht in den Blick, die Leserinnen und Leser bewegen sich [...] immer schon im Inhaltlichen. (Bassler 2017, 40)
Wenn Daniel Kehlmann vom „Brechen von Wirklichkeit“ (Kehlmann 2007, 16) spricht, dann geschieht es unter dem Einfluss des Magischen Realismus. So sagt er selbst:
Ich war [...] sehr beeindruckt von der südamerikanischen Literatur, und hatte gleichzeitig das Gefühl, daß mir als deutschem Autor vieles von dem, was diese Autoren an emotionalen und künstlerischen Möglichkeiten haben, nicht zu Gebote steht. Ich kann nicht wie Garcia Marquez eine schöne Frau beim Wäscheaufhängen davonfliegen lassen. (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker)
Garcia Marquez ist ein bekannter Vertreter des Magischen Realismus (vgl. Bassler 2017, 38). Kehlmann spricht von ihm in einer Reihe mit anderen südamerikanischen Autoren, die ebenfalls im Stil des Magischen Realismus schreiben und nennt ihren Erzählstil die „größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts“ (Kehlmann 2007, 14). Ein solcher Erzählstil muss in einem Roman wie dVdW, der sich auf historische Personen und Ereignisse bezieht, unweigerlich die etwaige historische Authentizität beeinflussen. Im nächsten Schritt wird untersucht, wo sich Magischer Realismus in dVdW findet und in wieweit die Figur des Alexander von Humboldt in ihrer Darstellung möglicherweise davon betroffen ist.
2.3 Die Vermessung der Welt
Die Vermessung der Welt erzählt vom Leben und Aufwachsen zweier Personen, deren Namen historisch bekannt sind: Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt. Das Werk erzählt auch von ihrer Art zu lernen und zu forschen; der eine als Mathematiker hinter seinem Schreibtisch in Deutschland, der andere als Naturforscher und Abenteurer auf Reisen in der ganzen Welt (vgl. Kehlmann 2012). Die parallel laufenden biografischen Handlungsstränge umschließt eine Rahmenhandlung, in der die beiden Hauptfiguren bereits ein hohes Alter erreicht haben und Gauß mit seinem Sohn nach Berlin fährt, wo ihn Humboldt eingeladen hat, an einem Naturforscherkongress teilzunehmen (vgl. ebenda).
Kehlmann bedient sich in dVdW einer einfachen, leicht verständlichen Sprache, schreibt also nach Bassler einen „realistischen Text“ (s.o.). Der/die Leser/in bewegt sich somit komplett im Inhaltlichen und beschäftigt sich, abgesehen von einer einzigen textlichen Auffälligkeit, nämlich dem weitgehenden Verzicht auf wörtliche Rede und dem stattdessen genutzten Konjunktiv I (dazu später mehr) nicht mit der Textur. Aber wird der Realismus auch „magisch“? Wir wissen, dass Kehlmann in seinen Romanen das Brechen von Wirklichkeit stets im Sinn hat (s.o.); dass er es auch in dVdW darauf anlegt, lassen seine Worte über das Buch zumindest stark vermuten: Das Problem seiner Hauptcharaktere sei, so Kehlmann, „daß sie in einer Welt leben, in der Kunst keine Rolle spielt. Das ist das eigentlich Inhumane an ihnen. Und dem setze ich, auch formal, Südamerika entgegen, also das Primat des scheinbar unstrukturierten, sprudelnden Erzählens“ (Kehlmann 2007, 40). Es scheint, als solle hier nach der Enttäuschung über eine deutsche Leserschaft, die sich dem Magischen Realismus verschlossen hat, ebendieses Nichtverständnis dem Magischen Realismus entgegengesetzt und durch das beobachtbare Zusammenspiel dieser beiden Kräfte Verständnis geschaffen werden. Eine Textstelle im Roman untermauert diese Vermutung sehr deutlich: Vier Ruderer, mit denen Alexander von Humboldt und sein Begleiter Bon- pland auf einem Fluss in Südamerika unterwegs sind, und die bezeichnenderweise allesamt Vornamen bekannter Vertreter des Magischen Realismus tragen („Julio Cortazar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marquez“19 ),bitten Humboldt, etwas zu erzählen. Währenddessen springt auf dem Boot ein wilder Affe herum, „schlug Purzelbäume, belästigte die Ruderer, kletterte am Bootsrand entlang, sprang auf Humboldts Schulter“ (Kehlmann 2012, 127). Diese wilde, südamerikanische Umwelt mit ihren Vertretern des Magischen Realismus wird Folgendem entgegengesetzt:
Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könnte das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb der Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald werde man tot sein. (Kehlmann 2012, 128)
Humboldt wirkt dem wilden Verhalten des Affen mit Ordnung entgegen. Sein vorgetragenes Gedicht, Über allen Gipfeln von Goethe, ist schmucklos und realistisch dargestellt. Die Reaktionen seiner Mitreisenden darauf sind verhalten:
Alle sahen ihn an.
Fertig, sagte Humboldt.
Ja wie, fragte Bonpland.
Humboldt griff nach dem Sextanten.
Entschuldigung, sagte Julio. Das könne doch nicht alles gewesen sein.
Es sei natürlich keine Geschichte über Blut, Krieg und Verwandlungen, sagte Humboldt gereizt. Es komme keine Zauberei darin vor, niemand werde zu einer Pflanze, keiner könne fliegen oder esse einen anderen auf. Mit einer schnellen Bewegung packte er den Affen, der gerade versucht hatte, ihm die Schuhe zu öffnen, und steckte ihn in den Käfig. (Ebenda)
Hier spielt Humboldt deutlich auf den Magischen Realismus an, dessen Repräsentanten ihn zuvor um eine Geschichte gebeten hatten und die er mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber allem „Magischen“ enttäuscht hat. Um seiner Liebe für Ordnung und reinen Realismus Nachdruck zu verleihen, steckt er den wilden Affen in den Käfig, sperrt das magische Südamerika und seinen Magischen Realismus somit weg und widmet sich rasch wieder der Arbeit.
Es fällt auf, dass Humboldt in dVdW im Vergleich zu Gauß besonders häufig mit Irrealem konfrontiert wird. So muss er sich beispielsweise mit der Idee auseinandersetzen, dass Menschen früher einmal möglicherweise fliegen konnten („Menschen flögen nicht, sagte Humboldt. Selbst wenn er es sähe, würde er es nicht glauben“ (Kehlmann 2012, 138)), wird von den Geistern eines Hundes („Ob bitte irgendwer den Hund an die Leine nehmen könne!“ (Kehlmann 2012, 177)) und seiner verstorbenen Mutter heimgesucht („Dann sah er die Gestalt seiner Mutter neben sich. Er blinzelte, doch sie blieb länger sichtbar, als es sich für eine Sinnestäuschung gehörte“ (Kehlmann 2012, 74)) und sogar von einem UFO verfolgt:
Eine Zeitlang folgte ihnen eine metallische Scheibe, flog vor und dann wieder hinter ihnen, glitt lautlos durch den Himmel, verschwand, tauchte wieder auf, kam für Minuten so nahe, daß Humboldt mit dem Fernrohr die gekrümmte Spiegelung des Flusses, ihres Bootes und seiner selbst auf ihrer gleißenden Oberfläche wahrnehmen konnte. Dann raste sie davon und kam nie wieder. (Kehlmann 2012, 135)
Genau genommen ist von den beiden Hauptfiguren Humboldt derjenige, dem Südamerika, wie Kehlmann sagt, „entgegengesetzt“ wird. Er tritt ganz offenbar als eine Symbolfigur für die deutsche Leserschaft auf, die den Magischen Realismus nicht annimmt oder auch nicht einmal bemerkt. Durch ihn wird das Spannungsfeld erzeugt, mit dem Kehlmann dem deutschen Publikum seinen Magischen Realismus, seine „gebrochene Wirklichkeit“ näherbringt. Er ist in dieser Hinsicht die Schlüsselfigur:
Man merkt dann doch, daß man aus einer anderen Kultur kommt, daß einem zwar die Möglichkeit gegeben ist, mit diesen Dingen zu spielen, aber auf andere Art. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, Humboldt ist mein Schlüssel, denn er hat diese Welt betreten, aber er hat sie als Deutscher betreten. Das ist etwas, was ich erzählen kann, womit ich künstlerisch etwas anfangen kann, weil da beide Seiten etwas mit mir zu tun haben. (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker)
3. Zur Gattungsfrage der Vermessung der Welt
Der Germanist Moritz Bassler, der den Magischen Realismus bei Kehlmann untersucht hat, ist der Meinung: „Kehlmanns Erzählen erweitert oder ,bricht‘ gar nicht die Regeln ,der Wirklichkeit4, sondern allenfalls Genreregeln“ (Bassler 2017, 42). Im Folgenden soll die Gattungsfrage von dVdW insofern geklärt werden, als dass sich im Anschluss klar benennen lässt, wo Kehlmann aus den Genres, die seinem Roman nachgesagt werden, ausbricht, wo man sich also möglicherweise nicht auf eine genretreue Darstellungsweise der Figuren verlassen kann, bzw. welches Genre bei einer möglicherweise weniger „authentischen“ Charakterdarstellung Humboldts nicht mehr in Frage käme.
3.1. Historischer Roman, Biographie, Satire
Der junge Autor [Kehlmann], der zum Zeitpunkt der Niederschrift seines Romans so alt war wie Alexander von Humboldt bei seinem Aufbruch in die Neue Welt, hat eine Gelehrtensatire vorgelegt, ein Genre, das schon immer bei den Lesern hoch im Kurs stand, um später nur allzu leicht in Vergessenheit zu geraten.20
So spricht der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette und siedelt dVdW damit in einem Genre an, in dem es um gezielte Übertreibung geht. Ebendiese vermutet der/die Leser/in auch, wenn sich Humboldt beispielsweise zum Schlafen eine Uniform anfertigen lässt (vgl. Kehlmann 2012, 38) oder sich absichtlich den Anblick einer Sonnenfinsternis entgehen lässt, um die Geräte zu überwachen, mit denen er dieselbe vermessen will (vgl. Kehlmann 2012, 80), allerdings ist die Frage, inwiefern tatsächlich das Gelehrtentum dabei im Fokus steht; bisher ließ sich feststellen, dass Humboldt in dVdW als Repräsentant des Deutschen, bzw. der deutschen Leserschaft auftritt. Die Bezeichnung „Gelehrtensatire“ deckt diese Eigenschaft von Humboldt nicht ab und mag daher etwas kurz gefasst oder zu speziell erscheinen. Der allgemeinere Begriff der „Satire“ wiederum bedarf zudem eines realen Zustandes oder einer realen Person, die es durch „Übertreibung, Ironie und (beißenden) Spott“21 anzuprangern oder zu geißeln gilt. In dieser Gattung müsste es sich also ganz klar um den historischen Humboldt handeln, der zwar überspitzt dargestellt ist, aber die dem historischen Humboldt gehörenden Eigenschaften mitbringt; es sollte sich dann nicht um eine neu erdachte Kunstfigur handeln, die in ihrem Charakter wenig bis gar nichts mit dem historischen Humboldt gemein hat.
Kehlmann selbst spricht davon, das Vorhaben eines historischen Romans gehabt zu haben, sich in dVdW aber aus guten Gründen nicht auf dieses Genre festzulegen:
Wenn man zum ersten Mal darüber nachdenkt, einen historischen Roman zu schreiben, ist man zunächst eingeschüchtert von all den Trivial-Fallen, die da lauern. Deshalb verwende ich auch den Begriff historischer Roman normalerweise nicht, sondern nenne es einen Gegenwartsro - man, der in der Vergangenheit spielt. (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker)
In der Rezeption allerdings wird dVdW zu weiten Teilen als historischer Roman oder Biografie gehandhabt: Gattungen, von denen im Allgemeinen eine gewisse Wahrheit erwartet wird. Wenn Walter Schwenk das Buch eine „grandiose Charakterstudie zweier Weltbürger“ (Schwenk 2005, 246) nennt, spricht er von den historischen Charakteren Gauß und Humboldt und nicht von Fiktion. Bassler meint:
Die Forschung sieht Die Vermessung der Welt im Kontext einer Renaissance des historischen Romans‘, der historische Figuren und Ereignisse erzähle, ,ohne zu behaupten, daß alles genau so war, wie es hier geschrieben steht‘.
Hierbei zitiert er Friedhelm Marx‘ Text „Die Vermessung der Welt“ als historischer Roman. 22 Dass die Forschung sich aber nicht unbedingt einig ist, beweisen jedoch Holl und Ette, die in ihren Texten zur Vermessung der Welt aufzuklären versuchen, wie viel Authentizität in Kehlmanns Werk steckt (vgl. Holl 2012 und Ette 2012) und es auch teilweise bemängeln, wenn sie nur wenig davon finden (vgl. ebenda). Darüber hinaus gibt es diverse Aussagen in der Rezeption der Vermessung der Welt, die zeigen, dass die Inhalte des Werkes weitgehend unreflektiert als historische Wahrheit gehandhabt werden: „Humboldts Resümee wirkt auch deshalb so komisch, weil Kehlmann zuvor gezeigt hat, wie unbekannt sich dieser unermüdliche Forscher selbst geblieben ist“ (Wittstock 2006), schreibt zum Beispiel Wittstock in seiner Laudatio und trifft dabei ohne jegliche Reflektion eine auf dem Buch Kehlmanns basierende Aussage über den historischen Humboldt. Auch das Weltbild des historischen Humboldt wagt er auf Grundlage von Kehlmanns Buch zu beurteilen: „Gauß war einer der ersten Forscher, der mit mathematisch-physikalischen Mitteln zeigen konnte, dass Humboldts übersichtliches und so adrett gegliedertes Weltbild nur eine freundliche Täuschung war“ (ebenda). Holl stellt fest:
Eine hervorragende Quelle für die Rezeptionsforschung sind die Amazon-Feedbacks. Aus ihnen wird deutlich, wie groß die Anzahl der Leser ist, die, wie Thomas Gottschalk, dem Miss - verständnis erliegen, den Roman Die Vermessung der Welt und seine Protagonisten im Großen und Ganzen als wahr anzusehen und meinen, sich durch ihn bilden zu können. (Holl 2012, 60)
Ein Blick in die aktuellen Amazon-Feedbacks bestätigt Holls Aussage auch heute noch, wenn es auch inzwischen vereinzelte Stimmen gibt, die darauf hinweisen, dass es sich um Fiktion handelt.
Letztendlich bleibt bei belletristischen Texten immer die Frage nach Wahrheit oder Fiktion, denn, wie der Germanist Martin Gerstenbräun treffend ausdrückt:
Die prinzipielle Unterscheidung von Realität und Fiktion erscheint nur auf den ersten Blick als eine logische, da alle Versuche, Wahrnehmungen von Menschen exakt wiederzugeben, grundsätzlich zum Scheitern verurteilt sind. Es gibt keine objektivierbare Realität.23
Nach Michael Scheffel gibt es so etwas wie eine „Konsens-Wirklichkeit“24, eine „Übereinkunft, die mehr oder weniger stillschweigend getroffen wird, um eben Realität von Fiktion abzugrenzen“ (Gerstenbräun 2012, 22). Gerstenbräun weist darauf hin, dass Fiktion in der Regel markiert wird und nennt verschiedene Markierungstechniken: „Modus der Publikation, die Darbietungsweise, aber auch weniger eindeutige Signale wie Schreibstil oder Autorschaft. [...] Fiktion erfüllt [...] den Zweck, eben nicht im klassischen Sinn zweckgebunden zu sein“ (Ebenda). Sucht man bei Kehlmann nach solchen Markierungstechniken, so findet man sie durchaus: Die Vermessung der Welt wurde von einem Autoren verfasst, der zuvor nur fiktive Romane geschrieben hatte, das Buch enthält keinerlei Danksagungen, die auf historische Recherche hinweisen und auch kein Vor- oder Nachwort, in dem Ähnliches genannt wird, zudem kein Literaturverzeichnis. All dies ist normalerweise üblich in historischen Romanen oder Biografien. Auch ist dVdW nicht im klassischen Sinne zweckgebunden. Doch wenn die Markierung als fiktiver Text so deutlich ist, wieso werden die Inhalte in dVdW dann von so vielen Leser/innen als „bare Münze“ genommen und von anderen wird der Wahrheitsgehalt des Werks kritisiert?
3.2. Widersprüche um Die Vermessung der Welt
Eine Besonderheit bei Die Vermessung der Welt im Vergleich zu anderen Gegenwartsromanen mit Vergangenheitsbezug, wie das Werk hier fortan entsprechend dem Sinne des Autoren bezeichnet werden soll, sind die widersprüchlichen Aussagen, die Kehlmann in der Öffentlichkeit um den Roman herum spinnt. Es findet sich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, ein fiktives Zitat aus seinem Roman im Vorwort zu einem tatsächlich historischen Werk von Darwin („Die zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei, hatte Humboldt ausgerufen, die größte aber die Behauptung, er stamme vom Affen ab. Eine Verständigung zwischen beiden [Humboldt und Darwin] kam nicht zustande“)25. Die pure Möglichkeit dieser Aussage seitens Humboldt ist rasch entkräftet, wenn man bedenkt, dass Darwins Theorie, Mensch und Affe könnten sich aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben, erst nach Humboldts Tod diskutiert wurde (vgl. Holl 2012, 57) und die Verständigung zwischen Humboldt und Darwin aus einem regen und wohlwollenden Briefkontakt bestand, aus dem hervorgeht, dass Humboldt Darwin eine Inspiration war und umgekehrt Humboldt die Arbeiten Darwins als sehr wichtig einschätzte (vgl. Holl 2012, 58). Holl kann sich aus diesem erfundenen Humboldt-Zitat Kehlmanns keinen Reim machen. Er fragt: „Ist dies ein postmodernes Spiel mit seiner Leserschaft? Ist es Hybris? Ist es ein augenzwinkerndes ,Catch me if you can‘?“ (Ebenda). Kehlmann behauptet allerdings nicht immer, was in seinem Werk stünde, sei historisch korrekt:
Der historische Mensch selbst ist gewissermaßen ein Magnet, und um ihn herum ist ein Feld, in dem man sich erfindend bewegt. Kommt man der ursprünglichen Gestalt zu nahe, dann schreibt man einfach eine Biographie, und das ist nicht der Sinn der Sache. Entfernt man sich aber so weit, daß die Kraft ihres Feldes nicht mehr spürbar ist, so hat man das künstlerische Recht verloren, diese Namen zu verwenden und man unternimmt etwas ganz Sinnloses. (Kehlmann 2007, 26)
Zugleich meint er: „Im Dienste der Wahrheit musste ich eben hier und da die Richtigkeit manipulieren“ (Kehlmann, Matussek 2005) und wirft damit die Frage auf: Hat er frei erfunden oder hielt er sich im Erfinden an das, was ihm als Möglichkeit in den Sinn kam; nach dem Motto: Was hätte sein können? Im Dienste welcher Wahrheit hat er die Richtigkeit manipuliert, und was meint er mit „hier und da“? Kann man sagen, dass er sich beim Erzählen von Humboldt noch im Magnetfeld des historischen Humboldt aufgehalten hat? Hält er sein Humboldt-Zitat für wahr, obwohl Humboldt es nie tatsächlich ausgesprochen hat, vertritt Kehlmann möglicherweise den Standpunkt, Humboldt hätte es aber aussprechen können und dadurch habe es, zumindest aus künstlerischer Sicht, einen Wahrheitsgehalt? Zumindest wiederholt Kehlmann das Zitat auch an anderen Stellen, so z.B. in verschiedenen Interviews und in seiner dem Roman folgenden Schrift Wo ist Carlos Montufar? (vgl. Holl 2012, 57), und verleiht ihm damit einen gewissen Nachdruck zum Teil auch weit außerhalb künstlerischer Kontexte. Indem er öffentlich Aussagen über Humboldt trifft, die seinem Roman entstammen, ohne dass sie jedoch im Kontext von dVdW getroffen werden oder nicht als Aussagen, die sich auf den Roman beziehen, markiert sind, schafft er Unsicherheit in mehreren Punkten: 1. Es ist unklar, wie sehr er sich in dVdW vom historischen Humboldt entfernen wollte und wie groß sein eigener Wahrheits-, bzw. Authentizitätsanspruch ist. 2. Kehlmanns Definition von „Wahrheit“ und „Richtigkeit“ scheint sich vom allgemeinen Konsens zu unterscheiden, bleibt aber unerklärt. 3. Auf dem Weg, diese Begriffe zu definieren, gerät man an Stolpersteine auch dadurch, dass man weder im Buch, noch im öffentlichen Gespräch mit Kehlmann sicher sein kann, wo er sich auf den historischen Humboldt bezieht und wo auf seine eigenen Erfindungen.
Die große Möglichkeit historischen Erzählens besteht eben darin, Geschichte, vorbei an den festgeschriebenen Versionen, auf solche Art neu zu fassen, dass dabei gemeinhin verschwiegene oder übersehene Wahrheiten sichtbar werden (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker), so Kehlmann. Und:
Natürlich ist es eine Gratwanderung, was man mit historischen Figuren anstellt. Bei den Recherchen gewinnt man ein sehr deutliches Bild; doch dann erfindet man auch dazu, um dieses Bild noch deutlicher herauszuarbeiten. (Kehlmann, Matussek 2005)
Diese und andere Aussagen machen den Eindruck, dass Kehlmann sich am historischen Vorbild orientiert und lediglich Leerstellen, die durch die Forschung nicht erschlossen sind, mit Erfindung füllt (auch: „Von ihm erzählen heißt, die Tatsachen bis ins Detail kennen, ihre Leerstellen aber skrupellos mit Erfindung füllen“ (Kehlmann 2004, zit. n. Holl 2012, 48)). Gleichzeitig erzählt Kehlmann fernab seines Romans Dinge über Alexander von Humboldt, die nachgewiesen falsch sind26. Eine längere Aussage Kehlmanns soll hierfür als Beispiel dienen, da sie besonders viele Behauptungen über Humboldt enthält und dabei deutlich zeigt, wie unklar es bleibt, ob sich Kehlmann dabei auf die Humboldt-Forschung oder auf seinen Roman bezieht:
Gerade beim Versuch, von ihm zu schreiben, musste ich mir jene Dreistigkeit im Umgang mit den Fakten aneignen, zu der er sich nicht durchringen konnte. An niemandem sonst lässt sich so klar ex negativo demonstrieren, was Poesie ausmacht: Der Botschafter Weimars in Macon- do, jener tief neurotische Mann, den sein Bruder für gemütskrank und seine Schwägerin für wahnsinnig hielt, der elektrische Experimente am eigenen Körper mit einer Brutalität durchführte, die versierte Masochisten ins Staunen brächte, der bei Ataruipe Indianerleichen aus Gräbern zerrte, um sich danach über das Entsetzen der Einheimischen zu mokieren, der für den Einzug in Lima preußische Gardeuniform anzog und sich zum Amüsement des Adels weigerte, sein Barometer aus der Hand zu legen, der keinen Hügel passieren konnte, ohne dessen Höhe zu vermessen, und kein Loch, ohne hineinzukriechen, und dessen Weltbild gerade dadurch so berührend ist, dass daran aus heutiger Sicht gar nichts stimmt (der Weltraum sei mit Äther gefüllt; krank werde man durch üble Miasmen; die zweitgrößte Erniedrigung des Menschen sei die Sklaverei, die größte aber die Vermutung, er stamme vom Affen ab); - wie romanhaft war sein Leben, wie dürr erzählte er es, wie wenig kannte er sich selbst.27
Neben dem bereits diskutierten Humboldt-Zitat über die Abstammung des Menschen vom Affen scheint Kehlmann hier anschaulich machen zu wollen, weshalb sich der historische Humboldt gut anbietet, wenn man sozusagen das Gegenteil von Poesie darstellen will. Doch einige seiner Sätze stellen sich als nicht auf den historischen Humboldt zutreffend heraus. So hat er sich zum Beispiel in keinster Weise über das Entsetzen der Einheimischen „mokiert“, nachdem er Indianerskelette aus ihren Gräbern entnahm, sondern durchaus Verständnis dafür aufgebracht: „Armes Volk,“ schreibt er, „selbst in den Gräbern stört man deine Ruhe!“28 Sein Weltbild derweil, das Kehlmann ja zum Teil ohnehin mit einem nicht belegbaren Zitat beschreibt, scheint aus heutiger Sicht keineswegs völlig überholt zu sein:
Er begriff die Natur als eine globale Kraft mit einander entsprechenden Klimazonen auf verschiedenen Kontinenten: Das war damals ein radikales Konzept, und noch heute prägt es unser Verständnis der Ökosysteme. Humboldts Bücher, Tagebücher und Briefe verraten einen visionären Denker, der seiner Zeit voraus war. (Wulf 2016, 24)
Ein Problem, das uns heute sehr beschäftigt, hat Humboldt sogar zu seiner Zeit bereits ausgemacht:
Nachdem er 1800 sah, welche verheerenden Schäden koloniale Plantagen am Valenciasee in Venezuela angerichtet hatten, warnte Humboldt als erster Wissenschaftler vor den dramatischen Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels. (Ebenda)
Auch dass er sein Leben „dürr“ erzählte, ist angesichts seiner vielen Aufzeichnungen, Berichte und Briefe eine problematische Behauptung. Wenn Kehlmann allerdings die Fakten über Humboldt tatsächlich „bis ins Detail“ kennt, wie er sagt, dann muss es sich bei dem Humboldt, den er hier beschreibt, um einen fiktiven Humboldt handeln, der in seinem Abstand zum historischen Humboldt allerdings über das Füllen von Leerstellen hinausgeht und aus dem Magnetfeld Humboldts heraustritt. Die Aussagen Kehlmanns sind insofern irreführend und widersprüchlich. Hinzu kommt, dass er, während er sein Werk auf der einen Seite bewusst als Fiktion markiert, statt wörtlicher Rede in dVdW stets den Konjunktiv I benutzt, mit der Begründung:
Ein Fachhistoriker geht nicht zu nah ran an die Figuren, an das, was er berichtet, und - und das ist der entscheidende Punkt - er würde nicht behaupten zu wissen, was wörtlich gesagt wurde. Er würde keine wörtliche Rede verwenden, es sei denn, er hat Dokumente und Briefe, aus denen er zitiert. Ansonsten würde er berichten, was inhaltlich ungefähr so gesagt worden sein müßte, sein könnte. Er würde also die indirekte Rede verwenden. (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker)
Kehlmann war es also ein Anliegen, so zu klingen wie ein Fachhistoriker, wenn auch eher „wie ein seriöser Historiker [...], wenn er plötzlich verrückt geworden wäre“ (ebenda). Es ist also kein Wunder, dass dVdW im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt bzw. ihre „Authentizität“ unterschiedlich bewertet wird.
4. Der Charakter Alexander von Humboldts in Die Vermessung der Welt
Im nächsten Schritt soll überprüft werden, ob der fiktive Humboldt in dVdW eine große Distanz zum historischen Humboldt ausweist, wo besonders markante Unterscheidungspunkte liegen und welchen Zweck diese ggf. erfüllen. Da Kehlmann sagt, er habe im Dienste der „Wahrheit“ die „Richtigkeit“ manipulieren müssen (s.o), wollen wir uns nach diesen von ihm gewählten Termini richten und Punkte aufführen, in denen die Wahrheit sich auffällig weit von der Richtigkeit entfernt, um schließlich zu erfahren, was der Wahrheitsbegriff Kehlmanns in Bezug auf Humboldt genau beinhaltet. Geht es um Wahrheit über den historischen Humboldt oder womöglich um eine woanders angesiedelte Wahrheit, für die Humboldt lediglich ein Darstellungsmittel ist, eine Kunstfigur, ein Symbol?
4.1. Wahrheit und Richtigkeit
In dVdW trifft der/die Leser/in auf einen Alexander von Humboldt, der „geradezu ein Monstrum an Selbstbeherrschung, ja Selbstverleugnung“ (Wittstock 2006) ist, eine „Kreuzung aus Don Quixote und Hindenburg“29 Er hat, wie wohl auch der historische Humboldt, ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, wächst mit einem älteren Bruder in Berlin auf und ist finanziell sehr gut gestellt. Erst nach dem Tod seiner Mutter fühlt er sich frei, seiner Leidenschaft, dem Reisen, nachzugehen. Er bereist Europa, Süd- und Mittelamerika, Russland, lernt in den Vereinigten Staaten Thomas Jefferson kennen, findet eine Wasserverbindung zwischen Orinoco und Amazonas, sammelt Tausende von Pflanzen- und Gesteinsproben und führt detaillierte Reisetagebücher, was ihn zu einem der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten macht (vgl. Kehlmann 2012). Dies ist die Geschichte sowohl des historischen als auch von Kehlmanns Humboldt. Doch die Person, die diese Geschichte erlebt, scheint eine gänzlich andere zu sein. Die Uniform, zum Beispiel, die Humboldt „immer wieder anlegt“ (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker) und von der er sich, weil sie ihn stört, eine zweite anmessen lässt, um diese dann nachts beim Schlafen zu tragen (vgl. Kehlmann 2012, 38), ist zwar keine völlige Erfindung des Autors, da Humboldt eine Uniform besaß, aber eine starke Übertreibung: „In Wahrheit hat Humboldt seine Uniform - es war die eines preußischen Oberbergrats - nicht im Bett und auch in Amerika kaum getragen. Sie diente ihm ausschließlich bei offiziellen Anlässen und war ihm, besonders wegen der Hitze, lästig“ (vgl. Faak 2000, n. Holl 2012, 53).
Kehlmann stellt Humboldt als jemanden dar, der sich nicht poetisch ausdrücken kann (siehe z.B. oben die Gedichtwiedergabe von Goethes Über allen Gipfeln) und der sich von Büchern ohne Zahlen beunruhigen lässt („Bücher ohne Zahlen beunruhigen mich“ (Kehlmann 2012, 221) ist ein beliebtes und oft wiederholtes Humboldt-Zitat, das allerdings Kehlmann erfunden hat).
Keine Rede ist [in Die Vermessung der Welt] von der schriftstellerischen Sensibilität, mit der Humboldt in französischer wie in deutscher Sprache experimentelle Schreib- und Buchformen schuf. Keinerlei Erwähnung der Tatsache, daß Humboldt selbst sich bei aller empirischen Fundierung seiner Forschungen vehement gegen jedwede Wissenschaft wandte, die sich auf ein bloßes Messen und Vermessen, auf ein geduldiges Fliegenbeinzählen beschränkt. (Ette 2012, 38)
Bei Kehlmann ist Humboldt „kleingewachsen, aber aufrecht“ (Kehlmann 2012, 36), in Wahrheit ist er mit 1,73 m30 zu seiner Zeit „hoch und schlank“.31 Neben solchen charakterlichen und körperlichen Unterschieden macht sich besonders bemerkbar, wie Humboldt im Buch anders als in Wirklichkeit zur Sklaverei steht. „Wahr“ ist laut Kehlmann zwar auch, dass er etwas dagegen hat, doch tritt er im Roman nur mäßig für die Sklaven, denen er begegnet, ein (siehe z.B.: „Einer der im Hof angeketteten Männer wurde von zwei Priestern mit Lederriemen gepeitscht. [.] Humboldt zögerte. Bonpland, der dazugekommen war, sah ihn vorwurfsvoll an. Aber sie müßten doch weiter, sagte Humboldt leise. Was solle er denn machen?“ (Kehlmann 2012, 118)). „Diese und andere Hinweise auf Humboldts Eintreten gegen die Sklaverei erscheinen im Roman kaum mehr als die Marotte eines weltfremden Reisenden“ (Holl 2012, 52) bemerkt Holl. Es ist „richtig“, aber im Roman nicht vorstellbar, dass Humboldt für die Öffentlichkeit Texte wie diesen verfasst hat:
Ein Regiment, das sich auf die Vernichtung der Freiheit der Eingeborenen gründet, tötet die Geisteskräfte oder hemmt doch ihre Entwicklung. [...] Die Indianer am Orinoco haben in den Äußerungen ihrer Freude, im raschen Wechsel ihrer Gemütsbewegungen etwas Kindliches; sie sind aber keineswegs große Kinder, so wenig wie die armen Bauern im östlichen Europa, die in der Barbarei unseres Feudalsystems sich der tiefsten Verkommenheit nicht entringen können. Zwang als hauptsächlichstes und einziges Mittel zur Zivilisierung des Wilden, erscheint zudem als ein Grundsatz, der bei der Erziehung der Völker und bei der Erziehung der Jugend gleich falsch ist. Wie schwach und wie tief gesunken auch der Mensch sein mag, keine Fähigkeit ist ganz erstorben. Die menschliche Geisteskraft ist nur dem Grad und der Entwicklung nach verschieden.32
All diese Züge an Kehlmanns Humboldt, die sich vom historischen Humboldt unterscheiden, scheinen ein bestimmtes Ziel zu verfolgen:
Der eine, der überall war [Humboldt], der andere [Gauß], der nirgends war; der eine, der immer Deutschland mit sich getragen hat, der andere, der die wirkliche geistige Freiheit verkörpert hat, ohne jemals irgendwohin gegangen zu sein. Das war der Keim für den Roman. (Kehlmann 2006)
Bei Kehlmanns Humboldt geht es offenbar darum, deutsch zu sein. Zwar bietet der historische Humboldt wenig Anlass für diese Symbolik: „Sich selbst nannte er einen ,halben Amerikaner4“33 und „daß einem leid tut, wie er aufgehört hat, deutsch zu sein und bis in alle Kleinigkeiten pariserisch geworden ist“.34 Ottmar Ette merkt bezüglich dVdW an:
Es kann nicht darum gehen, Alexander von Humboldt dreihundert Jahre nach der eigentlichen Gründung des preußischen Staates und hundertdreißig Jahre nach dessen Untergang nachträglich in einen Paradepreußen zu verwandeln, wohl aber, von seiner Figur ausgehend ein erweitertes, nicht allein auf ,deutsche Schicksalsfragen4 reduziertes Preußenbild zu entwerfen. Der sprach- und weltgewandte Intellektuelle hatte keineswegs aufgehört, ,deutsch zu sein‘; doch hatte sich der preußische Weltbürger - und dies scheint mir für unser Jahrhundert zukunftsweisend zu sein - gegen allen Zeitgeist - und auch gegen den heimischen Weltgeist - vehement geweigert, nur deutsch zu sein. (Ette 2002, 117)
Aber Kehlmann „verdeutscht“ seinen Humboldt so lange, bis er, fern von seinem historischen Namensvetter, kaum noch mehr zu sein scheint, als eine Sammlung aller „Vorurteile eines ,typisch Deutschen4. Dazu zählen nicht nur militärisch strikter Ordnungssinn, sondern auch Humorlosigkeit und Patriotismus“ (Holl 2012, 54). „Es geht um die Frage:“, so Kehlmann, „was heißt Deutschsein? In aller Größe und Komik, die dieses Deutschsein ja auch immer wieder hat. Und diese gleichzeitig auch - gerade im öffentlichen Leben - immer präsente Hysterie. Mein Humboldt ist ein Paradebeispiel eines verdrängenden Hysterikers.“35
4.2. Was Kehlmanns Humboldt symbolisiert
Schon in Punkt 2.2. haben wir festgestellt, dass Humboldt bei Kehlmann eine Schlüssel- und auch eine Symbolfigur in der Auseinandersetzung der deutschen Leser/innenschaft mit dem aus Südamerika entspringenden Magischen Realismus ist. Aber nicht nur da steht Humboldt stellvertretend für das Deutsche: Kehlmann bezweckt mit seinem Humboldt ganz und gar eine „satirische, spielerische Auseinandersetzung mit dem, was es heißt, deutsch zu sein - auch natürlich mit dem, was man, ganz unironisch, die große deutsche Kultur nennen kann“ (Kehlmann 2006: Wie ein verrückter Historiker). Die Seiten des Deutschen, die hier widergespiegelt werden sollen, sind ganz offenbar eine übertriebene Selbstbeherrschung, ein Mangel an poetischem Verständnis und sogar eine gewisse Inhumanität. Bedenkt man Kehlmanns Spiel mit Gattungsregeln und seine widersprüchlichen Behauptungen zur Authentizität seines Werkes, die ebenfalls die Gattungsfrage erschweren und in denen er die Ausdrücke „Erfindung“ und „Wahrheit“ synonym zueinander zu verwenden scheint, mag man darüber hinaus zu der These verleitet werden, dass Kehlmanns Humboldt auch die Frage symbolisiert, wie weit Kunst, in diesem Fall in Form von schöngeistiger Literatur und den sich darauf beziehenden Aussagen ihres Schriftstellers, bezüglich Wissenschaft und Historizität gehen darf, wann sie noch als Dichtung erkannt und wann als Falschaussage kritisiert wird. In dieser Hinsicht liegt es auch nahe, eine historische Symbolfigur zu wählen, die möglichst weit von dem, was sie symbolisieren soll, zu dem also ihr fiktives Abbild gemacht werden soll, entfernt ist. Indem man jemanden zum Symbol des Deutschen macht, der historisch eher für seinen Mangel an Deutschsein kritisiert worden ist, und indem man dann noch darauf beharrt, im Dienste der Wahrheit zu handeln, steckt man die Fronten zwischen „Fiction“ und „Science“ klar ab. Kehlmann scheint uns zu beschwören, so wie einst der historische Humboldt: „Prüfen Sie von Neuem, was ich veröffentlicht habe, betrachten Sie alles als falsch, das ist das Mittel, die Wahrheit zu entdecken“36 Dichterische Wahrheit ist eben nicht historische Richtigkeit; das gilt für Biografien und historische Romane genauso wie für Satire und Gegenwartsromane, oder, mit den Worten des Schriftstellers und Naturwissenschaftlers Vladimir Nabokov, auf den auch Kehlmann sich oft beruft (vgl. z.B. Kehlmann 2007, 10): „Literature is invention. Fiction is fiction. To call a story a true story is an insult to both art and truth“37
5. Fazit
In dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, Kehlmanns belletristischen Alexander von Humboldt zwischen Kunst-, Symbolfigur und historischer Persönlichkeit zu verorten. Zunächst haben wir dazu den Roman selbst innerhalb von Kehlmanns Werken verortet und festgestellt, dass er sich in die Reihe eindeutig fiktiver Romane, die Kehlmann zuvor geschrieben hatte, nahtlos einfügt, mit dem einzigen Unterschied, dass dVdW in der Vergangenheit angesiedelt ist. Dies konnte erste Hinweise auf den Grad der Fiktivität von dVdW geben, die auch dadurch verschärft wurden, dass wir in dVdW Bezüge zum Magischen Re- alismus genauso finden können wie in den vorherigen Werken Kehlmanns. Die als Problem in der Forschung ausgemachte Frage nach der Authentizität des Romans konnte selbst infrage gestellt werden. Ihr Ursprung findet sich in der bisher ungeklärten Gattungsfrage, die wiederum auf widersprüchliche Aussagen Kehlmanns über seinen Roman sowie auf Aussprüche seitens Kehlmann zurückzuführen ist, die von ihm nicht als sich auf einen fiktiven Charakter beziehende Aussprüche markiert wurden und dadurch wie Falschaussagen über den historischen Humboldt klingen. Weiter wurde ein kurzer Vergleich zwischen Kehlmanns Humboldt und dem historischen Humboldt gezogen, der zu dem Schluss führte, dass Kehlmann mit seinem Humboldt eine fiktive Symbolfigur geschaffen hat, die das Deutsche repräsentieren soll, ausgehend von der Beziehung deutscher Leser/innen zum Magischen Realismus. Zwar orientieren sich die biografischen Erlebnisse von Kehlmanns Humboldt stark an denen des historischen Humboldt, doch unterscheidet sich der fiktive Humboldt charakterlich und äußerlich so stark vom historischen Humboldt, dass man zwischen beiden Personen klar trennen muss und man in Teilen sagen kann, dass der fiktive Humboldt nahezu das Gegenteil von dem symbolisiert, was den historischen Humboldt ausmacht. Diese Erkenntnis vereinfacht die Gattungsfrage, wenn auch zu ihrer befriedigenden Lösung eine tiefergehende Bearbeitung nötig wäre, die den Rahmen dieser Arbeit überstiege, und räumt Unsicherheiten um die Authentizität der Vermessung der Welt aus. Die Frage, inwieweit Kehlmanns fiktiver Humboldt ein Symbol für die schwierige Beziehung zwischen Fiktion und Wissenschaft ist und als solches in Form von Kehlmanns Aussagen auch aus dem Werk selbst heraustritt, ließe sich in Zukunft noch weiter untersuchen.
Verzeichnis der verwendeten Literatur
1. Werke und Quellen
Duden online (2020): Satire, die. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Satire [Stand 21.02.2020].
Humboldt, Alexander von; Ette, Ottmar (1999): Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 5. Auflage.
Kehlmann, Daniel (2003): Ich und Kaminski. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1. Auflage 2004.
Kehlmann, Daniel, Matussek, Matthias u.a. (2005): Mein Thema ist das Chaos. In: DER SPIEGEL 49/2005. URL: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43513122.html [Stand 04.02.2020].
Kehlmann, Daniel (2005): Wo ist Carlos Montufar? In: Kehlmann, Daniel: Wo ist Carlos Montufar? Über Bücher. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 3. Auflage.
Kehlmann, Daniel (2006): Ich wollte schreiben wie ein verrückt gewordener Historiker. In: FAZ, 09.02.2006. URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/bucherfolg-ich- wollte-schreiben-wie-ein-verrueckt-gewordener-historiker-1304944.html [Stand 01.02.2020].
Kehlmann, Daniel (2007): Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen. Wallstein Verlag, Göttingen.
Kehlmann, Daniel (2012): Die Vermessung der Welt. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 24. Auflage.
Rowohlt Verlag: www.kehlmann.com. URL: http://www.kehlmann.com/buch24.html [Stand 18.02.2020].
2. Forschung
Bach, Philipp, Kahm, Kristine u.a. (2019): Daniel Kehlmann. In: Autor*innenlexikon. Universität Duisburg Essen. URL: https://www.uni-due.de/autorenlexikon/ kehlmann_werkcharakteristika#formalich [Stand 18.02.2020].
Bassler, Moritz: (2017): Genie erzählen. Zu Daniel Kehlmanns Populärem Realismus. In: Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch, 16/2017. Stauffenburg Verlag, Tübingen, S. 37-55.
Buchinger, Lisa (2011): Gattungsuntypische Strategien in den historischen Romanen von Sten Nadolny und Daniel Kehlmann. Diplomarbeit. Wien: Universität Wien.
Choi, Soo Im (2011): Mimesis des Herzens, Momente der Epiphanie. Magischer Realismus in zeitgenössischen Romanen und Filmen. Dissertation. Wien: Universität Wien. Davis, Bettina (2013): Das Schmunzeln im Spiegel (kolonialer) Erinnerung: parodierte nationale Selbstbilder in Christian Krachts Imperium und Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. Masterarbeit. Albuquerque: University of New Mexico.
Demetry, Nils (2016): Ein Fall von früher Meisterschaft. Daniel Kehlmanns Debüt „Beerholms Vorstellung“. URL: https://literaturkritik.de/id/21894 [Stand 14.02.2020].
Dick-Pfaff, Cornelia (2004): Wahre Größe im Mittelalter. URL: https://www.wissen- schaft.de/geschichte-archaeologi e/wahre-groesse-im-mittelalter/ [Stand 02.02.2020].
Ette, Ottmar (2002): „... daß einem leid tut, wie er aufgehört hat, deutsch zu sein.“ Alexander von Humboldt,Preußen und Amerika. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2002, III, 4, S. 98 - 117.
Ette, Ottmar (2012): Alexander von Humboldt in Daniel Kehlmanns Welt. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2012, XIII, 25, S. 34-40.
Fischer, Markus (2016): Vermessene Vermesser. Bestimmungen des Raums in Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt und in Detlev Bucks gleichnamiger Verfilmung. In: Germanistische Beiträge, vol. 38. Universitätsverlag, Hermannstadt, S. 1337.
Gerstenbräun, Martin (2012): a fiction is a fiction is fiction? Metafiktionalität im Werk von Daniel Kehlmann. Tectum Verlag, Marburg.
Halter, Martin (1999): Und täglich grüßt der Tanklastzug. Entropie, irgendwie: Daniel Kehlmanns Roman „Mahlers Zeit“. Frankfurter Allgemeine Zeitung. URL: https://www.fa- z.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-und-taeglich- gruesst-der-tanklastzug-1259373.html [Stand 14.02.2020].
Holl, Frank (2012): „Die zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei - Daniel Kehlmanns neu erfundener Alexander von Humboldt. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2012, XIII, 25, S. 46 - 62.
Nabokov, Vladimir (2002): Lectures on Literature. Harcourt, Inc., New York, 1. Auflage. Sauerwein, Julia (2018): „Beerholms Vorstellung“ von Daniel Kehlmann - Vorstellung, Fiktion oder Wirklichkeit? In: Zaitung. Die Schülerzeitung des MPG Groß-Umstadt. URL: https://zaitung.de/beerholms-vorstellung-von-daniel-kehlmann-vorstellung-fiktion-oder- wirklichkeit/ [Stand 18.02.2020].
Schwenk, Walter (2005): Zu viele Leute halten ihre Gewohnheiten für die Grundregeln der Welt. Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In: FORUM. 31. Jahrgang, 2005, S. 246-249.
Wikipedia (2019): Die Vermessung der Welt. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Ver- messung_der_Welt#Rezeption [Stand 10.02.2020].
Wittstock, Uwe (2006): Daniel Kehlmann und die Risse in der Realität. URL: https://ww- w.welt.de/print-welt/article702761/Daniel-Kehlmann-und-die-Risse-in-der-Realitaet.html [Stand 01.02.2020].
Wulf, Andrea (2016): Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Bertelsmann Verlag, München, 7. Auflage.
Zimmermann, W.F.A. (1859): Das Humboldt-Buch. Alexander von Humboldt. Eine Darstellung seines Lebens und wissenschaftlichen Wirkens sowie seiner persönlichen Beziehungen zu drei Menschenaltern. Gustav Hempel, Berlin, 3. Auflage.
[...]
1 Vgl. Ette, Ottmar (2012): Alexander von Humboldt in Daniel Kehlmanns Welt. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2012, XIII, 25, S. 34-40, S. 35.
2 Vgl. Holl, Frank (2012): „Die zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei ...“ - Daniel Kehlmanns neu erfundener Alexander von Humboldt. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2012, XIII, 25, S. 46 - 62, S. 48.
3 Wittstock, Uwe (2006): Daniel Kehlmann und die Risse in der Realität. URL: https://www.welt.de/print- welt/article702761/Daniel-Kehlmann-und-die-Risse-in-der-Realitaet.html [Stand 01.02.2020].
4 Humboldt, Wilhelm von (1847): Briefe an eine Freundin. Brockhaus, Leipzig, 2. Auflage, S.380, zit. n. Holl 2012, 50.
5 Vgl. Marx, Friedhelm (2008): „Die Vermessung der Welt“ als historischer Roman. In: Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“. Materialien, Dokumente, Interpretationen. Rowohlt, Reinbek, S. 169-186, n. Bassler 2017, 42.
6 Schwenk, Walter (2005): Zu viele Leute halten ihre Gewohnheiten für die Grundregeln der Welt. Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In: FORUM. 31. Jahrgang, 2005, S. 246.
7 Vgl. „Alexander von Humboldt - Remapping Global Perspectives. Commemoration of Alexander von Humboldt on the 150th Anniversary of His Death.“ Veranstaltung im German Historical Institute, Washington, D.C. 4. Mai 2009, n. Holl 2012, 58.
8 Kehlmann, Daniel, Matussek, Matthias u.a. (2005): Mein Thema ist das Chaos. In: DER SPIEGEL 49/2005. URL: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43513122.html [Stand 04.02.2020].
9 Vgl. Demetry, Nils (2016): Ein Fall von früher Meisterschaft. Daniel Kehlmanns Debüt „Beerholms Vorstellung“. URL: https://literaturkritik.de/id/21894 [Stand 14.02.2020].
10 Vgl. Halter, Martin (1999): Und täglich grüßt der Tanklastzug. Entropie, irgendwie: Daniel Kehlmanns Roman „Mahlers Zeit“. Frankfurter Allgemeine Zeitung. URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-und- taeglich-gruesst-der-tanklastzug-1259373.html [Stand 14.02.2020].
11 Vgl. Kehlmann, Daniel (2003): Ich und Kaminski. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1. Auflage 2004.
12 Vgl. Kehlmann, Daniel (2012): Die Vermessung der Welt. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 24. Auflage.
13 Rowohlt Verlag: www.kehlmann.com. URL: http://www.kehlmann.com/buch24.html [Stand 18.02.2020].
14 Vgl. Sauerwein, Julia (2018): „Beerholms Vorstellung“ von Daniel Kehlmann - Vorstellung, Fiktion oder Wirklichkeit? In: Zaitung. Die Schülerzeitung des MPG Groß-Umstadt. URL: https://zaitung.de/beerholms-vorstellung-von-daniel-kehlmann-vorstellung-fiktion-oder-wirklichkeit/ [Stand 18.02.2020].
15 Kehlmann, Daniel (2007): Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen. Wallstein Verlag, Göttingen, S. 16.
16 Vgl. Bach, Philipp, Kahm, Kristine u.a. (2019): Daniel Kehlmann. In: Autor*innenlexikon. Universität Duisburg Essen. URL: https://www.uni-due.de/autorenlexikon/kehlmann_werkcharakteristika#formalich [Stand 18.02.2020].
17 Vgl. Choi, Soo Im (2011): Mimesis des Herzens, Momente der Epiphanie. Magischer Realismus in zeitgenössischen Romanen und Filmen. Dissertation. Wien: Universität Wien, S. 5-12.
18 Vgl. Bassler, Moritz: (2017): Genie erzählen. Zu Daniel Kehlmanns Populärem Realismus. In: Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch, 16/2017. Stauffenburg Verlag, Tübingen, S. 40ff.
19 Vgl. Rickes, Joachim (2012): Daniel Kehlmann und die lateinamerikanische Literatur. Königshausen & Neumann, Würzburg, S. 68f, zit. n. Bassler 2017, 38.
20 Ette, Ottmar (2012): Alexander von Humboldt in Daniel Kehlmanns Welt. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2012, XIII, 25, S. 35.
21 Duden online (2020): Satire, die. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Satire [Stand 21.02.2020].
22 Marx, Friedhelm (2008): „Die Vermessung der Welt“ als historischer Roman. In: Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“. Materialien, Dokumente, Interpretationen. Rowohlt, Reinbek, S. 169-186, zit. n. Bassler 2017, 42.
23 Gerstenbräun, Martin (2012): a fiction is a fiction is fiction? Metafiktionalität im Werk von Daniel Kehlmann. Tectum Verlag, Marburg, S. 22.
24 Scheffel, Michael (1997): Formen selbstreflexiven Erzählens. Studien zur deutschen Literatur. Band 145, Niemeyer Verlag, Tübingen, zit. n. Gerstenbräun 2012, 22.
25 Kehlmann, Daniel (2006): Die Finken und die Wilden. Einleitung. In: Darwin, Charles: Die Fahrt der Beagle. Tagebuch mit Erforschungen der Naturgeschichte und Geologie der Länder, die auf der Fahrt von HMS Beagle unter dem Kommando von Kapitän Fritz Roy, RN, besucht wurden. Marebuchverlag, Hamburg, S,15, zit. n. Holl 2012, 58.
26 Vgl. Holl 2012, ab S. 48 und Wulf, Andrea (2016): Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Bertelsmann Verlag, München, 7. Auflage.
27 Kehlmann, Daniel (2004): Masochist. Mit Alexander von Humboldt haben wir einen neuen Heros. In: Süddeutsche Zeitung. München, 05.10.2004, zit. n. Holl 2012, 48.
28 Faak, Margot (2000): Alexander von Humboldt: Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetagebüchern. Akademie Verlag, Berlin, S. 324f, zit. n. Holl 2012, 52.
29 Kehlmann, Daniel (2005): Wo ist Carlos Montufar? In: Kehlmann, Daniel: Wo ist Carlos Montufar? Über Bücher. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 3. Auflage, S. 15.
30 Vgl. Biermann, Kurt-R. (1990): Alexander von Humboldt. Teubner, Leipzig, 4. Auflage, S. 90, n. Holl 2012, 54.
31 Bericht von Caroline Bauer (1827), Berlin. In: May, Claire (1949): Rahel Varnhagen, geb. Levin. Ein Frauenleben im 19. Jahrhundert. Das Neue Berlin, Berlin. 6. Auflage, zit. n. Holl 2012, 54
32 Humboldt, Alexander von; Ette, Ottmar (1999): Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 5. Auflage, S. 859f.
33 Humboldt, Alexander von; Schwarz, Ingo (Hrsg.) (2004): Alexander von Humboldt und die Vereinigten Staaten von Amerika. Briefwechsel. Akademie Verlag, Berlin, zit. n. Wulf 2016, 22.
34 Humboldt, Alexander von; Beck, Hanno (Hrsg.) (1959): Gespräche Alexander von Humboldts. Akademie-Verlag, Berlin, zit. n. Ette, Ottmar (2002): „. daß einem leid tut, wie er aufgehört hat, deutsch zu sein.“ Alexander von Humboldt,Preußen und Amerika. In: Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt Studien. 2002, III, 4, S. 103.
35 Kehlmann, Daniel (2005): Die Größe und Komik des Deutschseins. Interview mit Kirsten Schmidt. In: Hamburger Morgenpost. Hamburg, 29.09.2005, zit. n. Ette 2012, 35.
36 Humboldt, Alexander von (1825): Humboldt an Jean-Baptiste Boussingault, Paris, 21. Februar 1825. Handschrift in der Staatsbibliothek Berlin, zit. n. Holl 2012, 56.
Häufig gestellte Fragen zu Daniel Kehlmanns "Die Vermessung der Welt"
Was ist "Die Vermessung der Welt"?
"Die Vermessung der Welt" ist ein Roman von Daniel Kehlmann, der 2005 veröffentlicht wurde. Er erzählt die Geschichten von Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß, zwei bedeutenden Wissenschaftlern, die auf unterschiedliche Weise die Welt erforschen.
Worum geht es in "Die Vermessung der Welt"?
Der Roman schildert das Leben von Humboldt, der als Naturforscher die Welt bereist, und Gauß, der als Mathematiker in Deutschland arbeitet. Obwohl sie zeitgleich leben und wirken, begegnen sie sich nur einmal. Der Roman untersucht ihre unterschiedlichen Herangehensweisen an die Wissenschaft und das Leben.
Ist "Die Vermessung der Welt" ein historischer Roman?
Die Frage der Gattungszugehörigkeit ist umstritten. Während einige den Roman als historischen Roman oder Biographie betrachten, sieht Kehlmann selbst ihn eher als Gegenwartsroman, der in der Vergangenheit spielt. Es gibt Elemente von Satire und Magischem Realismus.
Wie authentisch ist "Die Vermessung der Welt"?
Der Roman vermischt historische Fakten mit fiktiven Elementen. Kehlmann selbst räumt ein, dass er im Dienste der Wahrheit die Richtigkeit manipuliert habe. Die Charaktere und Ereignisse sind nicht immer historisch akkurat dargestellt.
Was ist Magischer Realismus und welche Rolle spielt er in dem Roman?
Magischer Realismus ist ein Erzählstil, der Irreales mit einer realistischen Romanwelt verbindet. Kehlmann lässt sich von diesem Stil beeinflussen und spielt in seinen Romanen mit der Wirklichkeit. Im Roman wird Humboldt als ein Deutscher dargestellt, der dem Magischen Realismus kritisch gegenübersteht. Der Roman stellt eine Auseinandersetzung mit der Leserschaft dar, wie diese mit diesem Stil umgeht.
Welche Rolle spielt Alexander von Humboldt in dem Roman?
Humboldt wird im Roman als Symbolfigur für das Deutsche dargestellt. Er verkörpert bestimmte Vorurteile und Eigenheiten, die Kehlmann satirisch beleuchtet. Die Darstellung Humboldts weicht dabei teilweise stark von dem historischen Humboldt ab.
Was symbolisiert Kehlmanns Humboldt?
Neben der Repräsentation des Deutschen symbolisiert Humboldt auch die Frage, wie weit Kunst in Bezug auf Wissenschaft und Historizität gehen darf. Er verkörpert die Spannung zwischen dichterischer Wahrheit und historischer Richtigkeit.
Was sind die wichtigsten Themen in "Die Vermessung der Welt"?
Zu den zentralen Themen gehören Genialität, der Kontrast zwischen Theorie und Praxis, die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, die Frage der Identität (insbesondere Deutschsein) und die Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft.
Welche anderen Romane hat Daniel Kehlmann geschrieben?
Weitere Romane von Daniel Kehlmann sind "Beerholms Vorstellung", "Mahlers Zeit" und "Ich und Kaminski". Viele Themen aus diesen Romanen finden sich auch in "Die Vermessung der Welt" wieder.
Wo finde ich weitere Informationen über Daniel Kehlmann und "Die Vermessung der Welt"?
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Artikel, Rezensionen und Interviews mit Daniel Kehlmann, die weitere Einblicke in sein Werk geben. Die Rezeption des Romans ist vielseitig und bietet unterschiedliche Interpretationsansätze.
- Quote paper
- Mai-Kristin Linder (Author), 2020, Der belletristische Alexander von Humboldt in "Die Vermessung der Welt" (Daniel Kehlmann, 2005), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/919575