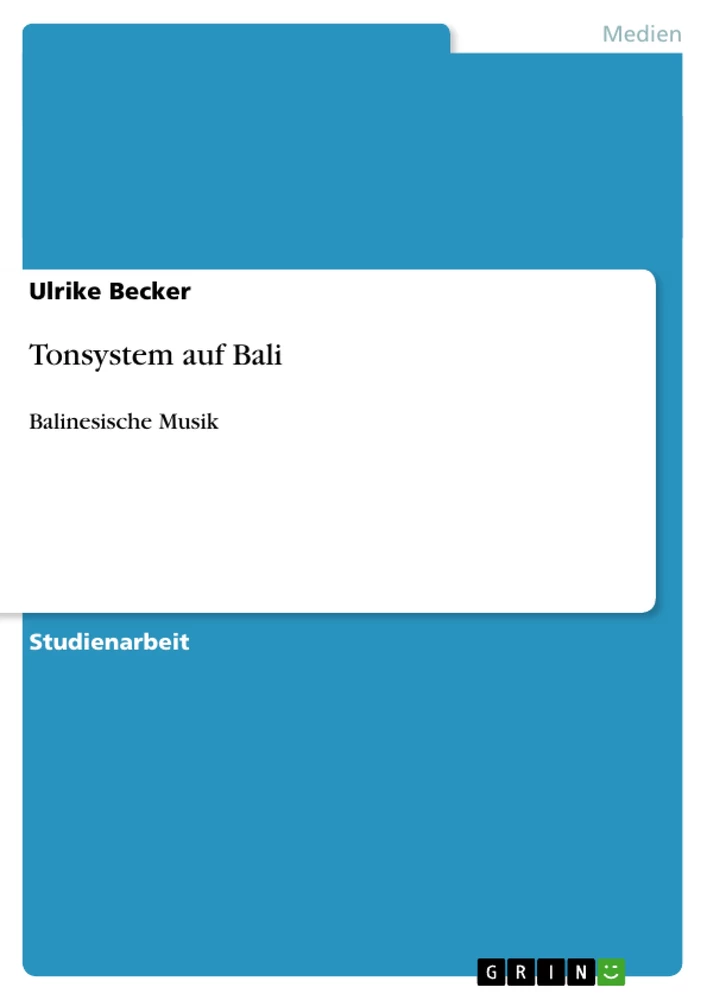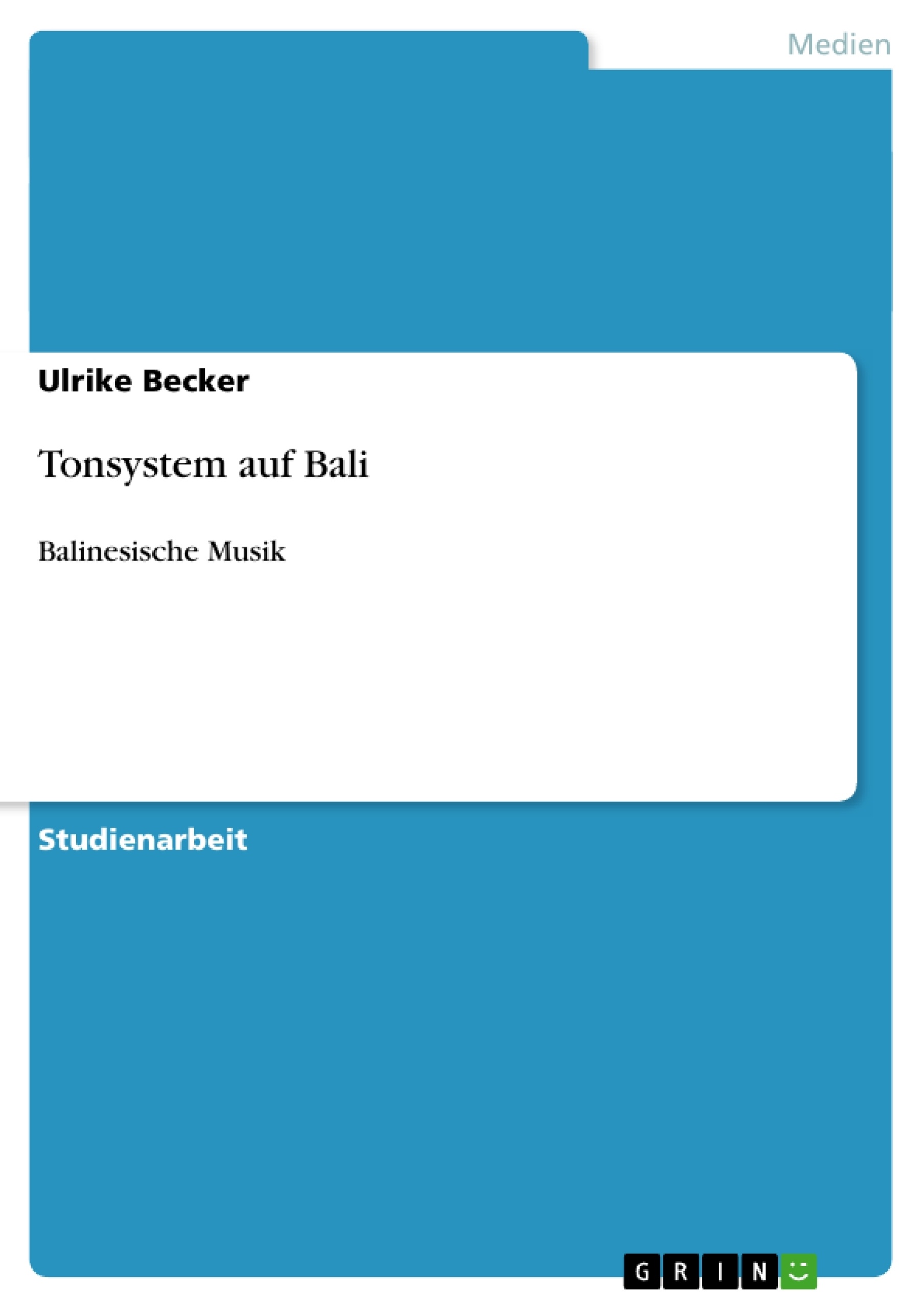Auf den Bergen wohnen die Götter, im Mehr die Dämonen. Dazwischen
versuchen die Balinesen, trotz Massentourismus, ihre Traditionen zu bewahren.
Opfergaben, Tempelfeste, Gamelanmusik, sowie der Tanz und vieles mehr
spielen eine große Rolle im Rhythmus der Gezeiten. Anders als die westliche
Musik besitzt die Musik Balis nicht den Charakter einer selbstständigen Kunst,
sondern dient in erster Linie zur Begleitung der Ritualtänze und Tanzdramen. In
der folgenden Arbeit möchte ich einen kurzen Einblick in die balinesische Musik
geben.
Zunächst stelle ich die Gamelanmusik mit ihren Instrumenten und
Ensembleformen vor, um dann etwas näher auf die Skalen und die Notation in
Bali zu kommen.
Zur Unterstützung der Vorstellung habe ich im Anhang Bilder der einzelnen
Instrumente zusammengestellt. Folgt man auf Bali den Klängen eines Gamelanorchesters, so kann man sicher
sein, auf eine Tempelzeremonie, auf eine Tanzaufführung oder auch nur eine
öffentliche Probe zu stoßen. Nirgendwo prägen sich die Klänge nachhaltiger ein
als auf Bali, wenn auch die Ursprünge dieser Musik in Java zu suchen sind.
Die Bezeichnung Gamelan leitet sich von gamel, was soviel wie Hammer heißt
und auf die Spielweise hinweist, ab. Bei dem Begriff Gamelan handelt es sich um
eine Vereinheitlichung mehrerer unterschiedlicher Zusammensetzungen von
musizierenden Gruppen. So wird beispielsweise ein nur aus wenigen Spielern
bestehendes Ensemble (Gamelan legong) ebenso als Gamelan bezeichnet wie ein
vielköpfiges Orchester (Gamelan gong).
Während in westlichen Orchestern Saiten- und Blasinstrumente dominieren, ist
ein Gamelan ein Ensemble von Schlagspielen.
Für abendländische Ohren klingen die Gamelanmelodien zunächst ungewohnt, da
Melodik, Rhythmik und Harmonik anderen Gesetzten folgen als in der westlichen
Musik.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einführung in die Gamelanmusik
- Die Instrumente
- Die Gamelanorchester
- Die Spielweise und Grundprinzipien der Gamelanmusik
- Die balinesischen Skalen
- Pelog
- Slendro
- Die balinesische Notation
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Einblick in die balinesische Musik, insbesondere die Gamelanmusik, zu geben. Der Fokus liegt auf den Instrumenten, den Ensembleformen, den Skalen und der Notation. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Musik im balinesischen Kontext und vergleicht sie mit der westlichen Musiktradition.
- Gamelaninstrumente und -ensembles
- Balinesische Tonleitern (Pelog und Slendro)
- Balinesische Notationssysteme
- Rolle der Musik in balinesischen Ritualen und Zeremonien
- Vergleich balinesischer und westlicher Musik
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort bietet eine kurze Einführung in die balinesische Kultur und die Bedeutung von Musik in diesem Kontext. Es wird die Rolle der Musik in Ritualen und Zeremonien hervorgehoben und ein kurzer Überblick über den Inhalt der Arbeit gegeben.
1. Einführung in die Gamelanmusik: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Gamelanmusik. Es beschreibt die verschiedenen Instrumente, die in einem Gamelan-Ensemble verwendet werden, von Gongs und Metallschlagspielen bis hin zu Trommeln und Melodieinstrumenten. Die Vielfalt der Ensembles, von kleinen Legong-Gruppen bis zu großen Gong-Orchestern, wird erläutert. Das Kapitel analysiert auch die Spielweise und die Grundprinzipien der Gamelanmusik, wobei die Unterschiede zur westlichen Musiktradition hervorgehoben werden. Die Beschreibung der Instrumente geht detailliert auf die Funktion jedes einzelnen Instruments im Ensemble ein und illustriert die Komplexität der Gamelanmusik. Der Bezug zu den Fußnoten unterstreicht die wissenschaftliche Fundiertheit des Textes.
2. Die balinesischen Skalen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die beiden wichtigsten balinesischen Tonleitern, Pelog und Slendro. Es werden die charakteristischen Intervalle und die Unterschiede zwischen den beiden Skalen erklärt und deren Bedeutung für die Melodik der Gamelanmusik herausgestellt. Die Beschreibung der beiden Skalen, Pelog und Slendro, beinhaltet eine tiefgreifende Analyse ihrer musikalischen Eigenschaften und ihres Einflusses auf die Komposition und Aufführung balinesischer Musik. Die Unterschiede zu westlichen Tonleitern werden deutlich gemacht.
3. Die balinesische Notation: Dieses Kapitel befasst sich mit den Methoden der Notation balinesischer Musik. Es wird dargelegt, wie die komplexen musikalischen Strukturen und rhythmischen Muster in Noten festgehalten werden, und es werden möglicherweise vorhandene Unterschiede zu westlichen Notationsformen hervorgehoben. Da der Text nicht näher darauf eingeht, muss diese Zusammenfassung auf der allgemeinen Bedeutung einer Notation für die Musikwissenschaft und die Weitergabe musikalischer Traditionen beruhen.
Schlüsselwörter
Gamelanmusik, Bali, Indonesien, Musikethnologie, Instrumente, Orchester, Pelog, Slendro, Notation, Ritualmusik, Tonleitern, Vergleich westliche Musik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einführung in die balinesische Gamelanmusik"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die balinesische Gamelanmusik. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Die Kapitel behandeln die Gamelaninstrumente und -ensembles, die balinesischen Tonleitern Pelog und Slendro, die balinesische Notation und die Rolle der Musik in balinesischen Ritualen und Zeremonien. Ein Vergleich mit der westlichen Musiktradition wird ebenfalls angesprochen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Gamelaninstrumente (Gongs, Metallschlagspiele, Trommeln, Melodieinstrumente), die verschiedenen Gamelan-Ensembleformen (z.B. Legong-Gruppen, Gong-Orchester), die balinesischen Tonleitern Pelog und Slendro, die balinesische Notation, die Rolle der Gamelanmusik in Ritualen und Zeremonien sowie ein Vergleich mit der westlichen Musiktradition.
Welche Kapitel enthält der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Vorwort (kurze Einführung in die balinesische Kultur und die Bedeutung von Musik); Einführung in die Gamelanmusik (detaillierte Beschreibung der Instrumente, Ensembles und Spielweise); Die balinesischen Skalen (Analyse der Tonleitern Pelog und Slendro); Die balinesische Notation (Methoden der Notation balinesischer Musik); Anhang und Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text verfolgt das Ziel, einen umfassenden Einblick in die balinesische Gamelanmusik zu geben und die wichtigsten Aspekte dieser Musiktradition zu erläutern. Er möchte die Instrumente, Ensembles, Tonleitern und Notationssysteme verständlich darstellen und die Rolle der Musik im balinesischen Kontext beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gamelanmusik, Bali, Indonesien, Musikethnologie, Instrumente, Orchester, Pelog, Slendro, Notation, Ritualmusik, Tonleitern, Vergleich westliche Musik.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich an alle, die sich für balinesische Musik, insbesondere Gamelanmusik, interessieren. Er ist besonders nützlich für Studierende der Ethnomusikologie, Musikwissenschaft und vergleichender Musikforschung.
Wie unterscheidet sich die balinesische Musik von der westlichen Musik?
Der Text deutet auf Unterschiede in den Tonleitern (Pelog und Slendro im Vergleich zu westlichen diatonischen Tonleitern), der Notation und der Rolle der Musik in rituellen Kontexten hin. Eine detaillierte Gegenüberstellung wird jedoch nicht explizit ausgeführt.
Welche Instrumente werden in der Gamelanmusik verwendet?
Der Text erwähnt Gongs, Metallschlagspiele, Trommeln und Melodieinstrumente. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Instrumente findet sich im Kapitel "Einführung in die Gamelanmusik".
Welche Arten von Gamelan-Ensembles gibt es?
Der Text nennt Legong-Gruppen und große Gong-Orchester als Beispiele für verschiedene Gamelan-Ensembleformen. Weitere Variationen werden wahrscheinlich im Kapitel "Einführung in die Gamelanmusik" beschrieben.
- Quote paper
- Ulrike Becker (Author), 2006, Tonsystem auf Bali, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91774