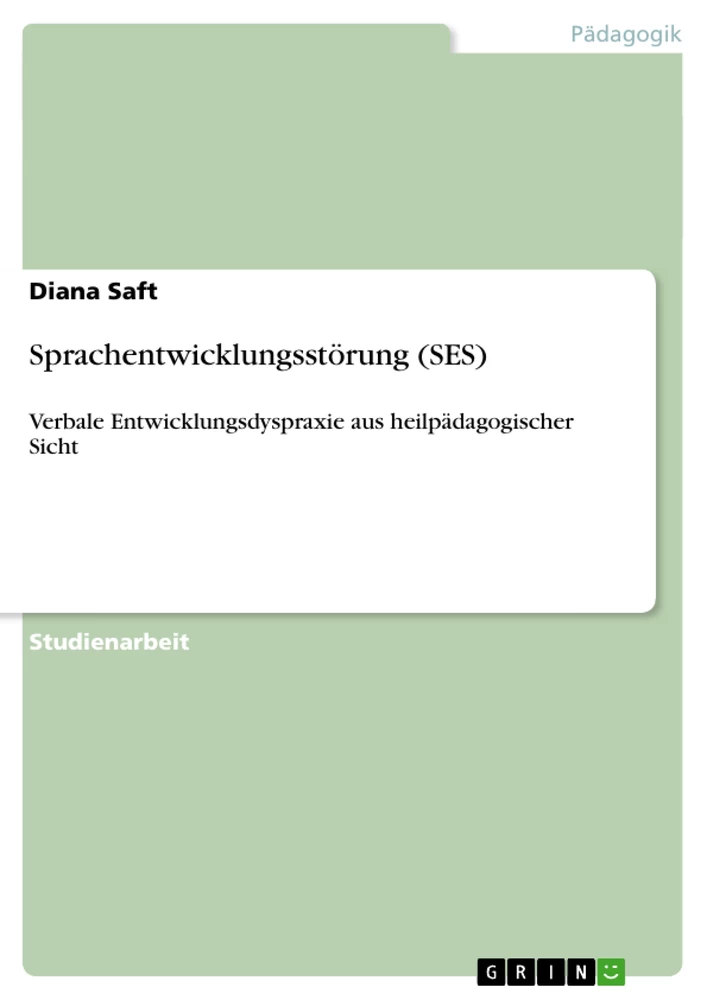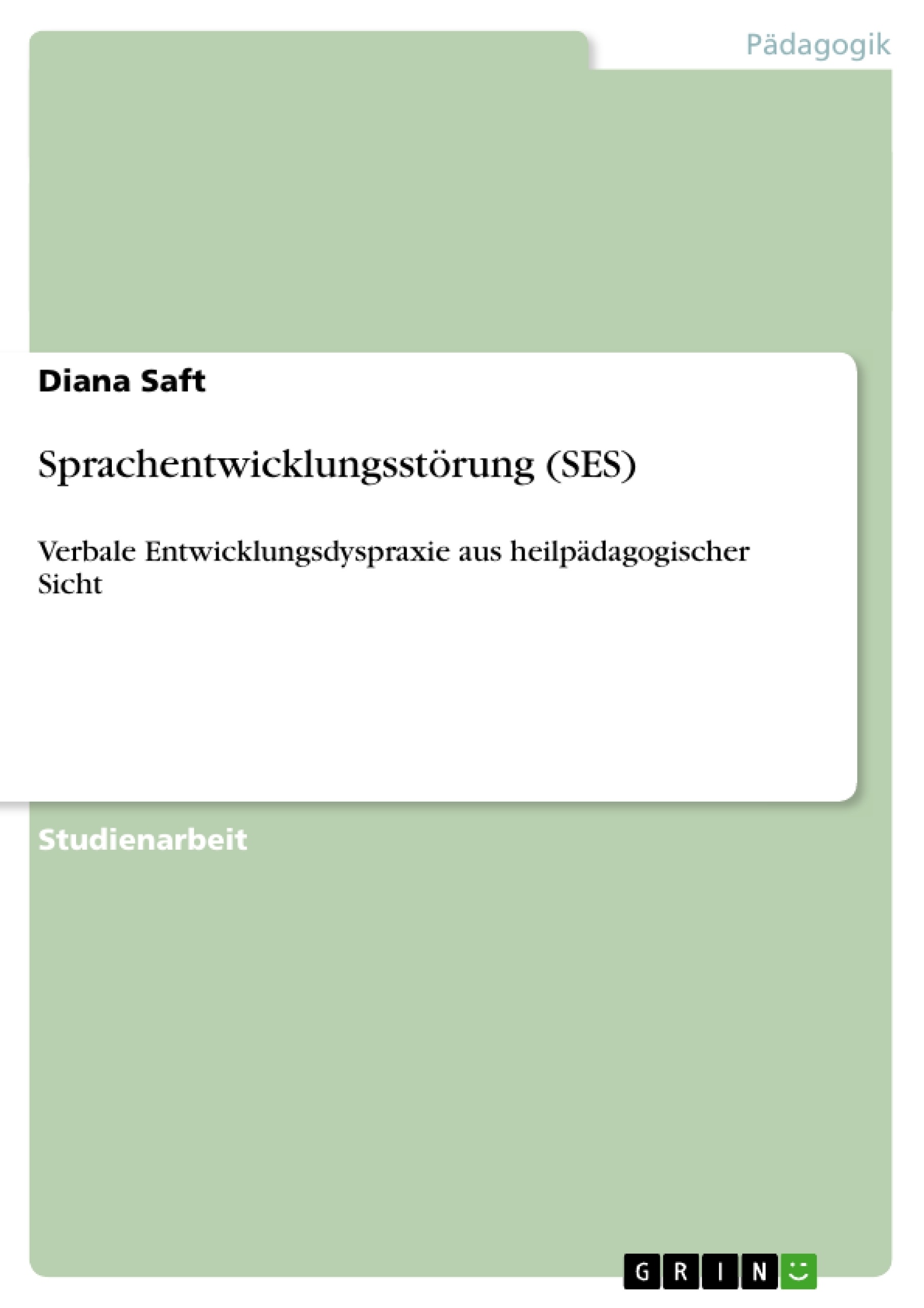Die Kommunikation des Menschen beginnt mit dem Geburtsschrei. Selbst ein Säugling ist in der Lage, Bedürfnisse und Wünsche in Form von Lauten auszudrücken. Im Laufe seiner Sprachentwicklung werden diese Laute differenzierter, bis es die menschliche Sprache selbst versteht und sich in Worten, später in Sätzen ausdrücken kann. Die wichtigsten Regeln der Sprache werden in den ersten 4 Lebensjahren erworben. In dieser Zeit entstehen die meisten Sprachentwicklungsstörungen. Gemäß der Tragweite der Sprache beschäftigt sich diese Hausarbeit mit der Thematik der Sprachentwicklungstörung.
Mein Einzelförderkind Hans (Name von mir geändert) leidet unter anderem an verbaler Entwicklungsdyspraxie. Aus diesem Grund handelt die vorliegende Arbeit hauptsächlich von dieser Störung sowie von den erforderlichen heilpädagogischen Handlungen. und vorübergehend, lang andauernd oder bleibend sein kann".
7.1.1 Folgen der verbalen Entwicklungsdyspraxie
Der Spracherwerb hat großen Einfluss sowohl für die kognitive und schulische als auch für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Aus diesem Grund stellen Störungen des Spracherwerbs ein erhebliches Risiko für die gesamte kindliche Entwicklung dar.
Die Sprechfähigkeit bei der verbalen Entwicklungsdyspraxie verbessert sich nur langsam während einer Therapie. „Bei den herkömmlichen Therapien, die bei Kindern mit Artikulationsstörungen angewandt werden, lassen sich oft keine Erfolge erziehen.“ (Aram, Nation, Child language disorders, S. 165) Bei Kindern, bei denen die Therapie sehr langsam oder gar nicht anschlägt, besteht die Gefahr, dass die Sprachstörung sich mit der Zeit zu einer Sprachbehinderung entwickelt. Diese Kinder weisen unterschiedliche Störungen in anderen Entwicklungsbereichen auf. Diese Störungen wirken sich nachteilig auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus. Die Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung umfassen Verhaltensauffälligkeiten, psychische Störungen, sozial-kommunikative Störungen und Lernstörungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Systematik und Definitionen
- 3. Formen und Häufigkeit
- 3.1 Formen
- 3.2 Häufigkeit
- 4. Ursachen
- 5. Charakteristik der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 6. Diagnostik
- 7. Folgen
- 7.1 Folgen für das betroffene Kind
- 7.1.1 Folgen der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 7.1.2 Das mangelnde Selbstwertgefühl des Kindes
- 7.1.3 Die Kognition bei Kindern mit verbaler Entwicklungsdyspraxie
- 7.2 Folgen für die Eltern
- 7.2.1 Ich bin doch nicht schuld, oder?
- 7.2.2 Verunsicherung und Ängste der Eltern
- 7.3 Folgen in der Gesellschaft
- 7.1 Folgen für das betroffene Kind
- 8. Heilpädagogisches Handeln und Konzepte
- 8.1 Einleitung
- 8.2 Heilpädagogische Ziele und Aufgaben
- 8.3 Elterngespräche und Elterneinbeziehung
- 8.4 Heilpädagogische Therapie bei verbaler Entwicklungsdyspraxie
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Sprachentwicklungsstörung, insbesondere der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Ziel ist es, diese Störung zu definieren, ihre Ursachen, Auswirkungen und mögliche heilpädagogische Handlungsansätze zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Folgen für das betroffene Kind, dessen Eltern und die Gesellschaft.
- Definition und Systematik der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- Ursachen und Häufigkeit der Störung
- Auswirkungen der verbalen Entwicklungsdyspraxie auf das Kind, die Familie und die Gesellschaft
- Heilpädagogische Interventionen und Therapieansätze
- Bedeutung der Elterneinbeziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachentwicklungsstörung ein und erläutert die Relevanz der Thematik anhand des Fallbeispiels eines Kindes mit verbaler Entwicklungsdyspraxie. Sie begründet die Fokussierung der Arbeit auf diese spezifische Störung und ihre heilpädagogischen Implikationen.
2. Systematik und Definitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von „Sprachstörung“, „Sprachbehinderung“ und „Sprachentwicklungsstörung“ basierend auf den Arbeiten von G. Knura und Siegrun von Loh. Es differenziert die Begriffe und betont die Vielfalt möglicher Ausprägungen und Auswirkungen von Sprachentwicklungsstörungen. Die Definition und Systematik der verbalen Entwicklungsdyspraxie werden im Detail dargestellt, wobei die Störung als Beeinträchtigung der willentlichen Sprechbewegungen, unabhängig von organischen Schäden, beschrieben wird.
3. Formen und Häufigkeit: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen von Sprachentwicklungsstörungen, unter denen die verbale Entwicklungsdyspraxie eine spezielle Form darstellt. Es werden charakteristische Merkmale wie verzögerter Sprachbeginn, eingeschränkter Wortschatz und fehlerhafte Lautbildung genannt. Die Häufigkeit der verbalen Entwicklungsdyspraxie in der deutschen Bevölkerung wird mit ca. 5% angegeben, mit einem höheren Auftreten bei Jungen.
4. Ursachen: Das Kapitel geht auf die bis dato ungeklärten Ursachen der verbalen Entwicklungsdyspraxie ein. Es werden verschiedene Hypothesen vorgestellt, die defekte Verbindungswege im Nervensystem, Funktionsstörungen sensorischer und motorischer Bahnen sowie ein selektives neurolinguistisches Defizit in der linken Gehirnhälfte betreffen. Die mögliche Rolle einer erblichen Komponente wird aufgrund der Häufigkeit von Kommunikations- und Lernproblemen in den Familien der betroffenen Kinder diskutiert.
5. Charakteristik der verbalen Entwicklungsdyspraxie: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den charakteristischen Merkmalen der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Die gestörte Lautbildung mit verschiedenen Fehlern wie Auslassungen, Substitutionen und Vertauschungen wird detailliert beschrieben. Es wird betont, dass die Fehlerquote mit zunehmender Wortlänge ansteigt.
8. Heilpädagogisches Handeln und Konzepte: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zielen und Aufgaben heilpädagogischer Interventionen bei Kindern mit verbaler Entwicklungsdyspraxie. Die Bedeutung von Elterngesprächen und Elterneinbeziehung wird hervorgehoben. Es werden verschiedene Therapieansätze und Strategien zur Förderung der Sprachentwicklung diskutiert.
Schlüsselwörter
Verbale Entwicklungsdyspraxie, Sprachentwicklungsstörung, Heilpädagogik, Sprachtherapie, Kommunikationsstörungen, Lautbildung, Diagnostik, Elterneinbeziehung, Fördermaßnahmen, Kindliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur verbalen Entwicklungsdyspraxie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit behandelt umfassend das Thema der verbalen Entwicklungsdyspraxie, einer Sprachentwicklungsstörung. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Definition und Systematik der Störung, eine Beschreibung der Formen und Häufigkeit, die Erörterung möglicher Ursachen, die Charakteristik der Störung, die Diagnostik, die Folgen für das Kind, die Eltern und die Gesellschaft, sowie heilpädagogische Handlungsansätze und Konzepte inklusive der Bedeutung der Elterneinbeziehung. Schlüsselwörter und eine Kapitelzusammenfassung sind ebenfalls enthalten.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die verbale Entwicklungsdyspraxie zu definieren, ihre Ursachen, Auswirkungen und mögliche heilpädagogische Interventionen zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf den Folgen für das betroffene Kind, seine Eltern und die Gesellschaft.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Fazit. Die Kapitel befassen sich mit der Systematik und Definitionen, den Formen und der Häufigkeit der Störung, den Ursachen, der Charakteristik der verbalen Entwicklungsdyspraxie, der Diagnostik, den Folgen für verschiedene Gruppen (Kind, Eltern, Gesellschaft) und schließlich mit heilpädagogischen Handlungsansätzen und Konzepten. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Was sind die Hauptthemen der Hausarbeit?
Die Hauptthemen umfassen die Definition und Systematik der verbalen Entwicklungsdyspraxie, die Ursachen und Häufigkeit der Störung, die Auswirkungen auf das Kind, die Familie und die Gesellschaft, sowie heilpädagogische Interventionen und Therapieansätze und die Bedeutung der Elterneinbeziehung.
Welche Definitionen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit liefert präzise Definitionen von „Sprachstörung“, „Sprachbehinderung“ und „Sprachentwicklungsstörung“ basierend auf den Arbeiten von G. Knura und Siegrun von Loh. Die verbale Entwicklungsdyspraxie wird als Beeinträchtigung der willentlichen Sprechbewegungen, unabhängig von organischen Schäden, definiert.
Welche Ursachen für die verbale Entwicklungsdyspraxie werden diskutiert?
Die Ursachen der verbalen Entwicklungsdyspraxie sind noch nicht vollständig geklärt. Die Hausarbeit diskutiert verschiedene Hypothesen, darunter defekte Verbindungswege im Nervensystem, Funktionsstörungen sensorischer und motorischer Bahnen, ein selektives neurolinguistisches Defizit in der linken Gehirnhälfte und eine mögliche erbliche Komponente.
Welche Folgen hat die verbale Entwicklungsdyspraxie?
Die Hausarbeit beschreibt die Folgen der verbalen Entwicklungsdyspraxie für das betroffene Kind (z.B. mangelndes Selbstwertgefühl, Beeinträchtigung der Kognition), die Eltern (z.B. Verunsicherung, Ängste) und die Gesellschaft. Die Auswirkungen auf die soziale Integration und den weiteren Entwicklungsverlauf werden thematisiert.
Welche heilpädagogischen Ansätze werden vorgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt die Ziele und Aufgaben heilpädagogischer Interventionen bei Kindern mit verbaler Entwicklungsdyspraxie. Die Bedeutung von Elterngesprächen und Elterneinbeziehung wird hervorgehoben. Verschiedene Therapieansätze und Strategien zur Förderung der Sprachentwicklung werden diskutiert.
Wie häufig ist die verbale Entwicklungsdyspraxie?
Die Häufigkeit der verbalen Entwicklungsdyspraxie in der deutschen Bevölkerung wird in der Hausarbeit mit ca. 5% angegeben, wobei Jungen häufiger betroffen sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Verbale Entwicklungsdyspraxie, Sprachentwicklungsstörung, Heilpädagogik, Sprachtherapie, Kommunikationsstörungen, Lautbildung, Diagnostik, Elterneinbeziehung, Fördermaßnahmen, Kindliche Entwicklung.
- Quote paper
- Diana Saft (Author), 2008, Sprachentwicklungsstörung (SES), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91768