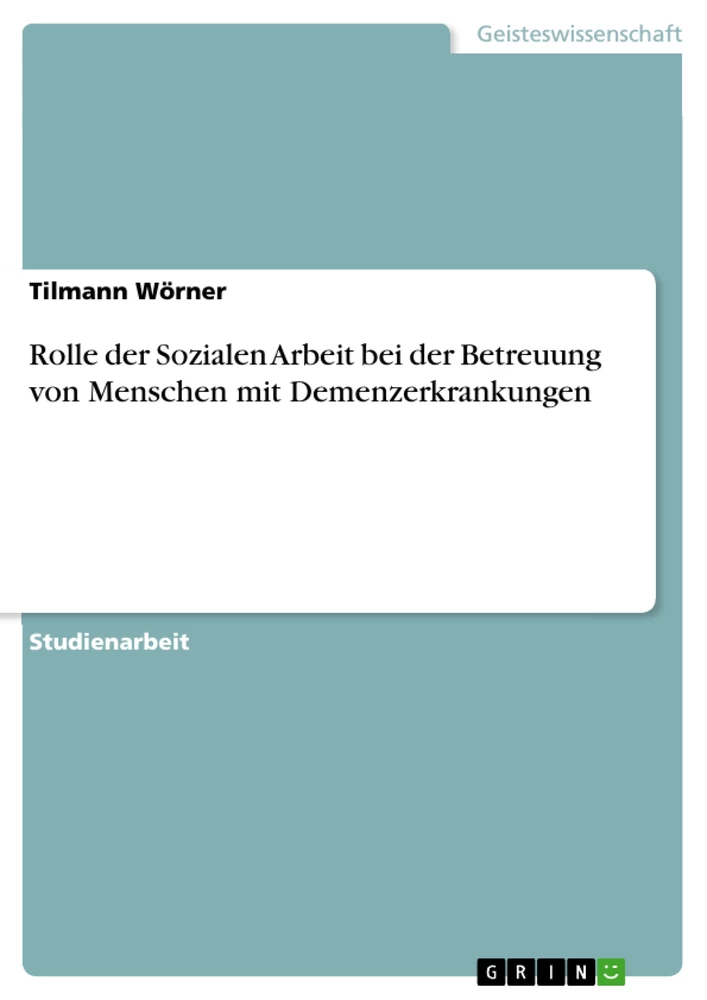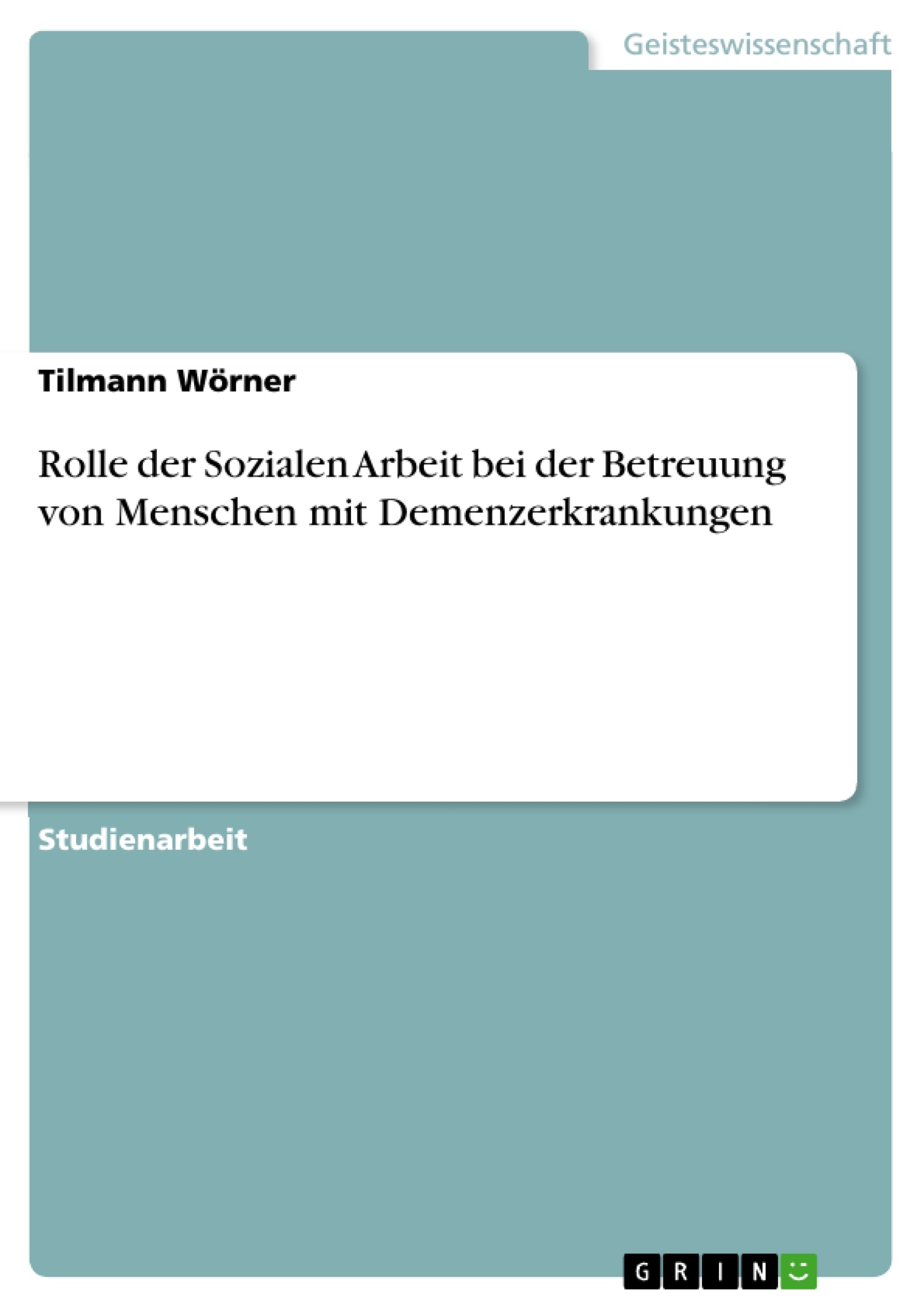In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche Möglichkeiten die Soziale Arbeit aufweist, um positiv auf die Lebenslage demenzkranker Menschen und deren Angehörigen einzuwirken. Insbesondere gilt es zu untersuchen, wie die Soziale Arbeit die Selbstbestimmung von demenzkranken Menschen bestmöglich fördern bzw. aufrechterhalten kann. Von Relevanz ist dabei, welche allgemeinen Konzepte und Instrumente der Sozialen Arbeit auf die Betreuung demenzkranker Menschen und deren Angehörigen übertragen werden können.
Der Sozialen Arbeit wird zugeschrieben, dass die Förderung von alten Menschen im Allgemeinen und von alten demenzkranken Menschen im Besonderen, bisher eher eine untergeordnete Rolle spielt. So wird bemängelt, dass es im Hinblick auf die Betreuung demenzkranker Menschen wesentlich weniger sozialarbeiterische Konzeptionen gibt als dies in anderen Tätigkeitsfeldern der Fall ist. Dies ist umso bedeutsamer, als dass es durch den demografischen Wandel bzw. durch die gesellschaftliche Alterung zu einer Zunahme an demenziellen Erkrankungen kommt. Die Anzahl an dementen Menschen erhöht sich nicht nur absolut sondern auch in Relation zur jüngeren, nichtdementen Bevölkerung (vgl. Rensch 2012). Es erscheint offensichtlich, dass die Lebenssituation von demenzkranken Menschen und deren Angehörigen durch vielfältige Herausforderungen geprägt ist, insbesondere dann, wenn die Angehörigen die demenzkranke Person zuhause betreuen. Neben der medizinisch-pflegerischen Betreuung erscheint es daher unerlässlich zu sein, dass die demenzkranken Menschen und die pflegenden Angehörigen Unterstützung erhalten, die sich auf die Bewältigung des Alltags sowie auch auf den psychosozialen Bereich bezieht. Gerade bei Demenzerkankungen, bei denen die Betroffenen sukzessive an Fähigkeiten verlieren, erscheint es in normativer Hinsicht wünschenswert, dass die Betroffenen ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung haben und einer möglichst geringen Fremdkontrolle unterliegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Demenz
- 2.1 Formen und Symptome von Demenz
- 2.1.1 Primäre demenzielle Erkrankungen
- 2.1.2 Sekundäre demenzielle Erkrankungen
- 2.1.3 Alzheimer
- 2.2 Rechtliche Regelungen zur Betreuung Demenzkranker
- 2.2.1 Geschäftsfähigkeit und Willenserklärungen
- 2.2.2 Betreuungsrechtliche Regelungen
- 2.2.3 Fahrtauglichkeit
- 2.3 Betreuungs- und Unterbringungsformen bei Demenzerkrankungen
- 2.3.1 Häusliche Versorgung
- 2.3.2 Teilstationäre und stationäre Versorgung
- 3. Selbstbestimmung
- 3.1 Definition von Selbstbestimmung
- 3.2 Selbstbestimmung im medizinisch-pflegerischen Kontext
- 3.3 Lebensqualität von demenzkranken Menschen
- 3.4 Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei Demenzerkrankungen
- 3.5 Typische Freiheits- und Selbstbestimmungseinschränkungen bei demenzkranken Menschen
- 3.6 Benötigte Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung bei demenzkranken Menschen
- 3.6.1 Materielle Ressourcen
- 3.6.2 Immaterielle Ressourcen
- 4. Rolle der Sozialen Arbeit bei Menschen mit Demenzerkrankungen
- 4.1 Theoretische Konzepte der Sozialen Arbeit mit Anwendungsmöglichkeiten bei Demenzerkrankungen
- 4.1.1 Lebensweltorientierung
- 4.1.2 Biografische Lebensbewältigung
- 4.1.3 Empowerment
- 4.1.3.1 Begriffliche Klärung und Charakteristik des Empowermentkonzepts
- 4.1.3.2 Theoretische Einordnung des Empowermentkonzepts
- 4.1.3.3 Rolle des Empowermentkonzepts im Kontext von Demenzerkrankungen
- 4.2 Akteure der Sozialen Arbeit und deren Qualifikation
- 4.2.1 Aufgabenfelder
- 4.2.2 Angehörigenberatung und -betreuung
- 4.2.2.1 Angehörige von demenzkranken Menschen als Adressaten der Sozialen Arbeit
- 4.2.2.2 Inhalte und Gesprächsführung bei der Angehörigenberatung
- 4.2.2.3 Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren der Angehörigenberatung
- 4.2.2.4 Begleitete Gesprächs- und Selbsthilfegruppen für Angehörige
- 4.2.3 Unterstützungsleistungen für demenzkranke Menschen
- 4.2.3.1 Begleitete Selbsthilfegruppen für demenzkranke Menschen in einer Frühphase der Erkrankung
- 4.2.3.2 Sozialpädagogische Betreuung von Wohngruppen
- 5. Entwurf einer ethisch wünschenswerten Betreuungsform von demenzkranken Menschen
- 5.1 Bewertungsdimensionen für die Unterbringungssituation von demenzkranken Menschen
- 5.2 Best-Practice-Beispiele im In- und Ausland
- 5.3 Verbesserungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, die Lebenslage demenzkranker Menschen und ihrer Angehörigen positiv zu beeinflussen, insbesondere die Förderung und Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung. Es werden relevante Konzepte und Instrumente der Sozialen Arbeit auf den Kontext der Demenzbetreuung übertragen und analysiert.
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Betreuung von Menschen mit Demenz
- Förderung und Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung demenzkranker Menschen
- Rechtliche und praktische Aspekte der Demenzbetreuung
- Angehörigenberatung und -betreuung
- Ethische Aspekte der Demenzbetreuung und Entwicklung wünschenswerter Betreuungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die bisher untergeordnete Rolle der Sozialen Arbeit in der Demenzbetreuung. Es hebt die zunehmende Anzahl demenzieller Erkrankungen durch den demografischen Wandel hervor und betont die Notwendigkeit sozialarbeiterischer Unterstützung für Betroffene und Angehörige, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung.
2. Demenz: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Demenz, inklusive Formen (primäre und sekundäre Demenz, Alzheimer), Symptome und rechtliche Regelungen zur Betreuung. Es beleuchtet die Geschäftsfähigkeit, Betreuungsrecht und Fahrtauglichkeit von Demenzkranken und beschreibt verschiedene Betreuungs- und Unterbringungsformen (häusliche, teilstationäre und stationäre Versorgung). Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Betreuung und der Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
3. Selbstbestimmung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Selbstbestimmung und untersucht dessen Bedeutung im medizinisch-pflegerischen Kontext für Menschen mit Demenz. Es analysiert die Lebensqualität von Betroffenen und deren Selbstbestimmungsmöglichkeiten, inklusive typischer Einschränkungen und der benötigten Ressourcen (materiell und immateriell) zur Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung.
4. Rolle der Sozialen Arbeit bei Menschen mit Demenzerkrankungen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit in der Demenzbetreuung. Es präsentiert und diskutiert theoretische Konzepte wie Lebensweltorientierung, biografische Lebensbewältigung und Empowerment und deren Anwendungsmöglichkeiten. Weiterhin werden Akteure der Sozialen Arbeit, ihre Aufgabenfelder, Angehörigenberatung und konkrete Unterstützungsmaßnahmen für Demenzkranke (z.B. Selbsthilfegruppen) betrachtet. Die Kapitel zeigt die vielschichtigen Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit Demenz auf.
5. Entwurf einer ethisch wünschenswerten Betreuungsform von demenzkranken Menschen: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung einer ethisch wünschenswerten Betreuungsform für Menschen mit Demenz. Es präsentiert Best-Practice-Beispiele aus dem In- und Ausland (z.B. das Pflegeheim De Bleerinck, St. Nikolaus Krankenhaus), analysiert den Einsatz technischer Hilfsmittel in der Pflege und beleuchtet das Freiburger Modell der Wohngruppen in geteilter Verantwortung. Auf dieser Grundlage werden Verbesserungsansätze für die Demenzbetreuung entwickelt.
Schlüsselwörter
Demenz, Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Angehörigenberatung, Empowerment, Lebensqualität, Betreuungsformen, Rechtliche Regelungen, Best-Practice, Ressourcen, Lebensweltorientierung, Biografische Lebensbewältigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: "Soziale Arbeit und Demenz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen, mit besonderem Fokus auf die Förderung und den Erhalt der Selbstbestimmung der Betroffenen und die Unterstützung ihrer Angehörigen. Die Arbeit analysiert relevante Konzepte und Instrumente der Sozialen Arbeit im Kontext der Demenzbetreuung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Demenz und der Sozialen Arbeit, darunter: verschiedene Formen und Symptome von Demenz, rechtliche Regelungen zur Betreuung Demenzkranker (Geschäftsfähigkeit, Betreuungsrecht, Fahrtauglichkeit), verschiedene Betreuungs- und Unterbringungsformen (häusliche, teilstationäre und stationäre Versorgung), der Begriff und die Bedeutung der Selbstbestimmung im Kontext von Demenz, die Lebensqualität demenzkranker Menschen, theoretische Konzepte der Sozialen Arbeit (Lebensweltorientierung, biografische Lebensbewältigung, Empowerment) und deren Anwendung auf die Demenzbetreuung, Angehörigenberatung und -betreuung, die Entwicklung ethisch wünschenswerter Betreuungsformen und Best-Practice-Beispiele.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Demenz (Formen, Symptome, rechtliche Regelungen, Betreuungsformen), Selbstbestimmung (Definition, Bedeutung, Herausforderungen, Ressourcen), Rolle der Sozialen Arbeit bei Demenzerkrankungen (theoretische Konzepte, Akteure, Aufgabenfelder, Angehörigenberatung, Unterstützungsleistungen) und Entwurf einer ethisch wünschenswerten Betreuungsform von Demenzkranken (Bewertungsdimensionen, Best-Practice-Beispiele, Verbesserungsansätze).
Welche theoretischen Konzepte der Sozialen Arbeit werden angewendet?
Die Arbeit wendet verschiedene theoretische Konzepte der Sozialen Arbeit an, darunter Lebensweltorientierung, biografische Lebensbewältigung und insbesondere Empowerment. Das Empowermentkonzept wird detailliert erläutert und seine Bedeutung im Kontext von Demenzerkrankungen analysiert.
Welche Rolle spielt die Angehörigenberatung?
Die Angehörigenberatung spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit beschreibt die Angehörigen von demenzkranken Menschen als wichtige Adressaten der Sozialen Arbeit und erläutert Inhalte und Gesprächsführung bei der Angehörigenberatung, Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren sowie die Bedeutung begleiteter Gesprächs- und Selbsthilfegruppen.
Welche Best-Practice-Beispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Best-Practice-Beispiele aus dem In- und Ausland, um ethisch wünschenswerte Betreuungsformen für Menschen mit Demenz aufzuzeigen. Konkrete Beispiele werden im fünften Kapitel genannt (z.B. das Pflegeheim De Bleerinck, St. Nikolaus Krankenhaus, das Freiburger Modell der Wohngruppen in geteilter Verantwortung).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demenz, Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Angehörigenberatung, Empowerment, Lebensqualität, Betreuungsformen, Rechtliche Regelungen, Best-Practice, Ressourcen, Lebensweltorientierung, Biografische Lebensbewältigung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter*innen, Pflegekräfte, Angehörige von Demenzkranken, Studierende der Sozialen Arbeit und alle, die sich mit der Betreuung und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz auseinandersetzen.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden Sie im vollständigen Dokument, dessen Inhaltsverzeichnis im HTML-Code oben dargestellt ist.
- Quote paper
- Diplom-Soziologe / PR-Berater (DPRG) Tilmann Wörner (Author), 2020, Rolle der Sozialen Arbeit bei der Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/917179