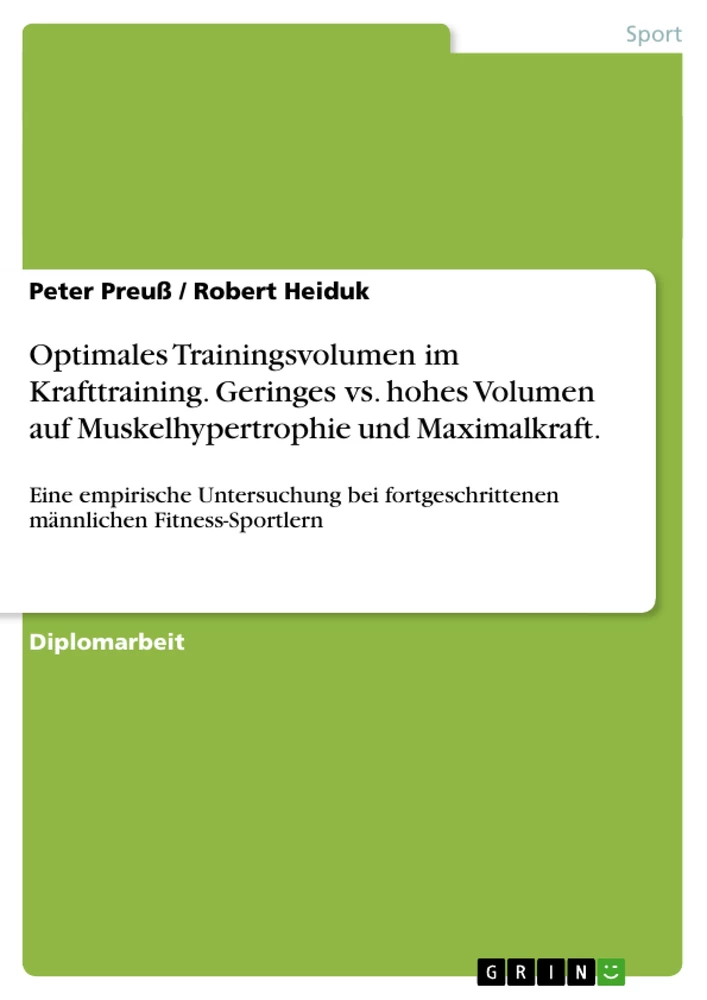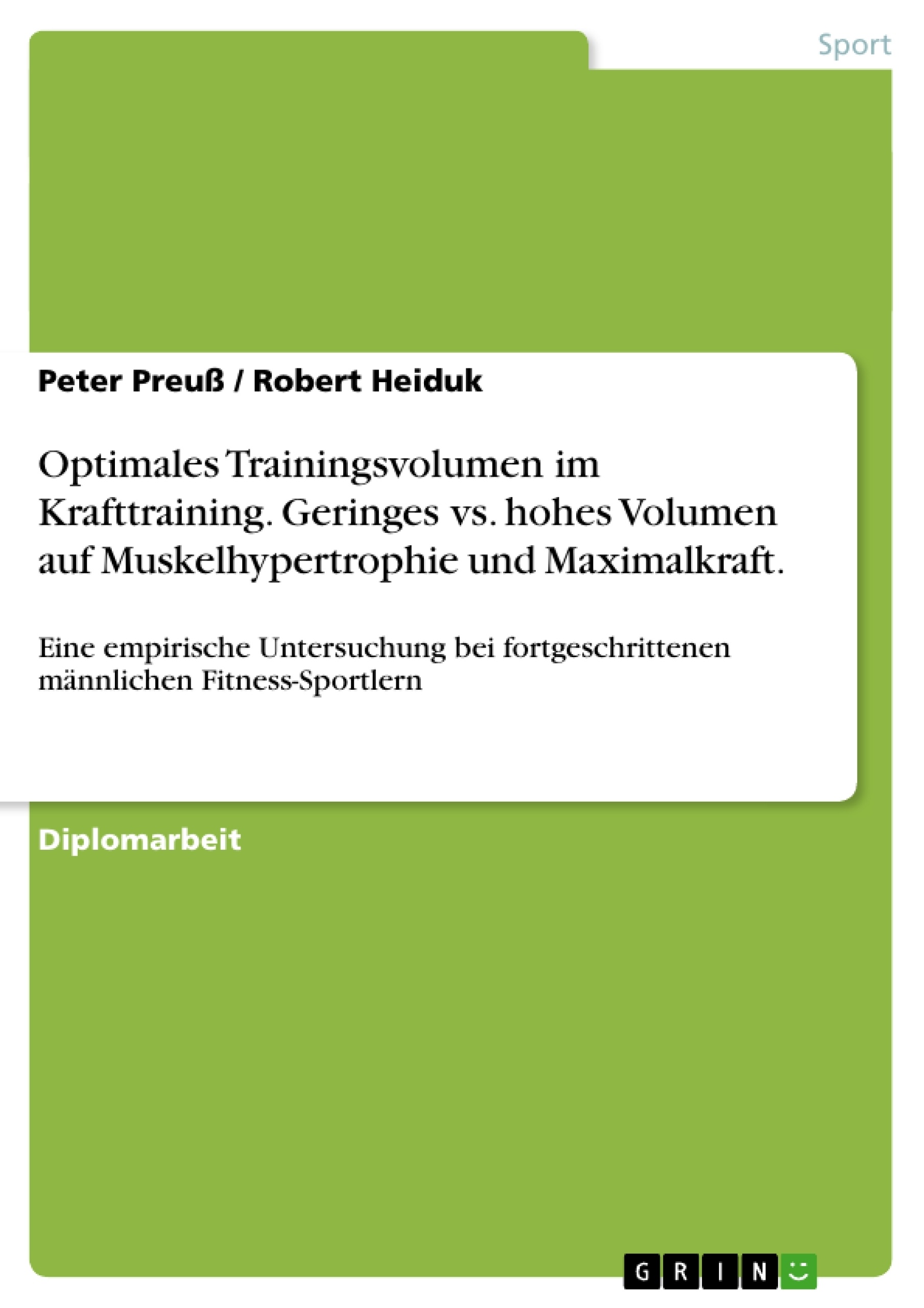Die durchgeführte empirische Untersuchung mit dem Thema „Vergleich der Auswirkungen eines Krafttrainings mit niedrigem gegenüber hohem Volumen auf die Muskelhypertrophie und Maximalkraft bei fortgeschrittenen männlichen Fitness-Sportlern“ hat ihren Ausgangspunkt in der Diskussion um das optimale Trainingsvolumen im Krafttraining (vgl. Leistungssport 3/98, 1/99, 3/99 und 4/99).
Im ersten Teil der Arbeit werden die grundlegenden Positionen der oben angesprochenen Diskussion in einem neu differenzierten Systematisierungsmodell des Begriffes ”Einsatz-Training” eingeordnet. Basierend auf diesem Systematisierungsmodell wird im zweiten Teil eine empirische Studie an sechs überdurchschnittlich trainierten männlichen Fitness-Sportlern dargestellt, die jeweils über einen Zeitraum von sieben Wochen zuerst ein Muskelaufbautraining mit niedrigem und anschließend mit hohem Volumen absolvierten.
Intention war es, einen möglichen Zusammenhang zwischen der Veränderung des Trainingsvolumens und den daraus resultierenden Veränderungen der Maximalkraft und Muskelhypertrophie sowie der Körperzusammensetzung für die einzelnen Probanden als auch die Gesamtgruppe festzustellen. Die traditionellen Krafttrainingsparameter Satzzahl, Wiederholungszahl und Last zeigten sich für den Vergleich und die Auswertung beider Trainingsformen als nicht geeignet. Als wesentlich besser erwies es sich, das Trainingsvolumen anhand einer physiologisch orientierten Anspannungszeit zu messen und zu steuern.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Körperzusammensetzung und der Maximalkraftwerte zwischen den beiden Trainingsformen. Es ist jedoch ein hoch signifikanter Zeitvorteil für das geringvolumige Training zu erkennen.
Diese Beobachtungen stellen trotz der kleinen Stichprobe bisherige Trainingsempfehlungen des sogenannten Mehrsatz-Trainings in Frage. Die Befürchtungen, ein geringvolumiges Krafttraining stelle für hochtrainierte Sportler einen zu geringen Trainingsreiz dar, kann aufgrund der im Training erfassten Daten und der Testergebnisse nicht aufrechterhalten werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung (Preuß)
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Definitionsproblematik des Begriffes "Einsatz-Training" (Preuß)
- 2.2 Die Mechanismen des Muskelwachstums aus Sicht der Physiologie (Heiduk)
- 2.2.1 Das Basiskonzept der Belastungsadaptation
- 2.2.2 Der Prozess des Muskelwachstums
- 2.2.3 Stimuli des Muskelwachstums
- 2.2.3.1 Mechanische Faktoren
- 2.2.3.2 Metabolische Stimuli
- 2.2.3.3 Hormonelle Stimuli
- 2.2.4 Zusammenfassung
- 2.3 Hypertrophiereiz aus Sicht der Trainingspraktiker (Preuß)
- 2.3.1 Hypertrophiereiz aus Sicht des HVT
- 2.3.1.1 Kriterium des Belastungsabbruchs im HVT
- 2.3.1.2 Zusammenfassung
- 2.3.2 Hypertrophiereiz aus Sicht des LVT
- 2.3.2.1 Bedeutung der Ausbelastung im LVT
- 2.3.2.2 Zusammenfassung
- 2.4 Low volume training (LVT) (Preuß)
- 2.4.1 Einteilung des LVT
- 2.4.2 Definition des LVT
- 2.4.3 Entwicklung des LVT
- 2.4.3.1 Die Nautilus-Trainingsprinzipien
- 2.4.3.2 Einsatz-Training (EST)
- 2.4.3.3 High intensity training (HIT)
- 2.4.3.4 Ausprägungsformen des HIT
- 2.4.3.5 Zusammenfassung
- 2.5 High volume training (HVT) (Preuß)
- 2.5.1 Definition des HVT
- 2.5.2 Trainingsempfehlungen des HVT
- 2.6 Diskussion des LVT und HVT (Preuß)
- 2.6.1 Kritik am HVT
- 2.6.2 Kritik am LVT
- 2.6.3 Variationsmöglichkeiten im LVT und HVT
- 2.6.4 Anwendungsmöglichkeiten des LVT im Leistungssport
- 2.6.5 Fazit
- 2.7 Untersuchungen zum LVT (Preuß)
- 2.8 Zusammenfassung (Preuß)
- 3 Methodik (Preuß)
- 3.1 Untersuchungsplan
- 3.2 Probanden
- 3.3 Hypothesenbildung
- 3.4 Testdurchführung
- 3.4.1 Eingangs- und Ausgangstests
- 3.4.2 Anthropometrische Daten
- 3.4.2.1 Körperhöhe
- 3.4.2.2 Körpergewicht und Körperfettanteil
- 3.4.3 Maximalkrafttest
- 3.4.3.1 1-RM Bankdrücken
- 3.4.3.2 3-RM Klimmzug
- 3.4.3.3 Drehmomentmaximum der Knieextensoren und -flexoren
- 3.4.3.4 Drehmomentmaximum der Rumpfextensoren und -flexoren
- 3.5 Trainingsplan und –durchführung
- 3.6 Beschreibung der Trainingsmethoden
- 3.6.1 Beschreibung des HIT
- 3.6.2 Beschreibung des HVT
- 3.7 Auswertung der Trainingsparameter
- 3.7.1 Auswertungsparameter Anspannungszeit
- 3.7.2 Auswertungsparameter Gesamtlast
- 3.8 Befragung der Probanden
- 3.9 Statistik
- 3.9.1 Deskriptive Statistik
- 3.9.2 Analytische Verfahren
- 4 Ergebnisdarstellung und Diskussion (Heiduk)
- 4.1 Einzelfallanalyse des Probanden 1
- 4.1.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.1.2 1-RM Bankdrücken
- 4.1.3 3-RM Klimmzug
- 4.1.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.1.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.2 Einzelfallanalyse des Probanden 2
- 4.2.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.2.2 1-RM Bankdrücken
- 4.2.3 3-RM Klimmzug
- 4.2.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.2.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.3 Einzelfallanalyse des Probanden 3
- 4.3.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.3.2 1-RM Bankdrücken
- 4.3.3 3-RM Klimmzug
- 4.3.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.3.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.4 Einzelfallanalyse des Probanden 4
- 4.4.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.4.2 1-RM Bankdrücken
- 4.4.3 3-RM Klimmzug
- 4.4.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.4.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.5 Einzelfallanalyse des Probanden 5
- 4.5.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.5.2 1-RM Bankdrücken
- 4.5.3 3-RM Klimmzug
- 4.5.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.5.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.6 Einzelfallanalyse des Probanden 6
- 4.6.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.6.2 1-RM Bankdrücken
- 4.6.3 3-RM Klimmzug
- 4.6.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.6.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.7 Gruppenanalyse
- 4.7.1 Dauer der Trainingseinheiten
- 4.7.2 1-RM Bankdrücken
- 4.7.3 3-RM Klimmzug
- 4.7.4 Drehmomentmaximum der Knieextension und Knieflexion
- 4.7.5 Körperzusammensetzung und sonstige Aktivitäten
- 4.7.6 Gesamtdiskussion
- 4.7.7 Hypothesenüberprüfung
- 4.8 Auswertung der Fragebögen
- 5 Schlussfolgerungen und Konsequenzen (Heiduk)
- 5.1 Empfehlungen für die Trainingssteuerung
- 5.2 Ausblick und zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Krafttrainingsvolumen (niedrig vs. hoch) auf Muskelhypertrophie und Maximalkraft bei fortgeschrittenen männlichen Fitness-Sportlern. Ziel ist es, die Effektivität beider Trainingsansätze zu vergleichen und daraus Schlussfolgerungen für die Trainingspraxis abzuleiten.
- Vergleich von Low Volume Training (LVT) und High Volume Training (HVT)
- Einfluss des Trainingsvolumens auf Muskelwachstum (Hypertrophie)
- Auswirkungen des Trainingsvolumens auf die Maximalkraft
- Analyse physiologischer Mechanismen des Muskelwachstums
- Bewertung verschiedener Trainingsmethoden im Kontext von LVT und HVT
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung (Preuß): Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit einer Untersuchung zum Vergleich von Low Volume Training (LVT) und High Volume Training (HVT) bei fortgeschrittenen Sportlern. Es werden offene Fragen hinsichtlich der optimalen Trainingsgestaltung für Muskelaufbau und Kraftsteigerung aufgeworfen und die Forschungslücke, die diese Arbeit schließen soll, herausgestellt. Die Problemstellung dient als Ausgangspunkt für die gesamte Arbeit und legt den Fokus auf den Vergleich der beiden Trainingsansätze.
2 Theoretischer Teil: Dieser Abschnitt bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung. Zunächst wird die Problematik der Definition von "Einsatz-Training" beleuchtet, um ein gemeinsames Verständnis der Trainingsintensität zu schaffen. Anschließend werden die physiologischen Mechanismen des Muskelwachstums detailliert erklärt, beginnend mit dem Basiskonzept der Belastungsadaptation und dem Prozess des Muskelwachstums selbst. Die verschiedenen Stimuli (mechanische, metabolische und hormonelle Faktoren) werden im Detail diskutiert, um die Komplexität des Muskelwachstums zu verdeutlichen. Es folgt eine eingehende Analyse des Hypertrophiereizes aus Sicht der Trainingspraktiker, sowohl für HVT als auch LVT, inklusive der Kritikpunkte beider Ansätze. Schließlich werden LVT und HVT im Detail definiert, ihre Entwicklung nachgezeichnet und verschiedene Ausprägungsformen präsentiert, um einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu liefern. Der theoretische Teil bildet die essentielle Grundlage für die Interpretation der empirischen Ergebnisse.
3 Methodik (Preuß): Das Kapitel Methodik beschreibt detailliert den Aufbau und die Durchführung der empirischen Studie. Es beinhaltet die Beschreibung des Untersuchungsplans, die Charakterisierung der Probanden, die Formulierung der Hypothesen, sowie eine genaue Darstellung der Testdurchführung, einschließlich der anthropometrischen Messungen und Krafttests. Die Beschreibung des Trainingsplans und der Trainingsmethoden (HIT und HVT) sowie der Auswertung der Trainingsparameter (Anspannungszeit und Gesamtlast) und die verwendeten statistischen Verfahren werden ebenfalls erläutert. Dieser Abschnitt gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz des Forschungsdesigns.
Schlüsselwörter
Muskelhypertrophie, Maximalkraft, Krafttraining, Low Volume Training (LVT), High Volume Training (HVT), Trainingsvolumen, Trainingsintensität, Physiologie des Muskelwachstums, Belastungsadaptation, mechanische Stimuli, metabolische Stimuli, hormonelle Stimuli, Leistungssport, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Auswirkungen unterschiedlicher Krafttrainingsvolumen auf Muskelhypertrophie und Maximalkraft
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Krafttrainingsvolumen (niedrig vs. hoch) auf Muskelhypertrophie und Maximalkraft bei fortgeschrittenen männlichen Fitness-Sportlern. Es wird ein Vergleich von Low Volume Training (LVT) und High Volume Training (HVT) durchgeführt, um die Effektivität beider Ansätze zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen für die Trainingspraxis abzuleiten.
Welche Trainingsmethoden werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Low Volume Training (LVT) und High Volume Training (HVT). Innerhalb des LVT werden verschiedene Ausprägungen wie Nautilus-Trainingsprinzipien, Einsatz-Training (EST) und High Intensity Training (HIT) berücksichtigt.
Welche physiologischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet detailliert die physiologischen Mechanismen des Muskelwachstums, einschließlich der Belastungsadaptation und der verschiedenen Stimuli (mechanische, metabolische und hormonelle Faktoren).
Welche Daten wurden erhoben?
Die Studie beinhaltet anthropometrische Messungen (Körperhöhe, Körpergewicht, Körperfettanteil), Maximalkrafttests (1-RM Bankdrücken, 3-RM Klimmzug, Drehmomentmaximum der Knie- und Rumpfextensoren und -flexoren) und die Erhebung von Trainingsparametern (Anspannungszeit, Gesamtlast). Zusätzlich wurden Fragebögen eingesetzt.
Welche Probanden nahmen an der Studie teil?
An der Studie nahmen sechs fortgeschrittene männliche Fitness-Sportler teil. Die Ergebnisse werden sowohl in Einzelfallanalysen als auch in einer Gruppenanalyse dargestellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Theoretischer Teil, 3. Methodik, 4. Ergebnisdarstellung und Diskussion, 5. Schlussfolgerungen und Konsequenzen. Der theoretische Teil beinhaltet eine ausführliche Auseinandersetzung mit LVT und HVT, ihren Definitionen, Entwicklungen und Kritikpunkten. Die Methodik beschreibt detailliert das Forschungsdesign, die Datenerhebung und die statistischen Verfahren. Die Ergebnisdarstellung präsentiert die Ergebnisse sowohl für jeden Probanden einzeln als auch in einer Gruppenanalyse. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für die Trainingspraxis gegeben.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Trainingssteuerung sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten werden im fünften Kapitel präsentiert. Die konkreten Ergebnisse hängen von den erhobenen Daten ab und werden im Kapitel "Ergebnisdarstellung und Diskussion" detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Muskelhypertrophie, Maximalkraft, Krafttraining, Low Volume Training (LVT), High Volume Training (HVT), Trainingsvolumen, Trainingsintensität, Physiologie des Muskelwachstums, Belastungsadaptation, mechanische Stimuli, metabolische Stimuli, hormonelle Stimuli, Leistungssport, empirische Untersuchung.
- Quote paper
- Peter Preuß (Author), Robert Heiduk (Author), 2001, Optimales Trainingsvolumen im Krafttraining. Geringes vs. hohes Volumen auf Muskelhypertrophie und Maximalkraft., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9167