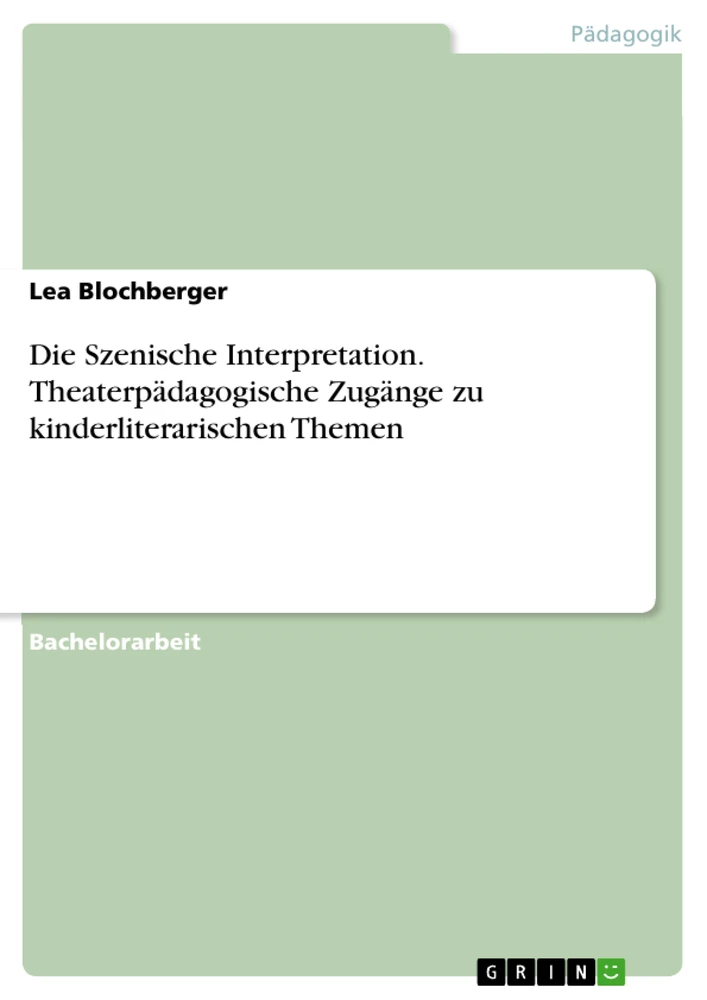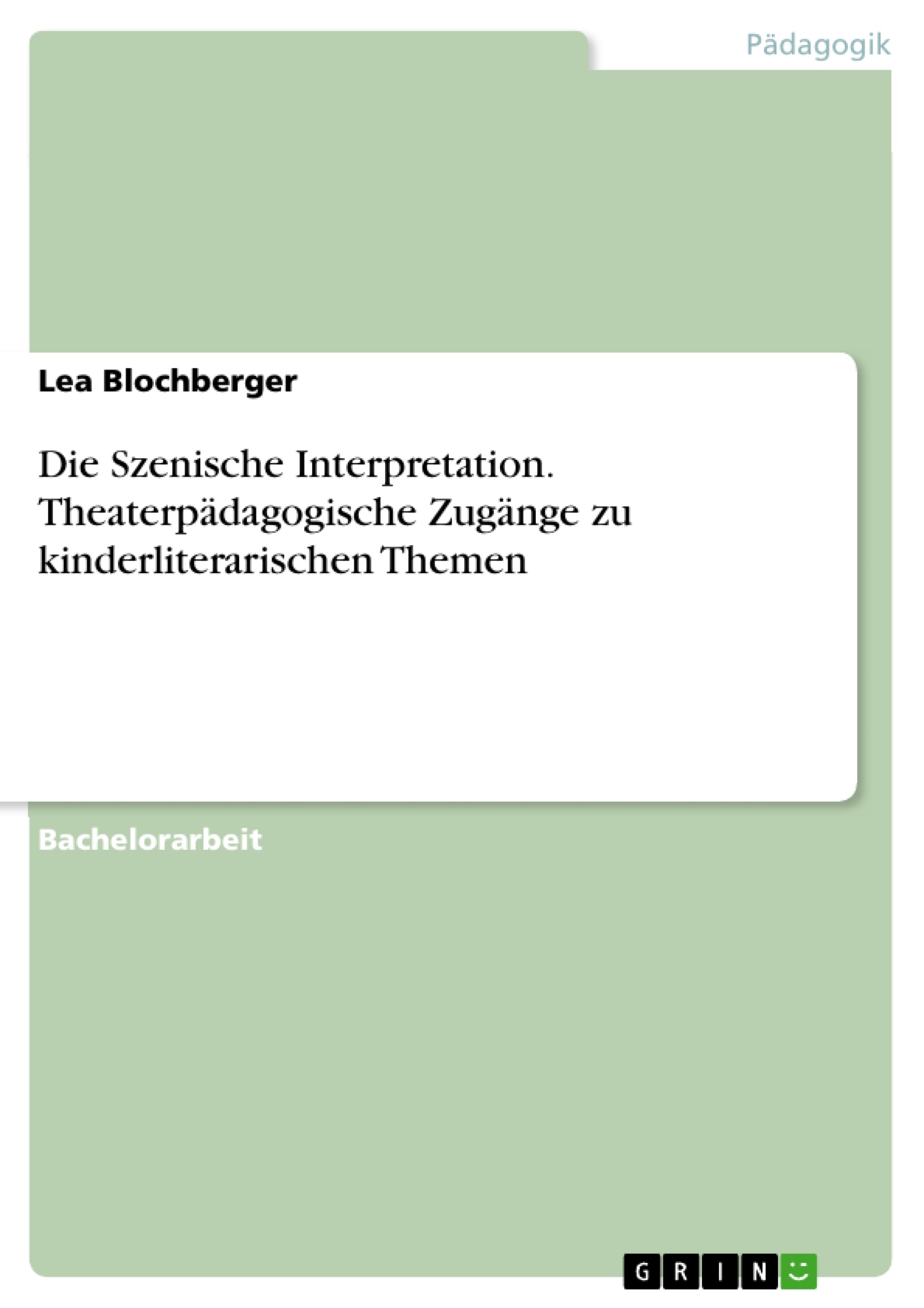Der Autor möchte zunächst das Konzept und den Ablauf der szenischen Interpretation erläutern und zwei ausgewählte Methoden, das Rollengespräch und das Standbildverfahren, darstellen. Anschließend wird darlegt, in welchem Bezug die szenische Interpretation zu dem Thüringer Lehrplan und den Bildungsstandards für das Fach Deutsch in der Grundschule steht. Dabei soll das Lernziel, welches als Orientierung für eine perspektivische Umsetzung der szenischen Interpretation in der Grundschule dienen soll, besonders hervorgehoben werden. Der Ausgangstext "Das kleine UND" von Franz Fühmann bietet zahlreiche inhaltliche und sprachliche Aspekte, die sich mit Hilfe einer szenischen Interpretation umsetzen ließen. Einen Aspekt möchte der Autor in dieser Arbeit herausgreifen und näher erklären, um diesen anschließend für die Umsetzung in der Grundschule anhand beider Methoden zu vergleichen. Dazu wird ein Skript für einen möglichen Unterrichtsablauf mit angeführt. Zuletzt werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Umsetzung beider Methoden zusammengefasst.
In der Literaturdidaktik der letzten Jahre hat ein produktionsorientierter Ansatz verstärkt an Bedeutung gewonnen. Dabei gehen Schüler nicht nur sehend und hörend oder analysierend-interpretierend mit Literatur um, sondern werden selbst gestaltend tätig. Texte werden ergänzt, umgeschrieben, malerisch gestaltet oder szenisch dargestellt. Die zu Beginn geschilderte Interpretationsweise wird dabei unter anderem ergänzt durch das Verfahren der szenischen Interpretation. Die szenische Interpretation beinhaltet verschiedene Methoden, durch die mögliche Deutungen und Auslegungen eines Textes erkundet werden. Durch einen solchen praktischen Umgang mit Literatur wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Literatur eröffnet, bei der sie auf ihre Weise und nach ihren Vorstellungen handeln dürfen, ohne negative Bewertungen befürchten zu müssen. Durch die leibliche Aneignung von Literatur, wie es bei der szenischen Interpretation der Fall ist, werde diese auch auf eine besonders intensive Weise erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Szenischen Interpretation nach Ingo Scheller
- Entstehung und Begriff der Szenischen Interpretation
- Schritte der Szenischen Interpretation
- Ausgewählte Methoden der Szenischen Interpretation
- Das Rollengespräch
- Das Standbildverfahren
- Analyse des Entwicklungsprozesses der Hauptfigur als ein Aspekt von Franz Fühmanns Geschichte „Das kleine UND“
- Die Szenische Interpretation in Bezug zu den Bildungsstandarts und zum Thüringer Lehrplan für das Fach Deutsch
- Grobziele
- Ausgewähltes Lernziel und formulierte Feinziele
- Perspektiven zur Umsetzung des gewählten Aspekts anhand beider Methoden im Vergleich
- Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen
- Räumliche Gegebenheiten
- Zeit
- Vorwissen der Schüler
- Die Verdeutlichung des Entwicklungsprozesses der Hauptfigur mit Hilfe von Rollengesprächen
- Aufgabenstellung und Skript für einen möglichen Unterrichtsablauf
- Erläuterungen zur Umsetzung
- Die Verdeutlichung des Entwicklungsprozesses der Hauptfigur mit Hilfe des Standbildverfahrens
- Aufgabenstellung und Skript für einen möglichen Unterrichtsablauf
- Erläuterungen zur Umsetzung
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Umsetzung beider Methoden
- Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Methode der Szenischen Interpretation und ihrer Anwendung im Grundschulunterricht. Ziel ist es, die Szenische Interpretation als eine Methode des produktionsorientierten Literaturunterrichts zu analysieren und ihre Umsetzung anhand zweier ausgewählter Methoden - dem Rollengespräch und dem Standbildverfahren - zu verdeutlichen. Dabei wird der Entwicklungsprozess der Hauptfigur in Franz Fühmanns Geschichte „Das kleine UND“ als Beispiel herangezogen.
- Das Konzept der Szenischen Interpretation nach Ingo Scheller
- Die Anwendung von Rollengesprächen und Standbildverfahren in der Szenischen Interpretation
- Die Analyse des Entwicklungsprozesses der Hauptfigur in „Das kleine UND“
- Die Integration der Szenischen Interpretation in den Thüringer Lehrplan und die Bildungsstandarts für Deutsch
- Der Vergleich der Umsetzung beider Methoden anhand eines konkreten Beispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine kritische Betrachtung des traditionellen Literaturunterrichts und hebt die Bedeutung eines produktionsorientierten Ansatzes hervor. Kapitel 2 stellt das Konzept der Szenischen Interpretation nach Ingo Scheller vor, beleuchtet seine Entstehung und beschreibt die grundlegenden Schritte des Verfahrens. In Kapitel 3 werden zwei ausgewählte Methoden der Szenischen Interpretation, das Rollengespräch und das Standbildverfahren, erläutert. Kapitel 4 analysiert den Entwicklungsprozess der Hauptfigur in Franz Fühmanns Geschichte „Das kleine UND“ als einen relevanten Aspekt für die Anwendung der Szenischen Interpretation.
Kapitel 5 setzt sich mit der Verbindung der Szenischen Interpretation zu den Bildungsstandarts und dem Thüringer Lehrplan für das Fach Deutsch auseinander und definiert ein relevantes Lernziel für die Umsetzung in der Grundschule. Kapitel 6 beleuchtet die praktische Umsetzung des gewählten Aspekts anhand beider Methoden im Vergleich und beinhaltet jeweils Aufgabenstellungen und Skripte für mögliche Unterrichtsabläufe. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Umsetzung beider Methoden herausgestellt.
Schlüsselwörter
Szenische Interpretation, Rollengespräch, Standbildverfahren, produktionsorientierter Literaturunterricht, Bildungsstandarts, Thüringer Lehrplan, Grundschule, „Das kleine UND“, Franz Fühmann, Entwicklungsprozess der Hauptfigur.
- Quote paper
- Lea Blochberger (Author), 2017, Die Szenische Interpretation. Theaterpädagogische Zugänge zu kinderliterarischen Themen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/916079