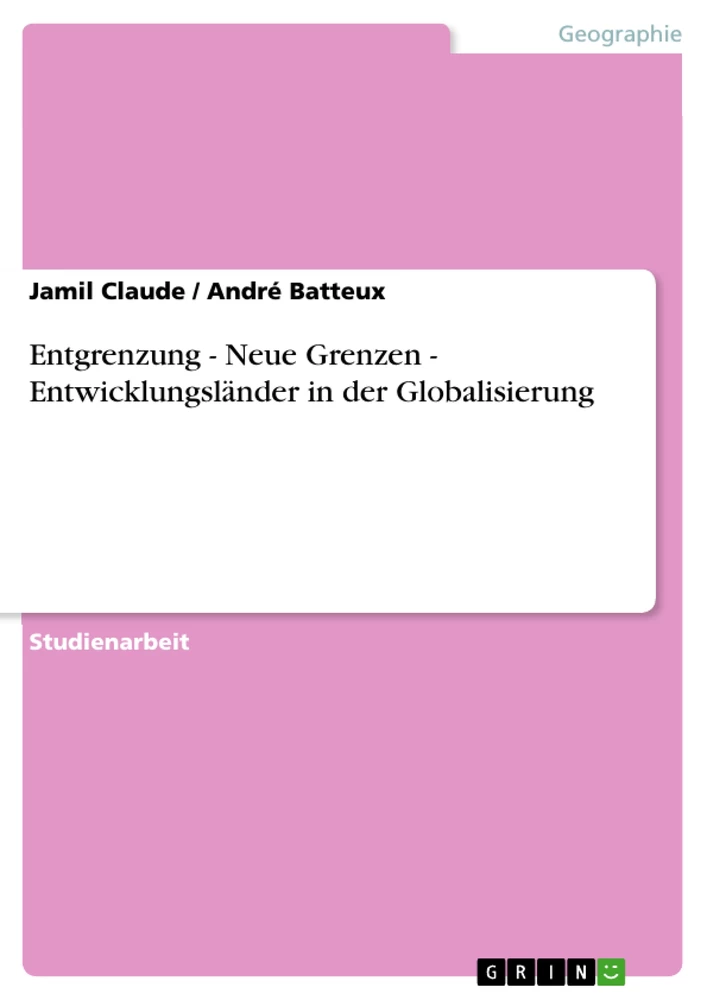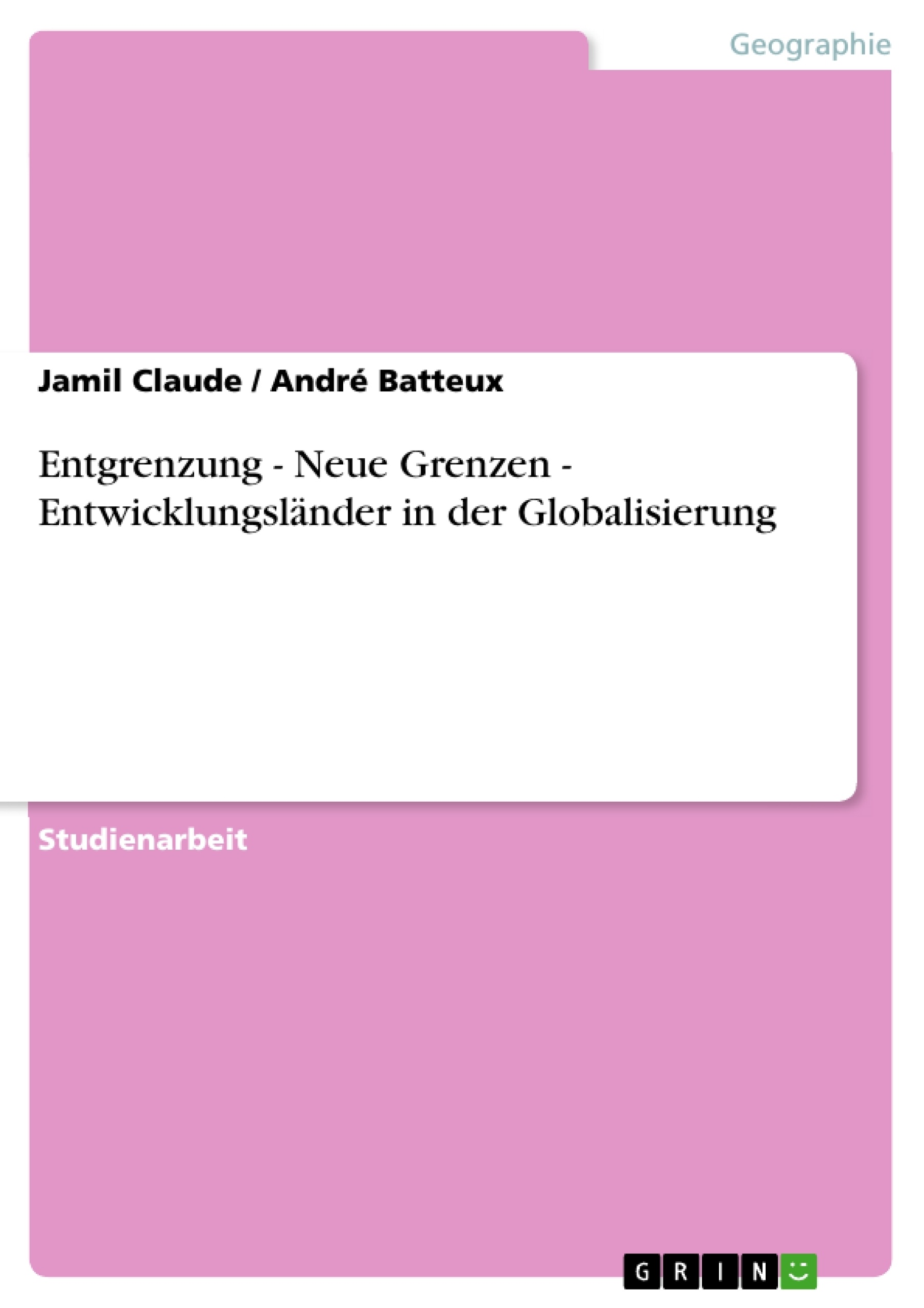Die Globalisierung ist keineswegs ein neues Phänomen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, sondern vielmehr ein bereits 500 Jahre währender Prozess, welcher mit der Entdeckung der „Neuen Welt“ durch den Seefahrer Christoph Columbus im Jahre 1492 seinen Anfang nahm und fortan mit der Erschließung neuer, bisher unbekannter oder nicht- exploitierter Gebiete sowie einer zunehmenden Ausbreitung des Kapitals (und der kapitalistischen Marktwirtschaft) einherging. „Globalisierung, gedacht als unaufhörliche räumliche und soziale Expansion, stellt somit eine historische Konstante kapitalistischer Entwicklung dar. Sie ist aber auch eine seiner Voraussetzungen.“ (Parnreiter; Novy; Fischer 1999: 11)
Neu ist allerdings, dass dieser Globalisierungsprozess ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine (...)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I. 1. Definition der Globalisierung
- I. 2. Die Ambivalenz des Globalisierungsprozesses
- II. Definition Fragmentierung
- II. 1. Die „Theorie der fragmentierenden Entwicklung“ von Fred Scholz
- II. 2. Veränderungen in der sozialen Struktur
- II. 3. Die neue Qualität sozialer Fragmentierung
- II. 4. Die Fragmentierung des Nationalstaates
- II. 5. Informationsrevolution und Digital Divide
- III. Die Verselbstständigung der Finanzmärkte
- III. 1. Welthandel / Freihandel
- IV. Die Schuldenkrise
- IV. 1. Die Strukturanpassungpolitik von IWF und Weltbank
- V. Ökologische Grenzen
- VI. Fallbeispiel 1: Chile - Gewinner der Globalisierung?!
- VII. Fallbeispiel 2: Argentinien
- VII. 1. Geographie, Bevölkerung: Allgemeine Daten
- VII. 2. Kurze Einleitung und historischer Abriss bis 1990
- VII. 3. Die Situation nach 1990
- VII. 4. Verlaufsprotokoll der Wirtschaftskrise
- VII. 5. Die Wirtschaft Argentiniens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf Entwicklungsländer, insbesondere im Kontext der zunehmenden Fragmentierung und der Entstehung neuer Grenzen. Sie analysiert den Globalisierungsprozess als dynamische Entwicklung mit sowohl entgrenzenden als auch begrenzenden Effekten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Folgen der Schuldenkrise und der Rolle internationaler Organisationen wie dem IWF und der Weltbank.
- Definition und Ambivalenz der Globalisierung
- Fragmentierung als Folge der Globalisierung
- Die Rolle der Finanzmärkte und des Welthandels
- Die Schuldenkrise und Strukturanpassungsprogramme
- Ökologische Grenzen der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und definiert den Globalisierungsprozess als einen sich seit 500 Jahren entwickelnden Prozess, der seit den 1980er Jahren eine neue Dynamik und Unübersichtlichkeit erlangt hat. Es werden vier neue Wesensmerkmale der heutigen Globalisierung identifiziert: die Deregulierung der Finanzwelt, die Informationsrevolution, die veränderte Geographie der Produktion und eine neue politische Weltordnung mit transnationalen Konzernen. Diese Entwicklungen führen sowohl zu Entgrenzungen als auch zu neuen Grenzen.
I. 1. Definition der Globalisierung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Globalisierung aus wirtschaftsgeographischer und soziologischer Perspektive, beispielsweise von Krings, Beck und der OECD. Die Definitionen betonen die zunehmende Verflechtung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, den Wettbewerb auf globalen Märkten und die irreversible Entstehung einer Globalität.
II. Definition Fragmentierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Fragmentierung als Gegenprozess zur Globalisierung. Es wird die Theorie der fragmentierenden Entwicklung von Fred Scholz vorgestellt und die Auswirkungen der Globalisierung auf soziale Strukturen, den Nationalstaat und den digitalen Graben (Digital Divide) analysiert. Die Fragmentierung wird als ein Prozess auf Mikro- und Makroebene verstanden, der soziale Ungleichheit verstärkt.
III. Die Verselbstständigung der Finanzmärkte: Dieses Kapitel befasst sich mit der zunehmenden Deregulierung der Finanzmärkte nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems und den Folgen für die Globalisierung. Es wird der Zusammenhang zwischen Freihandel, Welthandel und der Entgrenzung der Finanzströme analysiert.
IV. Die Schuldenkrise: Dieses Kapitel beschreibt die Schuldenkrise in Entwicklungsländern und die Rolle der Strukturanpassungsprogramme des IWF und der Weltbank. Es wird untersucht, wie diese Programme die Situation der betroffenen Länder beeinflussen und welche Folgen diese für deren Entwicklung haben.
V. Ökologische Grenzen: Dieses Kapitel beleuchtet die ökologischen Grenzen der Globalisierung. Es geht auf die Auswirkungen des wirtschaftlichen Wachstums und der globalisierten Produktions- und Konsummuster auf die Umwelt ein.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Fragmentierung, Entwicklungsländer, Finanzmärkte, Welthandel, Schuldenkrise, Strukturanpassung, IWF, Weltbank, Informationsrevolution, Digital Divide, soziale Ungleichheit, transnationale Konzerne, Peripherisierung, Marginalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen der Globalisierung auf Entwicklungsländer
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über die Auswirkungen der Globalisierung auf Entwicklungsländer. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar wichtiger Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der Globalisierung, der zunehmenden Fragmentierung und den Folgen der Schuldenkrise für Entwicklungsländer. Zwei Fallbeispiele (Chile und Argentinien) illustrieren die komplexen Zusammenhänge.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Definition und Ambivalenz der Globalisierung, die Fragmentierung als Gegenprozess zur Globalisierung, die Rolle der Finanzmärkte und des Welthandels, die Schuldenkrise und die Strukturanpassungsprogramme des IWF und der Weltbank, sowie die ökologischen Grenzen der Globalisierung. Der Text analysiert die Auswirkungen dieser Prozesse auf soziale Strukturen, den Nationalstaat und die Entstehung neuer sozialer Ungleichheiten.
Was versteht der Text unter Globalisierung und Fragmentierung?
Globalisierung wird als ein dynamischer Prozess mit zunehmender Verflechtung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, Wettbewerb auf globalen Märkten und der Entstehung einer Globalität definiert. Fragmentierung wird als Gegenprozess zur Globalisierung verstanden, der durch die Globalisierung selbst verstärkt wird und zu neuen Grenzen und sozialer Ungleichheit führt. Die Theorie der fragmentierenden Entwicklung von Fred Scholz spielt dabei eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielen der IWF und die Weltbank?
Der Text untersucht die Rolle des IWF und der Weltbank im Kontext der Schuldenkrise in Entwicklungsländern. Ein Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen der Strukturanpassungsprogramme dieser Organisationen auf die betroffenen Länder und deren Entwicklung.
Welche Fallbeispiele werden behandelt?
Der Text analysiert die Auswirkungen der Globalisierung anhand von zwei Fallbeispielen: Chile als vermeintlicher Gewinner der Globalisierung und Argentinien als Beispiel für die negativen Folgen der Globalisierung, insbesondere im Kontext der Schuldenkrise.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Globalisierung, Fragmentierung, Entwicklungsländer, Finanzmärkte, Welthandel, Schuldenkrise, Strukturanpassung, IWF, Weltbank, Informationsrevolution, Digital Divide, soziale Ungleichheit, transnationale Konzerne, Peripherisierung und Marginalisierung.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in verschiedene Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einer Definition der Globalisierung. Es folgen Kapitel zur Fragmentierung, den Finanzmärkten, der Schuldenkrise, den ökologischen Grenzen und schließlich die Fallbeispiele Chile und Argentinien. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
- Quote paper
- Jamil Claude (Author), André Batteux (Author), 2003, Entgrenzung - Neue Grenzen - Entwicklungsländer in der Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91603