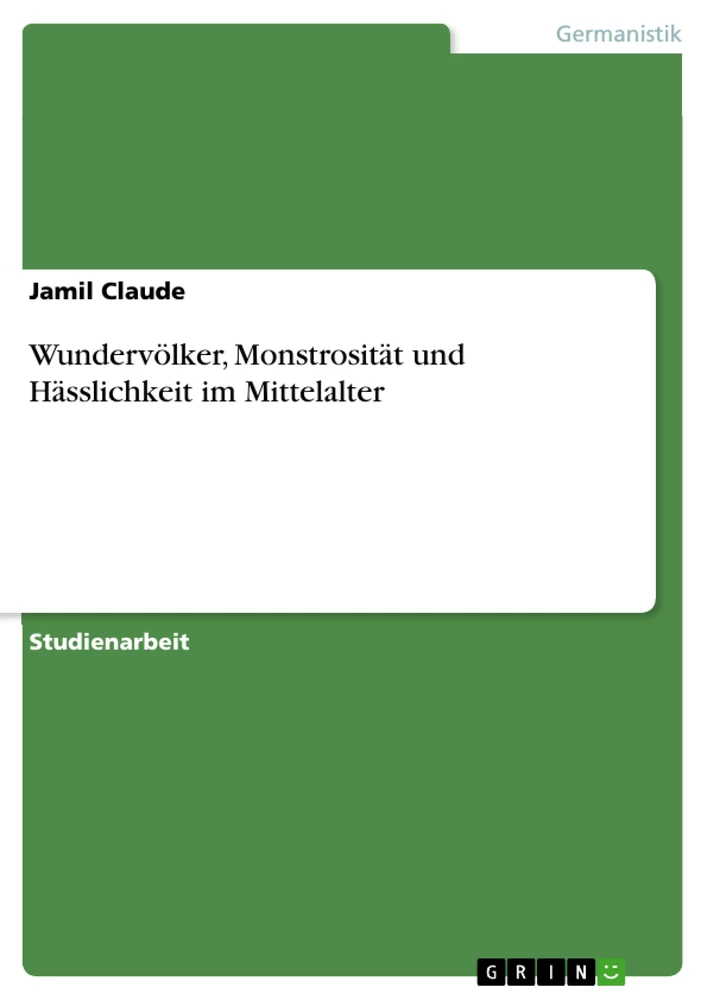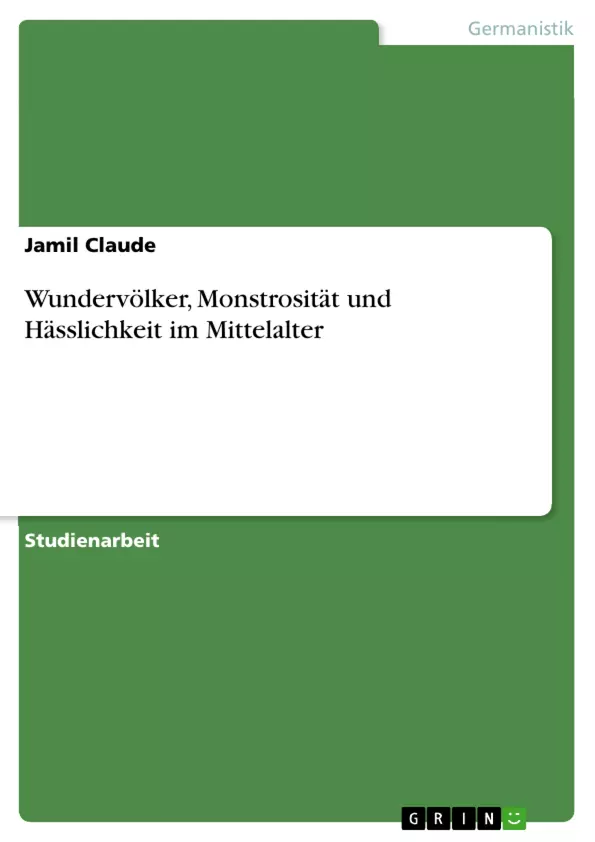Meine Arbeit im Rahmen des mediävistischen Hauptseminars „Unhöfische Menschen: Randständige, Außenseiter und Exoten in der mittelhochdeutschen Literatur“ beschäftigt sich mit der Thematik der Wundervölker, der Monstrosität und Hässlichkeit im Mittelalter. Das spezifische Moment der mittelalterlichen ‚monstra’ und ‚homines monstruosi’ sowie das ihnen eigene Ausgrenzungscharakteristikum gegenüber anderen unhöfischen Menschen, wie sie etwa Behinderte, Bettler, Ausgestossene und Ausgegrenzte repräsentieren, besteht in ihrer Zugehörigkeit zu den beiden, sowohl der höfischen, als auch der ausserhöfischen und damit wilden und naturhaften Sphäre, zugleich. Laut Giloy-Hirtz sind die Ungeheuer „(…) wesentlicher Bestandteil der poetischen Welt, wie sie der Artusroman konstituiert." (...)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Mittelalterliche Vorstellungswelten
- III. Hässlichkeit
- III. 1. Die Technik der Hässlichkeitsbeschreibungen
- III. 2. Menschliche Hässlichkeit
- III. 2. 1. Funktionalisierung der Exotenhässlichkeit
- III. 2. 2. Zwerg und Schrat
- III. 2. 2. 1. Die Zwerge in der mittelhochdeutschen Literatur
- III. 2. 3. Die Riesen
- III. 2. 3. 1. Die Funktion der Riesen
- III. 3. Tierisch-menschliche Hässlichkeitsbeschreibungen
- III. 3. 1. Die Tierattribute
- III. 4. Attributekatalog der Hässlichkeitsbeschreibungen
- IV. Theoretische Überlegungen zur Funktion des Hässlichen
- IV. 1. Einleitung
- IV. 2. Hässlichkeit als Gegenpol des Schönen
- IV. 3. Hässlichkeit als stilistisches Moment zur Schönheitssteigerung durch Kontrastwirkung
- IV. 4. Hässlichkeit im theologisch-religiösen Kontext
- IV. 4. 1. Hässlichkeit als Merkmal der Teufelsverwandtschaft
- IV. 4. 2. Hässlichkeit als äußeres Symbol innerlicher Unvollkommenheit und der Sünde
- V. Ungeheuer, Monster und Wundervölker
- V. 1. Ungeheuer
- V. 2. Monster
- V. 3. Der Ursprung der Ungeheuer, Monster und Wundervölker
- V. 4. Mittelalterliche Normvorstellungen als Konstitutionsbedingung der Ungeheuer, Monster und Wundervölker
- V. 5. Die Monster und Ungeheuer innerhalb des göttlichen Heilsplans
- V. 6. Die Monster und Ungeheuer als ritterliche Bewährungsprobe des arthurischen Helden und Konstitutionsbedingung der ritterlich-höfischen Gesellschaft
- VI. Literaturbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Wundervölkern, Monstrosität und Hässlichkeit in der mittelhochdeutschen Literatur. Ziel ist es, die Funktion und Bedeutung dieser Figuren im Kontext der mittelalterlichen Vorstellungswelt zu analysieren.
- Die Darstellung von Hässlichkeit und ihre Techniken in der mittelhochdeutschen Literatur
- Die Rolle von Ungeheuern, Monstern und Wundervölkern in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Die Funktion dieser Figuren als Gegenpol zum Schönen und zur höfischen Ordnung
- Die theologische und gesellschaftliche Bedeutung von Hässlichkeit und Monstrosität
- Die Beziehung zwischen diesen Figuren und dem ritterlichen Helden im arthurischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, welches die Darstellung von Wundervölkern, Monstrosität und Hässlichkeit in der mittelhochdeutschen Literatur behandelt. Es wird die besondere Position dieser Figuren im Verhältnis zu anderen "unhöfischen Menschen" wie Behinderten oder Ausgestoßenen thematisiert und ihre Zugehörigkeit sowohl zur höfischen als auch zur ausserhöfischen Sphäre herausgestellt. Die Arbeit diskutiert die Ambivalenz dieser Figuren, die nicht nur böse oder bedrohlich sind, sondern auch im höfischen Kontext eine Rolle spielen können, wie beispielsweise der Hofnarr. Die Einleitung kündigt die Untersuchung der poetologischen Funktion und der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Figuren an.
II. Mittelalterliche Vorstellungswelten: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die Weltanschauung des Mittelalters, die für das Verständnis der dargestellten Figuren unerlässlich ist. Es beschreibt die Denkweise der mittelalterlichen Menschen und ihre Wahrnehmung von der Welt, inklusive der fantastischen Elemente, die in ihrer Realität verankert waren. Die Kapitel betont die Notwendigkeit, die mittelalterliche Perspektive zu berücksichtigen, um die literarischen Darstellungen von Wundervölkern und Monstren richtig interpretieren zu können. Die heutige Sichtweise unterscheidet sich grundlegend von jener des Mittelalters, so dass ein Verständnis der damaligen Vorstellungswelt unumgänglich ist.
III. Hässlichkeit: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Darstellung von Hässlichkeit in mittelhochdeutscher Literatur. Es untersucht verschiedene Techniken der Hässlichkeitsbeschreibung und befasst sich mit konkreten Beispielen wie Zwergen, Riesen und Wesen mit tierischen Attributen. Es wird untersucht, wie diese Darstellungen funktionieren und welche Rolle sie im Gesamtkontext des Werkes spielen. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Funktionen der Hässlichkeit, sowohl als Kontrast zum Schönen als auch im theologisch-religiösen Kontext als Symbol für innerliche Unvollkommenheit und Sünde.
IV. Theoretische Überlegungen zur Funktion des Hässlichen: Hier werden theoretische Ansätze zur Interpretation der Funktion des Hässlichen in der mittelalterlichen Literatur diskutiert. Der Fokus liegt auf der Analyse von Hässlichkeit als Gegenpol zum Schönen, als stilistisches Mittel zur Steigerung der Schönheit durch Kontrast und im theologisch-religiösen Kontext als Merkmal der Teufelsverwandtschaft oder innerer Unvollkommenheit. Das Kapitel vergleicht und kontrastiert verschiedene theoretische Perspektiven und liefert eine fundierte Analyse der verschiedenen Funktionen, die Hässlichkeit in der untersuchten Literatur einnimmt.
V. Ungeheuer, Monster und Wundervölker: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Ungeheuer, Monster und Wundervölker, untersucht ihren Ursprung und ihre Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Normvorstellungen. Es analysiert ihre Funktion als negative Projektionsfolie des christlich-katholischen und höfisch-arthurischen Gesellschaftsentwurfs, sowie ihre Rolle als Bewährungsprobe für den ritterlichen Helden. Die Kapitel erörtert die komplexe Beziehung zwischen diesen Figuren und dem göttlichen Heilsplan und ihren Platz innerhalb der mittelalterlichen Weltanschauung. Es wird auch der Aspekt betrachtet, dass manche dieser Wesen, wie Zwerge, durchaus im höfischen Kontext integriert sind.
VI. Literaturbeispiele: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele aus der mittelhochdeutschen Literatur zur Illustration der vorherigen Kapitel. Die ausgewählten Texte dienen dazu, die theoretischen Überlegungen mit konkreten literarischen Darstellungen zu veranschaulichen und zu belegen. Die Analyse dieser Beispiele liefert detaillierte Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Darstellung von Wundervölkern, Monstrosität und Hässlichkeit in der mittelalterlichen Literatur. Sie veranschaulicht die Zusammenhänge und Verbindungen der unterschiedlichen Aspekte, die in den vorherigen Kapiteln diskutiert wurden.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsche Literatur, Wundervölker, Monstrosität, Hässlichkeit, Außenseiter, Exoten, Mittelalter, höfische Gesellschaft, theologischer Kontext, ritterlicher Held, Arthurische Literatur, poetologische Funktion, Gegenpol des Schönen, negative Projektion.
Hässlichkeit, Monstrosität und Wundervölker in der mittelhochdeutschen Literatur: FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Wundervölkern, Monstrosität und Hässlichkeit in der mittelhochdeutschen Literatur und analysiert deren Funktion und Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Vorstellungswelt. Sie beleuchtet die Ambivalenz dieser Figuren, die sowohl böse oder bedrohlich als auch im höfischen Kontext integriert sein können (z.B. der Hofnarr).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Hässlichkeit und deren Techniken, die Rolle von Ungeheuern, Monstern und Wundervölkern in der mittelalterlichen Gesellschaft, deren Funktion als Gegenpol zum Schönen und zur höfischen Ordnung, die theologische und gesellschaftliche Bedeutung von Hässlichkeit und Monstrosität sowie die Beziehung zwischen diesen Figuren und dem ritterlichen Helden im arthurischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Mittelalterliche Vorstellungswelten, Hässlichkeit (inkl. detaillierter Analyse von Darstellungsformen und konkreten Beispielen wie Zwergen und Riesen), Theoretische Überlegungen zur Funktion des Hässlichen, Ungeheuer, Monster und Wundervölker (inkl. Ursprung, Bedeutung und Rolle im Kontext der mittelalterlichen Normvorstellungen und des göttlichen Heilsplans) und Literaturbeispiele zur Illustration der vorherigen Kapitel.
Wie werden Hässlichkeitsbeschreibungen analysiert?
Die Analyse der Hässlichkeitsbeschreibungen umfasst die Untersuchung verschiedener Techniken, die Verwendung von Tierattributen und die Rolle der Hässlichkeit als Kontrast zum Schönen sowie im theologisch-religiösen Kontext als Symbol für innerliche Unvollkommenheit und Sünde. Es wird ein „Attributekatalog der Hässlichkeitsbeschreibungen“ erstellt.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit diskutiert theoretische Ansätze zur Interpretation der Funktion des Hässlichen, insbesondere als Gegenpol zum Schönen, als stilistisches Mittel zur Schönheitssteigerung durch Kontrast und im theologisch-religiösen Kontext als Merkmal der Teufelsverwandtschaft oder innerlicher Unvollkommenheit. Verschiedene theoretische Perspektiven werden verglichen und kontrastiert.
Welche Rolle spielen Ungeheuer, Monster und Wundervölker?
Ungeheuer, Monster und Wundervölker werden als negative Projektionsfolie des christlich-katholischen und höfisch-arthurischen Gesellschaftsentwurfs analysiert, sowie in ihrer Rolle als Bewährungsprobe für den ritterlichen Helden. Ihre komplexe Beziehung zum göttlichen Heilsplan und ihre Integration in die mittelalterliche Weltanschauung werden ebenfalls erörtert. Die Arbeit betrachtet auch die Integration mancher Wesen (z.B. Zwerge) in den höfischen Kontext.
Welche Literaturbeispiele werden verwendet?
Das Kapitel „Literaturbeispiele“ präsentiert konkrete Beispiele aus der mittelhochdeutschen Literatur, um die theoretischen Überlegungen zu veranschaulichen und zu belegen. Diese Beispiele veranschaulichen die Zusammenhänge und Verbindungen der unterschiedlichen Aspekte, die in den vorherigen Kapiteln diskutiert wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelhochdeutsche Literatur, Wundervölker, Monstrosität, Hässlichkeit, Außenseiter, Exoten, Mittelalter, höfische Gesellschaft, theologischer Kontext, ritterlicher Held, Arthurische Literatur, poetologische Funktion, Gegenpol des Schönen, negative Projektion.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen sind im vollständigen Text der Arbeit enthalten (hier nur eine Zusammenfassung).
- Quote paper
- Jamil Claude (Author), 2003, Wundervölker, Monstrosität und Hässlichkeit im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91594