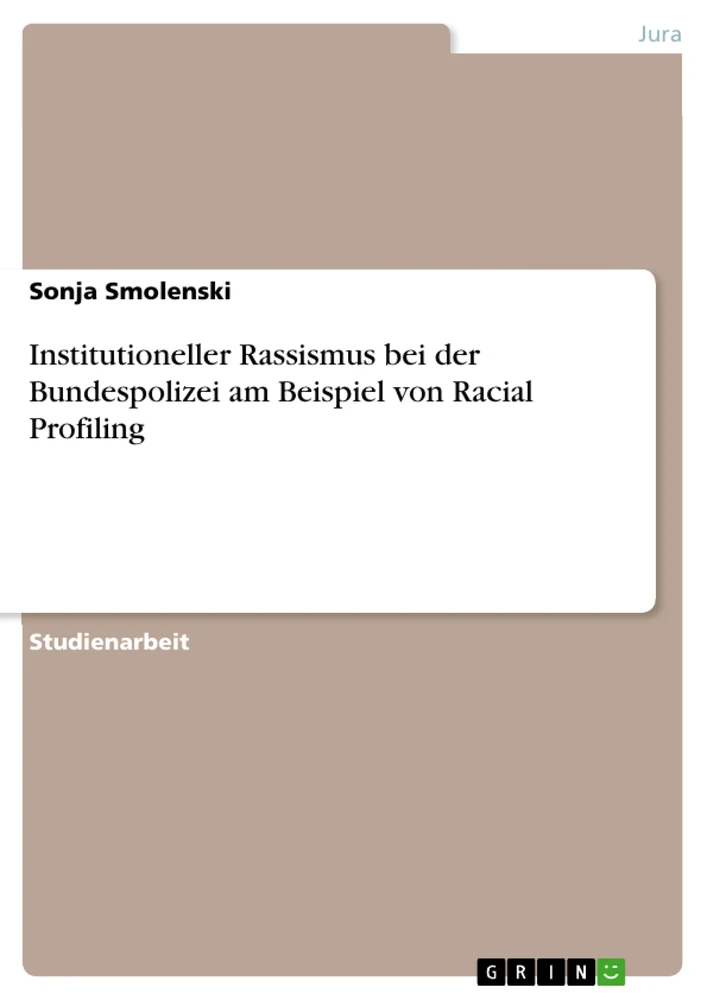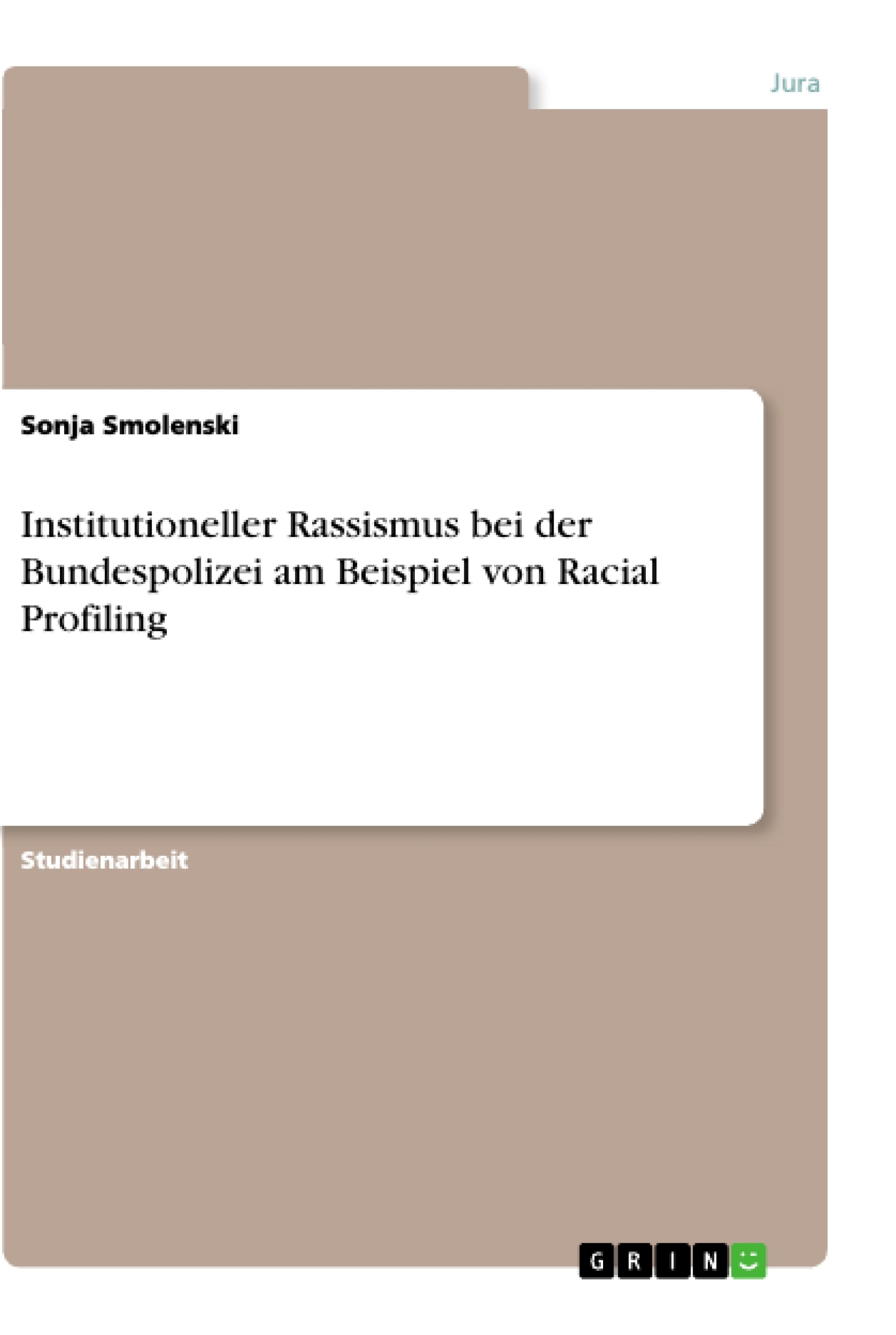Die Arbeit beschäftigt sich mit institutionellem Rassismus innerhalb der Bundespolizei am Beispiel des Racial Profiling und stellt sich der Frage, inwiefern diese Verwendung in der Polizei findet und welche Konsequenzen es für unseren Rechtsstaat und betroffene Personen hat. Im Schlussteil werden anhand der erarbeiteten Ergebnisse Maßnahmen auf juristischer, politischer und bildungspolitischer Ebene diskutiert, um die Möglichkeit einer Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden für Racial Profiling aufzuzeigen.
Auch wenn das deutsche Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 definiert, dass kein Mensch aufgrund der oben genannten Merkmale diskriminiert werden darf, weicht die Realität sowohl im Alltag als auch in Institutionen, die dem deutschen Grundgesetz direkt unterstellt sind, stark von der juristischen Grundlage ab. Der Bericht der Arbeitsgruppe „Experts on People of African Descent“ (Dt.: Expert*innen für Menschen der afrikanischen Diaspora) der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen warnt eindringlich, dass Schwarze Menschen und People of Color (POC) in der weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland täglichem Rassismus ausgesetzt sind.
Der Bericht bezieht sich explizit auf den institutionellen Rassismus innerhalb des deutschen Justizsystem und der Sicherheitsbehörden, dessen Existenz von Seiten der Bundesregierung bislang per se geleugnet wird. Der Bericht der Menschenrechtskommission listet Fälle polizeilicher Gewalt gegenüber Schwarzer Menschen und POCs auf, die sie als Konsequenz des institutionellen Rassismus dokumentieren. Darunter der Fall von Oury Jalloh aus Sierra Leone, der 2005 in polizeilichem Gewahrsam in seiner Zelle verbrannt ist. Bis heute sind die genauen Todesumstände unklar. Während die Polizei den Tod als einen Selbstmord darstellt, gehen Angehörige Jallohs und Menschenrechtsaktivist*innen einschlägig von Mord aus rassistischen Beweggründen aus.
Der Prozess wurde eingestellt, obwohl er nicht nachhaltig geklärt werden konnte. Zwei Polizisten wurden angeklagt, davon wurde einer zu einer Geldstrafe verurteilt und der andere freigesprochen. Sowohl der Staat als auch polizeiliche Institutionen verharmlosen Ereignisse wie den von Oury Jalloh als „unglückliche Einzelfälle“, und leugnen damit den Rassismus innerhalb deutscher Institutionen, auf den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) seit Jahren aufmerksam machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Racial Profiling als Symptom von institutionellem Rassismus
- 3. Racial/Ethnic Profiling – Definition und Auftretungsformen
- 4. Rechtsgrundlagen für Racial Profiling
- 5. Häufigkeit und „,Effizienz\" von Racial Profiling
- 6. Folgen von Racial Profiling für betroffene Menschen
- 7. Maßnahmen gegen rassistische Praktiken bei der Polizei
- 7.1 Juristische und politische Maßnahmen
- 7.2 Bildungspolitische Maßnahmen
- 8. Fazit - Es trifft uns alle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Problematik von institutionellem Rassismus innerhalb der Bundespolizei am Beispiel des Racial Profiling. Sie untersucht die Verwendung dieser Praxis in der Polizei, die rechtlichen Grundlagen und die Folgen für den Rechtsstaat sowie die betroffenen Personen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen von Racial Profiling zu schaffen und Möglichkeiten aufzuzeigen, um eine Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden zu fördern.
- Definition und Erscheinungsformen von Racial Profiling
- Juristische und rechtliche Rahmenbedingungen für Racial Profiling
- Auswirkungen von Racial Profiling auf die betroffenen Personen und den Rechtsstaat
- Diskussion möglicher Maßnahmen zur Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden
- Bedeutung der Bekämpfung von institutionellem Rassismus für eine gerechte Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Racial Profiling im Kontext von institutionellem Rassismus innerhalb der Bundespolizei dar. Kapitel 2 untersucht Racial Profiling als ein Symptom von institutionellem Rassismus und erläutert dessen gesellschaftliche und politische Bedeutung. Kapitel 3 widmet sich der Definition und den verschiedenen Erscheinungsformen von Racial/Ethnic Profiling. Kapitel 4 analysiert die rechtlichen Grundlagen für Racial Profiling und stellt die Frage, inwiefern diese Praxis mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist. Kapitel 5 untersucht die Häufigkeit und die „Effizienz“ von Racial Profiling in der Praxis. Kapitel 6 beleuchtet die Folgen von Racial Profiling für die betroffenen Menschen und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität und die soziale Integration. Kapitel 7 diskutiert mögliche Maßnahmen zur Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden für Racial Profiling und setzt sich mit juristischen, politischen und bildungspolitischen Ansätzen auseinander.
Schlüsselwörter
Institutioneller Rassismus, Racial Profiling, Ethnic Profiling, Bundespolizei, Polizeiarbeit, Diskriminierung, Menschenrechte, Rechtsstaat, Sensibilisierung, Rechtliche Maßnahmen, Politische Maßnahmen, Bildungspolitische Maßnahmen, Schwarze Menschen, People of Color (POC).
- Citation du texte
- Sonja Smolenski (Auteur), 2019, Institutioneller Rassismus bei der Bundespolizei am Beispiel von Racial Profiling, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/915305