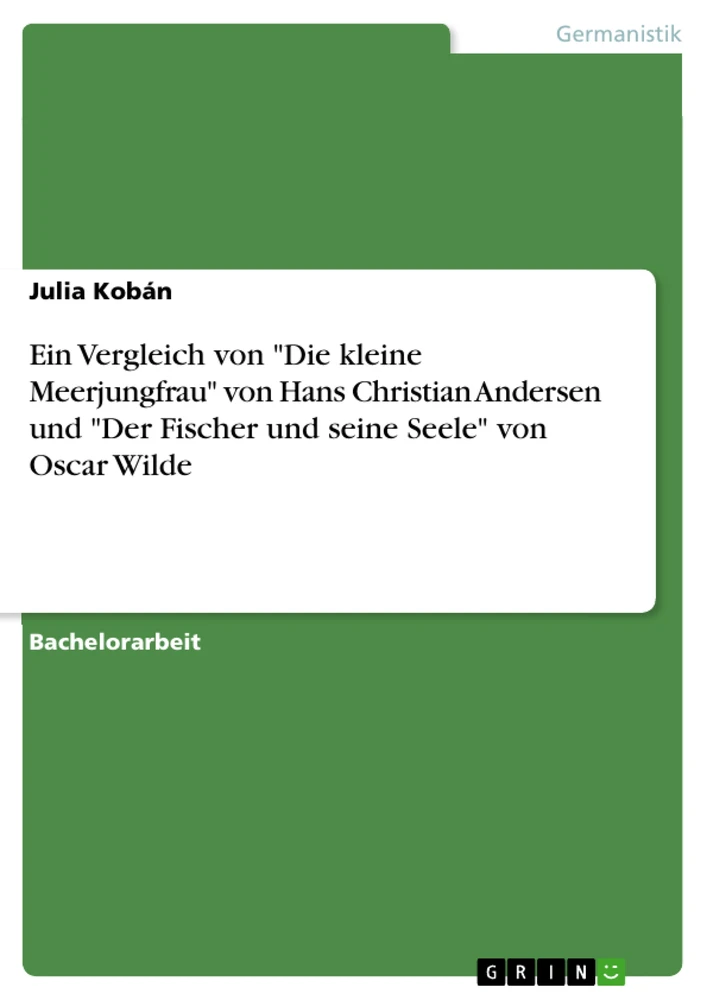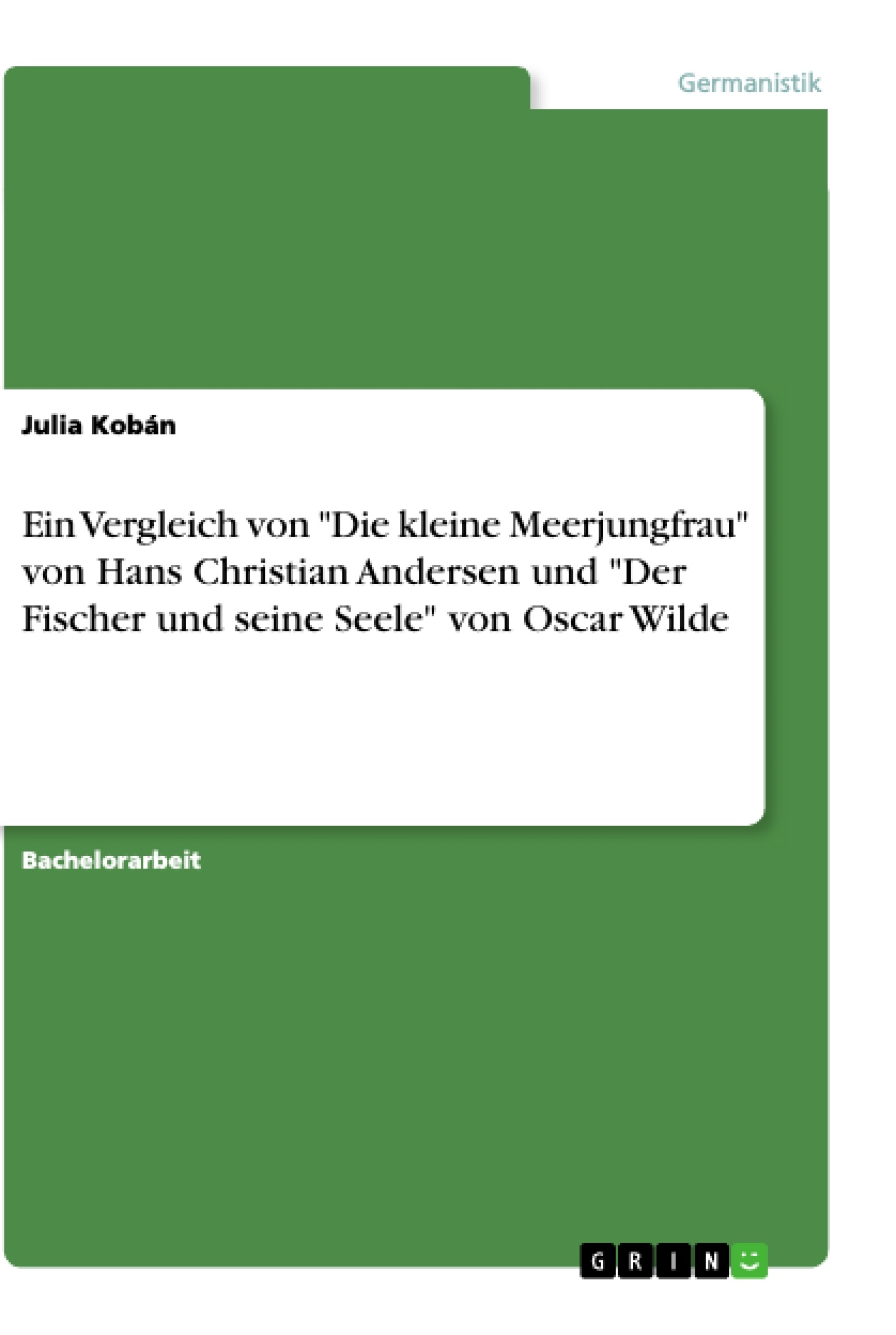Im Fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit steht die Analyse der Märchen mit einem anschließenden Vergleich. Ziel ist es, Übereinstimmungen und Unterschiedlichkeiten in Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache der Texte mithilfe der Methode der Textanalyse nachzuweisen. Dabei soll die Zuschreibung zur Gattung Kunstmärchen in der Analyse berücksichtigt und geprüft werden.
Die Vorgehensweise ist wie folgt: die Gattung „Kunstmärchen“ wird spezifiziert, entsprechende Merkmale benannt und der Vergleich zum Volksmärchen gezogen. Danach werden die Kunstmärchen von Andersen und Wilde mithilfe festgelegter Kriterien untersucht und analysiert. Dazu zählen: narratologische und sprachliche Besonderheiten, Handlungs- und Figurenanalyse sowie die Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod. Die Festlegung der ausgewählten Kriterien ist bei der Analyse zielführend, da somit Wiederholungen, Auslassungen und eine unterschiedliche Betrachtungsweise beider Texte ausgeschlossen werden kann. Für den abschließenden Vergleich ist eine analoge Betrachtung der Märchen unumgänglich. Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache der Märchen sollen genauestens erfasst werden, um sie einander gegenüberstellen zu können.
Ausschlaggebend für die Textauswahl dieser Märchen ist einerseits die Berühmtheit von Andersens „Die kleine Meerjungfrau“ und andererseits der offensichtliche Bezug Wildes in „Der Fischer und seine Seele“ auf ihn. Begeistert von den Geschichten und der Erzählkunst beider Autoren und der phantasievollen Behandlung des Nixen-Stoffes scheinen beide Märchen als Gegenstand eines Vergleichs sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Märchen
- 3. „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen
- 3.1 Narratologische Besonderheiten
- 3.2 Sprachliche Besonderheiten
- 3.3 Handlungs- und Figurenanalyse
- 3.4 Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod
- 4. „Der Fischer und seine Seele“ von Oscar Wilde
- 4.1 Narratologische Besonderheiten
- 4.2 Sprachliche Besonderheiten
- 4.3 Handlungs- und Figurenanalyse
- 4.4 Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod
- 5. Vergleich der Märchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert und vergleicht die Kunstmärchen „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen und „Der Fischer und seine Seele“ von Oscar Wilde. Ziel ist die Aufdeckung von Übereinstimmungen und Unterschieden in Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache. Die Zugehörigkeit zur Gattung Kunstmärchen wird dabei kritisch geprüft.
- Analyse der narratologischen Besonderheiten beider Märchen
- Vergleich der sprachlichen Stile von Andersen und Wilde
- Untersuchung der Handlungsstrukturen und Figurencharakterisierungen
- Analyse der Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod in beiden Texten
- Vergleich der beiden Märchen im Hinblick auf ihre Einordnung in die Gattung Kunstmärchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Märchen, insbesondere solcher mit Wassermotiven. Sie hebt die Faszination der Meerjungfrau als Fabelwesen hervor und führt die beiden ausgewählten Märchen von Andersen und Wilde als zentrale Untersuchungsobjekte ein. Die Arbeit beschreibt die Autoren und ihre Bedeutung im Kontext der Märchengattung, bevor sie die Methodik und den Ablauf der Analyse detailliert darlegt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Märchen in Bezug auf Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache, unter Berücksichtigung der Gattung Kunstmärchen.
2. Das Märchen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Märchen“ und differenziert zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Es beschreibt die charakteristischen Merkmale des Volksmärchens und stellt diese den Merkmalen des Kunstmärchens gegenüber. Dabei werden inhaltliche, strukturelle und sprachliche Unterschiede beleuchtet. Es wird herausgestellt, dass Kunstmärchen im Gegensatz zu Volksmärchen, oft komplexere Handlungsstränge, differenzierte Charaktere und eine psychologisiertere Darstellung aufweisen. Trotz der Unterschiede werden auch Gemeinsamkeiten, wie z.B. die Verwendung von Symbolen und die Darstellung eines Mangels in der Ausgangssituation, erwähnt.
3. „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen: Dieses Kapitel untersucht Andersens „Die kleine Meerjungfrau“ anhand der festgelegten Kriterien. Es analysiert die narratologischen Besonderheiten, die sprachliche Gestaltung, die Handlungsstruktur und die Figurencharakterisierung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod im Kontext des Märchens. Die Analyse beleuchtet die symbolische Bedeutung der Meerjungfrau und ihre Entwicklung im Laufe der Handlung.
4. „Der Fischer und seine Seele“ von Oscar Wilde: Analog zu Kapitel 3 analysiert dieses Kapitel Wildes „Der Fischer und seine Seele“. Es untersucht die narratologischen und sprachlichen Eigenheiten, die Figuren und Handlung sowie die Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod im Kontext der Erzählung. Die Analyse betrachtet den Stil Wildes im Vergleich zu Andersen und beleuchtet die spezifischen Themen und Motive des Märchens.
Schlüsselwörter
Kunstmärchen, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, „Die kleine Meerjungfrau“, „Der Fischer und seine Seele“, Meerjungfrau, Natur, Seele, Tod, Vergleichende Textanalyse, Narratologie, Sprachstil, Figurencharakterisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Vergleich von "Die kleine Meerjungfrau" und "Der Fischer und seine Seele"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert und vergleicht die beiden Kunstmärchen „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen und „Der Fischer und seine Seele“ von Oscar Wilde. Im Mittelpunkt stehen Übereinstimmungen und Unterschiede in Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache. Die Zugehörigkeit beider Texte zur Gattung Kunstmärchen wird kritisch geprüft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse der narratologischen Besonderheiten beider Märchen, Vergleich der sprachlichen Stile von Andersen und Wilde, Untersuchung der Handlungsstrukturen und Figurencharakterisierungen, Analyse der Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod in beiden Texten und ein Vergleich der Einordnung beider Märchen in die Gattung Kunstmärchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition des Märchens (Volksmärchen vs. Kunstmärchen), Analyse von Andersens „Die kleine Meerjungfrau“, Analyse von Wildes „Der Fischer und seine Seele“ und ein abschließender Vergleich beider Märchen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, erläutert die Bedeutung von Märchen, insbesondere solcher mit Wassermotiven, hebt die Faszination der Meerjungfrau hervor und stellt die beiden ausgewählten Märchen als zentrale Untersuchungsobjekte vor. Sie beschreibt die Autoren und ihre Bedeutung im Kontext der Märchengattung und detailliert die Methodik und den Ablauf der Analyse. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Märchen hinsichtlich Inhalt, Form, Aufbau, Struktur und Sprache im Kontext der Gattung Kunstmärchen.
Wie wird das Märchen definiert?
Kapitel 2 definiert den Begriff „Märchen“ und unterscheidet zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Es beschreibt die charakteristischen Merkmale des Volksmärchens und vergleicht sie mit denen des Kunstmärchens. Inhaltliche, strukturelle und sprachliche Unterschiede werden beleuchtet. Es wird herausgestellt, dass Kunstmärchen im Gegensatz zu Volksmärchen komplexere Handlungsstränge, differenzierte Charaktere und eine psychologisiertere Darstellung aufweisen. Gemeinsamkeiten wie die Verwendung von Symbolen und die Darstellung eines Mangels in der Ausgangssituation werden ebenfalls erwähnt.
Wie werden die einzelnen Märchen analysiert?
Die Kapitel 3 und 4 analysieren jeweils „Die kleine Meerjungfrau“ und „Der Fischer und seine Seele“ anhand festgelegter Kriterien. Es werden die narratologischen Besonderheiten, die sprachliche Gestaltung, die Handlungsstruktur, die Figurencharakterisierung und die Darstellung und Bedeutung von Natur, Seele und Tod untersucht. Die Analyse beleuchtet die symbolische Bedeutung der jeweiligen Hauptfiguren und deren Entwicklung im Laufe der Handlung. Kapitel 4 vergleicht zusätzlich den Stil Wildes mit dem Andersens.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Kunstmärchen, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, „Die kleine Meerjungfrau“, „Der Fischer und seine Seele“, Meerjungfrau, Natur, Seele, Tod, Vergleichende Textanalyse, Narratologie, Sprachstil, Figurencharakterisierung.
- Quote paper
- Julia Kobán (Author), 2018, Ein Vergleich von "Die kleine Meerjungfrau" von Hans Christian Andersen und "Der Fischer und seine Seele" von Oscar Wilde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914835