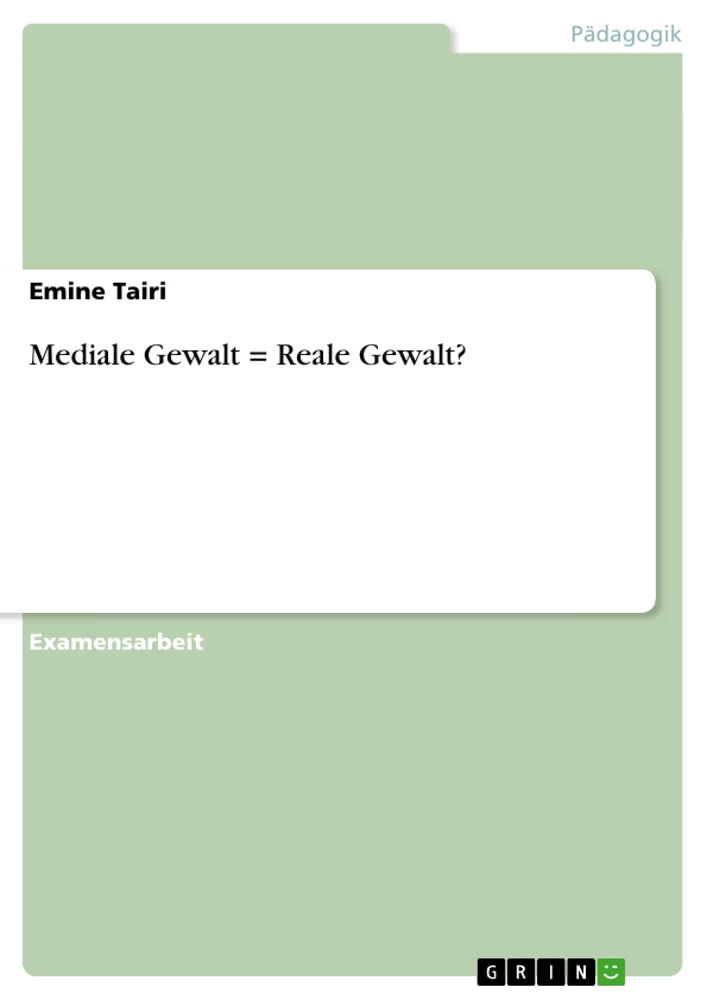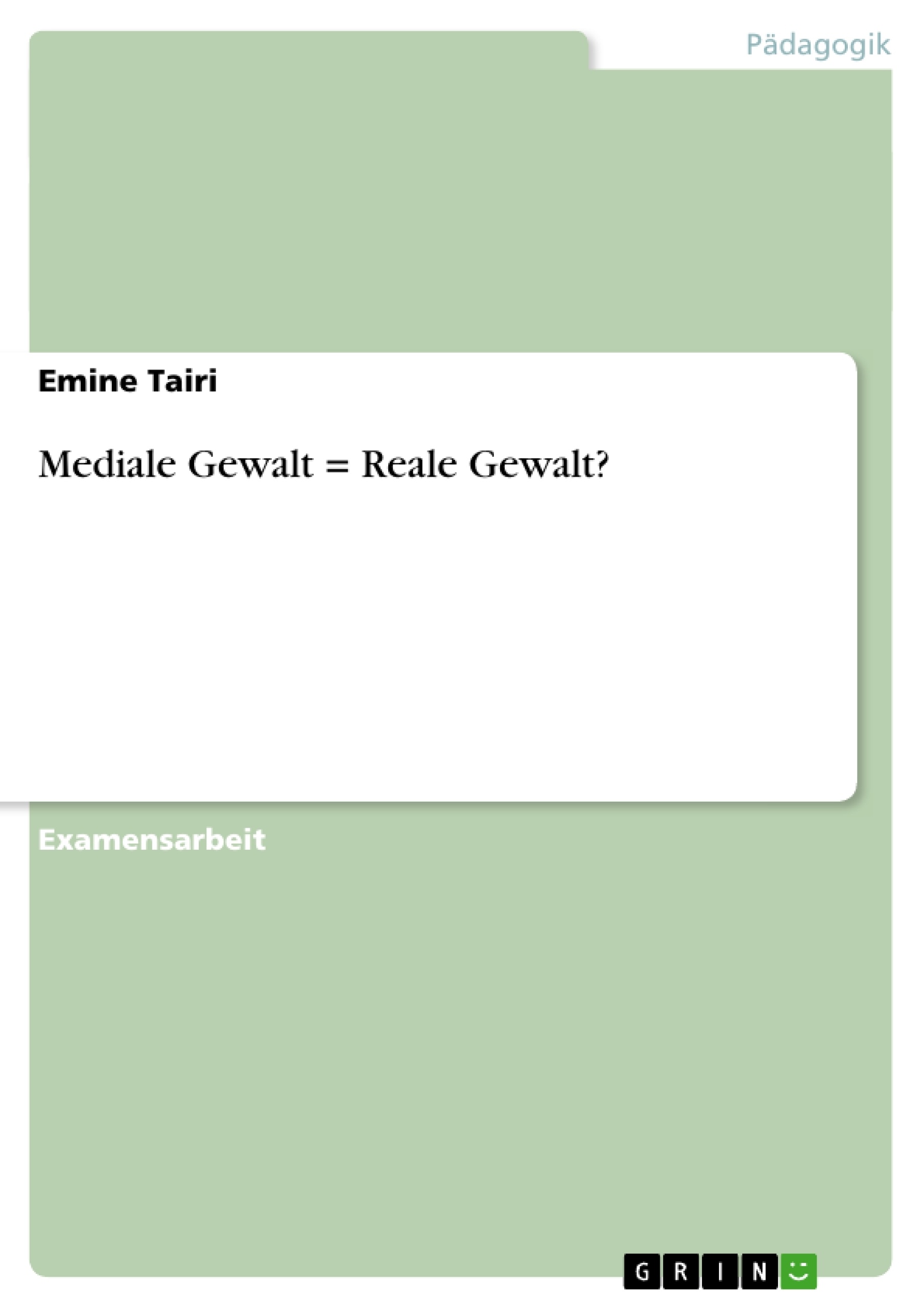Am 20. April 1999 betreten der 17-jährige Dylan Klebold und sein 18-jähriger Freund Eric Harris ihr High-School-Gebäude in Littelton, Colorado. Sie sind mit zwei abgesägten Schrotflinten, einer Neun Millimeter - Pistole, einem Karabiner, 30 selbstgebauten Sprengsätzen und einer 10kg-Bombe ausgerüstet. Dabei tragen sie Skimasken und lange schwarze Trenchcoats. Während ihres Amoklaufs töten sie zwölf Schüler und einen Lehrer. Anschließend erschossen die Täter sich selbst.
Gasthoven, 12 Februar 2002: Der 19-jährige Michael Weinhold, als Tod verkleidet, bricht in ein Familienhaus ein und ersticht die 12-jährige Vanessa mit mindestens 21 Stichen. Michael ahmte seine Helden ”Billy” nach, den Mörder aus dem Film Scream, dessen Maske er an seine Wand hängen hatte. ,Scream` und ,Halloween` hatte Michael Weinhold mindestens 50-mal gesehen. Die Polizei fand 72 Gewalt-Videofilme in seinem Zimmer, von denen allein 60 aufgrund der besonders hohen Brutalität auf dem Index stehen.
Am 26. April 2002 tötete der 19-jährige Robert Steinhäuser, der 2 Monate vor seiner Abiturprüfung von seiner Schule, dem Gutenberg-Gymnasium, wegen Dokumentenfälschung verwiesen worden war, zwölf Lehrerinnen und Lehrer, eine Schulsekretärin, zwei Schülerinnen, einen Polizisten und anschließend sich selbst. “Ich möchte, dass mich einmal alle kennen und ich berühmt bin”, hatte Robert seinen Mitschülern gegenüber `mal erwähnt.
Drei (von vielen) schrecklichen Taten - und bei allen wurde schnell in den Medien, der Politik etc. das Spielen von Gewalt-Computerspielen und das Rezipieren von Horror- Videos als Ursache genannt. Denn bei allen Tätern wurden solche gewalttätigen Computerspiele wie DOOM, Quake etc. und ein hohes Maß an ”Blut triefenden” Gewaltfilmen sichergestellt.
Doch besteht wirklich ein Ursache-/ Wirkungs-Zusammenhang zwischen den Massenmedien (Computerspiele, Videos, Actionfilme, Zeichentrickfilme etc.) und auftretender Gewalt? Machen Medien Mörder? Welche Auswirkungen hat der Konsum von Massenmedien? Welche Ansätze bietet die Medienpädagogik?
Mit diesen Fragestellungen hat sich die Wissenschaft stark befasst und eine große Anzahl von Studien und Theorien publiziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ZUR BESTIMMUNG DES GEWALTBEGRIFFS
- 2.1. Strukturelle Gewalt
- 2.2. Personale Gewalt
- 2.3. Physische und psychische Gewalt
- 2.4. Entstehung von Gewalt
- 2.5. Der Gewaltbegriff in medialen Zusammenhängen
- 2.6. Zusammenfassung
- 3. MEDIEN
- 3.1. Definition Medien
- 3.2. Die Funktion von Medien
- 3.3. Fernsehkonsum von Kindern
- 3.3.1. Der quantitative Fernsehkonsum von Kindern von 3- bis 13-Jahren
- 3.3.2. Der qualitative Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen
- 3.4. Darstellung von Gewalt im Fernsehen
- 3.5. Motive zum Konsum von Gewalt im Fernsehen
- 3.6. Wahrnehmung von Gewalt
- 3.7. Zusammenfassung
- 4. MODELLE ZUR ERKLÄERUNG DER WIRKUNG MEDIALER GEWALTDARSTELLUNGEN
- 4.1. Stimulus-orientierte Ansätze
- 4.1.1. Stimulus-Respons-Ansatz
- 4.1.2. Theorie der kognitiven Dissonanz
- 4.1.3. Verstärkertheorie (Geißler 1992, 23 ff.)
- 4.2. Rezipienten-orientierte Ansätze
- 4.2.1. Theorie des Two- Step- Flow
- 4.2.2. Uses-and-gratification- approach
- 4.2.3. Dynamisch- transaktionaler Ansatz
- 4.2.4. Kultivierungshypothese
- 4.3. Zusammenfassung
- 5. HABEN GEWALTAKTE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IHRE URSACHE IN GEWALTDARSTELLUNGEN?
- 5.1. Beispiele für Nachahmungstaten
- 5.2. Der Wirkungsbegriff
- 5.3. Die klassischen Wirkungsansätze
- 5.3.1. Theorien, die Aggressionsmindernde Wirkungen erklären
- 5.3.1.1. Katharsisthese
- 5.3.1.2. Inhibitionsthese
- 5.3.2. Theorien, die Aggressionssteigernde Wirkungen erklären
- 5.3.2.1. Erregungstheorien
- 5.3.2.1.1. Frustrations- Aggressions- Theorie
- 5.3.2.1.2. Excitation-Transfer-Theorie
- 5.3.3. Lerntheorien
- 5.3.3.1. Die sozial-kognitive Lerntheorie
- 5.3.3.2 Habitualisierungstheorie
- 5.3.3.3. Suggestitionsthese
- 5.3.4. These der Wirkungslosigkeit
- 5.4. Der Stand der Wirkungsforschung
- 5.4.1. Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit
- 5.4.2. Emotionale Effekte
- 5.4.2.1. Angst
- 5.4.2.2. Gewalt
- 5.5. Zusammenfassung
- 6. PÄDAGOGISCHE PRÄVENTIONSMÖGLICHKEITEN
- 6.1. Selbstkontrolle und Verantwortung der Medien
- 6.2. Medienpädagogische Ansätze
- 7. MEDIALE GEWALT= REALE GEWALT?
- Die Definition und Abgrenzung des Gewaltbegriffs im Kontext medialer Inhalte
- Die Rolle von Medien im Alltag von Kindern und Jugendlichen und insbesondere der Einfluss des Fernsehens
- Die verschiedenen Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen, sowohl aus der Perspektive des Rezipienten als auch aus der Perspektive des Stimulus
- Die Analyse von empirischen Studien zur Frage, ob Gewaltakte von Kindern und Jugendlichen durch mediale Gewaltdarstellungen beeinflusst werden
- Die Rolle der Medienpädagogik und ihrer Ansätze zur Prävention von Gewalt
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem möglichen Zusammenhang zwischen medialer Gewalt und realer Gewalt dar. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Medien Mörder machen und welche Auswirkungen der Konsum von Massenmedien auf Kinder und Jugendliche hat.
- Kapitel 2: Zur Bestimmung des Gewaltbegriffs: Dieses Kapitel definiert den Gewaltbegriff in verschiedenen Dimensionen, darunter strukturelle, personale, physische und psychische Gewalt. Es beleuchtet die Entstehung von Gewalt und betrachtet den spezifischen Gewaltbegriff im Kontext medialer Inhalte.
- Kapitel 3: Medien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Funktion von Medien und analysiert den Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen. Es untersucht die Darstellung von Gewalt im Fernsehen und die Motive zum Konsum von Gewalt. Zudem wird die Wahrnehmung von Gewalt im Kontext medialer Inhalte betrachtet.
- Kapitel 4: Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen vor. Es untersucht sowohl stimulus-orientierte als auch rezipienten-orientierte Ansätze. Die Kultivierungshypothese und der Uses-and-gratification-approach werden ebenfalls beleuchtet.
- Kapitel 5: Haben Gewaltakte von Kindern und Jugendlichen ihre Ursache in Gewaltdarstellungen?: Dieses Kapitel analysiert die Frage, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen medialer Gewalt und realer Gewalt besteht. Es präsentiert Beispiele für Nachahmungstaten und beleuchtet verschiedene Theorien zur Erklärung von Aggressionssteigernden und Aggressionsmindernden Wirkungen medialer Gewaltdarstellungen.
- Kapitel 6: Pädagogische Präventionsmöglichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit pädagogischen Ansätzen zur Prävention von Gewalt im Kontext medialer Inhalte. Es analysiert die Rolle der Selbstkontrolle und der Medienverantwortung sowie die Möglichkeiten der Medienpädagogik.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die möglichen Auswirkungen von Gewaltdarstellungen in den Medien auf Kinder und Jugendliche. Sie befasst sich mit der Frage, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen medial dargestellter Gewalt und realer Gewalt existiert. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen und betrachtet den Stand der aktuellen Wirkungsforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen mediale Gewalt, reale Gewalt, Wirkungsforschung, Medienpädagogik, Fernsehkonsum, Gewaltdarstellungen, Kinder und Jugendliche, und die verschiedenen Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen.
- Quote paper
- Emine Tairi (Author), 2006, Mediale Gewalt = Reale Gewalt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91333