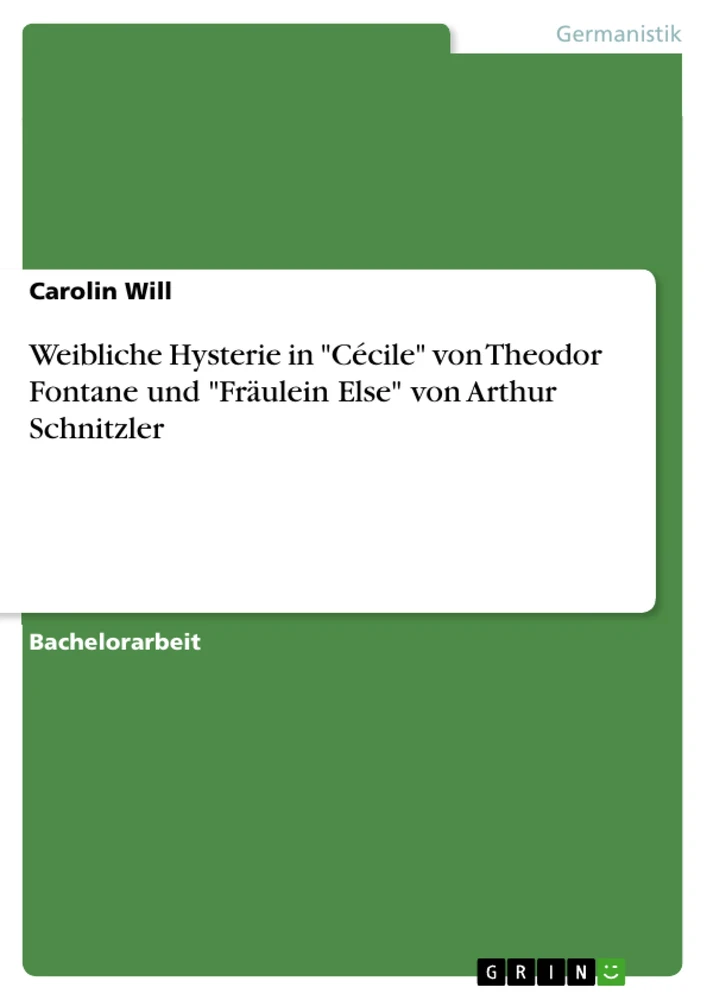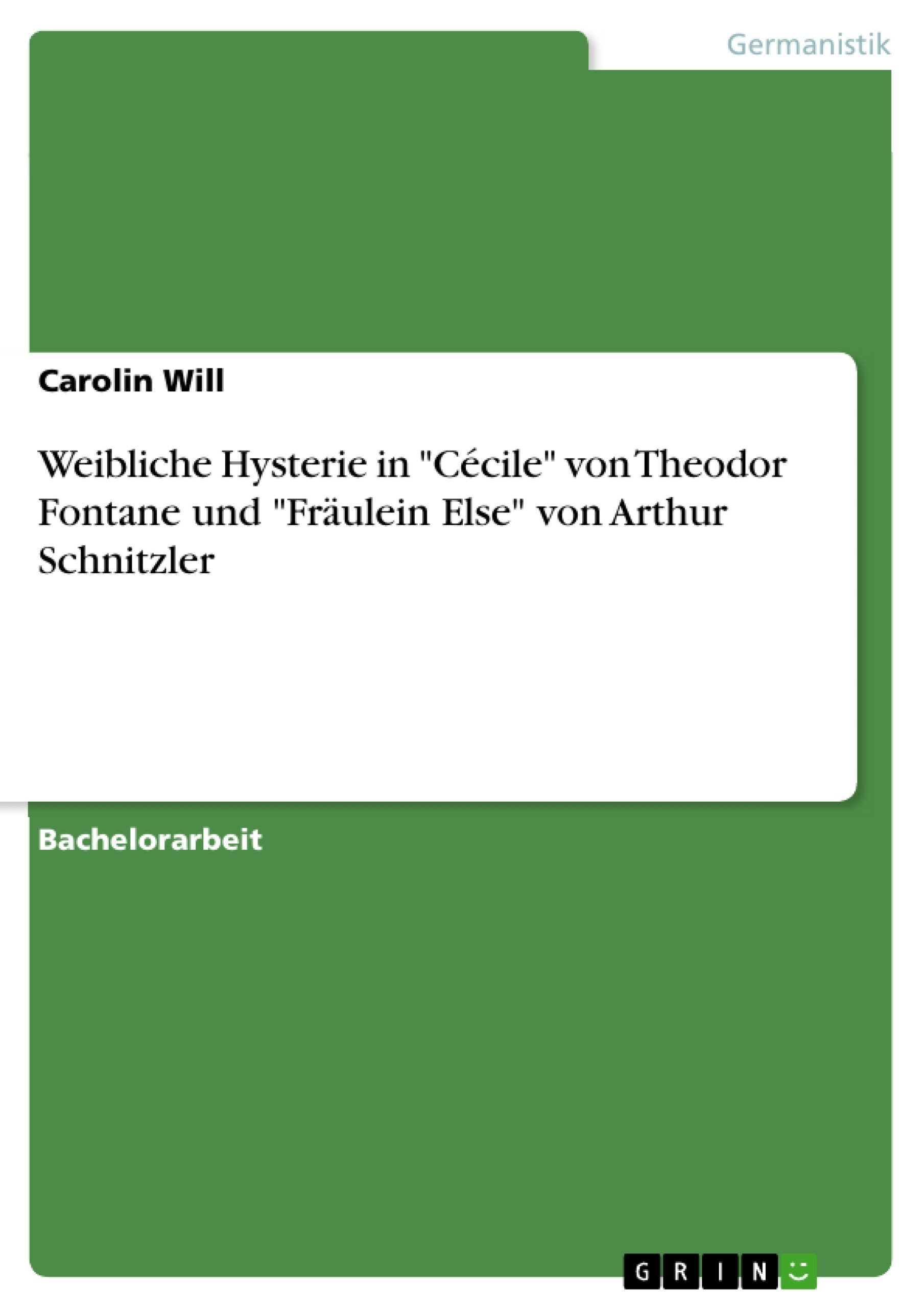Die Arbeit untersucht die Forderungen der Gesellschaft an Weiblichkeit, an welchen die Frauenfiguren erkranken. Die Untersuchung befasst sich mit den Faktoren des Soziallebens am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, welche gerade bei Frauen hysterische Symptome hervorriefen. Betrachtet werden Theodor Fontanes 1886 erstveröffentlichte "Cécile" und Arthur Schnitzlers 1924 erschienene "Fräulein Else".
Interessant ist dabei auch, welche Auswirkungen Sigmund Freuds Überlegungen zur Geisteskrankheit und dem Unbewussten auf deren literarische Darstellung hatten. Dass die Symptome beider Frauen zu deren Tod führen, trotz der knapp 40-jährigen Hysterieforschung, welche zwischen der Erstveröffentlichung der Erzählungen liegt, lässt vermuten, dass die gesellschaftlichen Mechanismen sich in dieser Zeit nicht grundlegend gewandelt haben. Dennoch können Freuds Thesen zur Hysterie als Grenze in deren Erforschung betrachtet werden, sodass es zielführend ist, diese zu erläutern, bevor die Texte betrachtet werden. Seine Ergebnisse und Ansichten sind jedoch Produkte des Zeitgeistes, sodass zunächst ein Verständnis für diesen geschaffen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Hysterie - Zeichen des Zeitgeistes oder Zivilisationskrankheit?
- Weibliche Hysterie am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
- Zeitkontext
- Freuds Hysteriebegriff
- Hysterische Symptome – ein Überblick
- Hysterie in „Cécile“ und „Fräulein Else“
- Cécile
- Von der vermeintlichen Genesung zum Selbstmord
- Der Umgang anderer Figuren mit Céciles Leiden
- Fräulein Else
- Elses Hysterische Merkmale
- Die Anziehungskraft weiblicher Schwäche: Reaktionen anderer Figuren auf Elses hysterische Symptome
- Cécile
- Gesellschaftliche Anforderungen als Auslöser der Hysterie von Cécile und Else
- Eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten als Auslöser weiblicher Hysterie
- Anforderungen in Paarbeziehungen
- Die Frau als Kapital und Statussymbol
- Sexuelle Anforderungen
- Anforderungen von Frauen an Frauen
- Erwartungen an die eigene Person
- Vergleich zentraler Aspekte, welche Elses und Céciles Hysterie bedingen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung weiblicher Hysterie in Theodor Fontanes „Cécile“ und Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“. Im Zentrum steht die Frage, wie die gesellschaftlichen Anforderungen an Weiblichkeit im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zur Entstehung hysterischer Symptome bei den Protagonistinnen beitragen. Darüber hinaus wird der Einfluss von Sigmund Freuds Hysteriebegriff auf die literarische Darstellung der Krankheit erörtert.
- Die gesellschaftlichen Bedingungen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die zur Entstehung weiblicher Hysterie führten
- Der Einfluss von Sigmund Freuds Hysteriebegriff auf die literarische Darstellung der Krankheit
- Die Rolle der Geschlechterrollen und -erwartungen in der Entstehung hysterischer Symptome
- Die Auswirkungen eingeschränkter Bildungs- und Selbstentfaltungsmöglichkeiten für Frauen
- Die Darstellung von weiblichem Leid und psychischer Belastung in den literarischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Begriffs „Zivilisationskrankheit“ und stellt die Hysterie als ein zentrales Nervenleiden des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts vor. Das zweite Kapitel untersucht den historischen Kontext, in dem die weibliche Hysterie ihren Ursprung findet, und beleuchtet die spezifischen Geschlechterrollen und -erwartungen der Zeit. Dabei wird auch auf Freuds Hysteriebegriff eingegangen. Das dritte Kapitel analysiert die Darstellung der Hysterie in „Cécile“ und „Fräulein Else“ und untersucht die Symptome, die die Protagonistinnen zeigen, sowie die Reaktionen der anderen Figuren auf deren Leiden. Das vierte Kapitel widmet sich der Frage, wie gesellschaftliche Anforderungen, wie beispielsweise eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten, gesellschaftliche Erwartungen an Frauen in Paarbeziehungen und die eigene Person, die Entstehung der Hysterie bei Cécile und Else begünstigen. Das fünfte Kapitel vergleicht zentrale Aspekte, die die Hysterie der beiden Protagonistinnen bedingen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung weiblicher Hysterie in der Literatur des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zentrale Themen sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Entstehung hysterischer Symptome führten, der Einfluss von Sigmund Freuds Hysteriebegriff, die Rolle der Geschlechterrollen, die Auswirkungen eingeschränkter Bildungsmöglichkeiten für Frauen, die Darstellung von weiblichem Leid und psychischer Belastung, sowie die Analyse von literarischen Texten wie „Cécile“ von Theodor Fontane und „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler.
- Arbeit zitieren
- Carolin Will (Autor:in), 2018, Weibliche Hysterie in "Cécile" von Theodor Fontane und "Fräulein Else" von Arthur Schnitzler, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912761