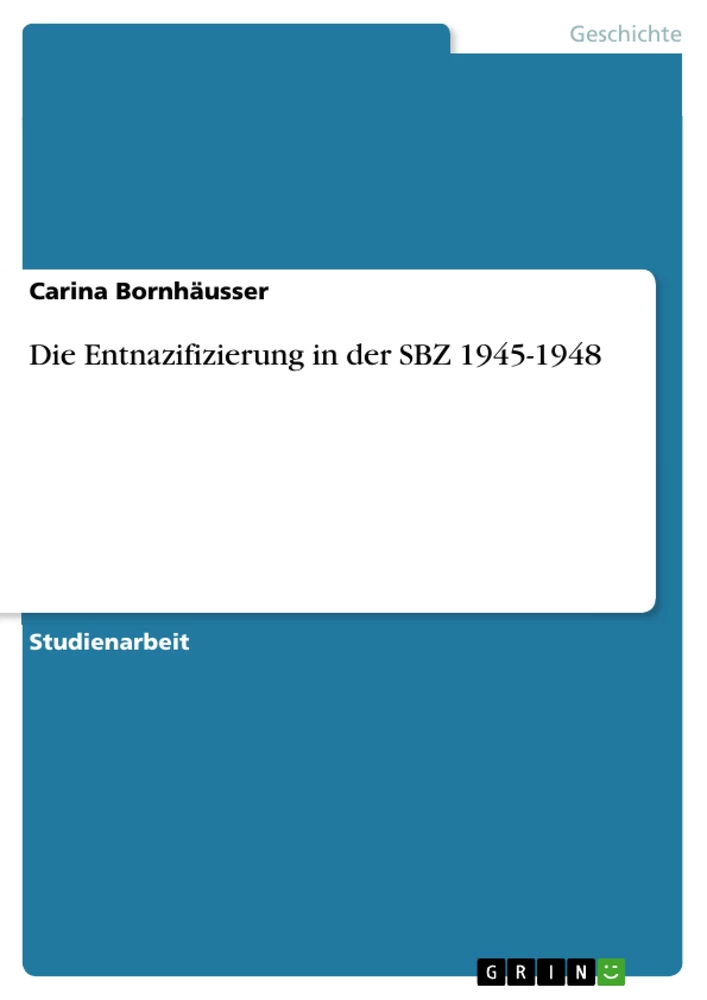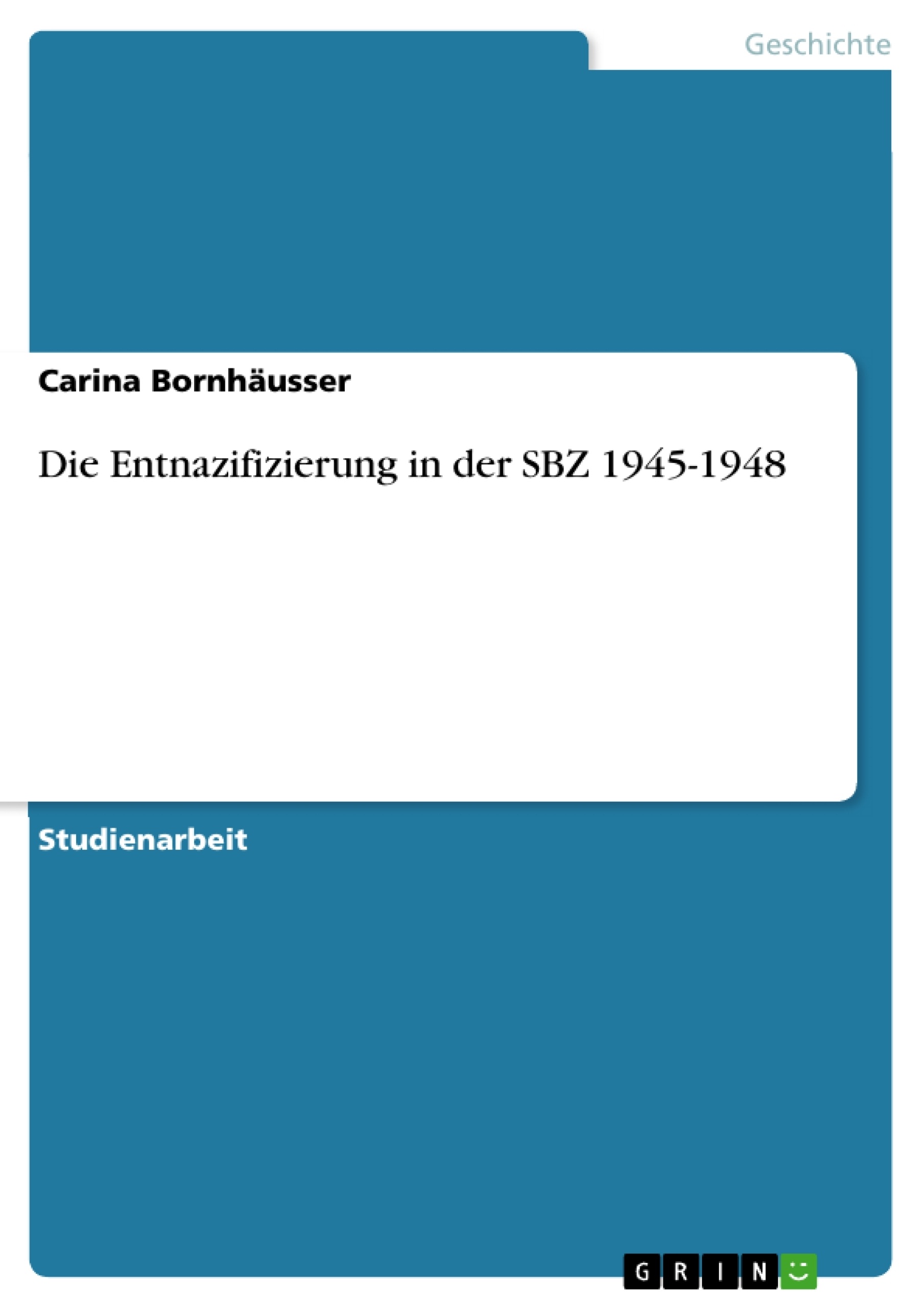Die Entnazifizierung Deutschlands war eines der Hauptziele der Siegermächte gewesen, das sie unter den „vier D’s“ zusammenfassten: Denazifizierung, Demokratisierung, Dekartellisierung und Demilitarisie-rung. Unter diesen Gesichtspunkten sollten die Verantwortlichen des Hitlerregimes zur Verantwortung gezogen werden. Doch was geschah mit den vielen Mitläufern? Ein entscheidendes Kriterium bildete in der SBZ die Trennung von aktiven und nominellen Nazis. Aber wie konnte eine Person richtig und vor allem gerecht einer dieser beiden Kategorien zugeordnet werden? Die ungenauen Differenzierungen stellten die Entnazifizierungs-kommissionen vor große Probleme, was folglich Unruhen und Vertrauensverluste innerhalb der Bevölkerung auslöste. Allmählich schien das Ziel der Entnazifizierung hinter dem Ziel des Aufbaus eines stalinistischen Gesellschaftssystems zurück zutreten. Bis in die sechziger Jahre hinein wurden weder in Ost- noch in Westdeutschland Editionen zum Thema Entnazifizierung herausgegeben. Geschichtswissenschaftler der ehemaligen DDR gingen bis in die achtziger Jahre davon aus, dass die Entnazifizierung erfolgreich verlaufen sei. Somit bestand für sie kein Forschungsbedarf. Die westlichen Historiker hingegen beschäftigten sich stark mit der späteren Gründung der BRD. Erst zu Beginn der achtziger Jahre erschienen die ersten Publikationen zu diesem Thema. Mit der Öffnung der Archive der DDR nach ihrem Zusammenbruch 1989 folgte ein weiterer Schub in der Entnazifizierungs-forschung. Umstritten ist jedoch bis heute die Frage, ob die sowjetischen Besatzer von Anfang an eine geplante Umstrukturierung der Gesellschaft nach stalinistischem Vorbild verfolgten. Die Historikerin Rößler geht davon aus, dass die Durchsetzung der Rehabilitationsmaßnahmen in der SBZ äußerst spontan abliefen.
Im Gegensatz dazu statuiert Sperk, dass die SMAD einerseits nach der Beseitigung des NS-Staates strebte, aber durchaus von Beginn an das Ziel verfolgte, ein System sowjetischer Prägung zu installieren. Der russische Historiker Nikita Petrov vertritt ebenfalls diese Auffassung und ist überzeugt davon, dass Stalin die Mittel der Repressionen gezielt einsetzte, um damit seine Politik zu verwirklichen.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung.
- B Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches……………………
- I.1. Die Beschlüsse der Siegermächte.
- I.2. Die Anfänge der Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone
- I.3 Die ersten gesetzlichen Grundlagen.
- I.4 Phase 3: Die Kontrollratsdirektive Nr. 24
- I.5 Der SMAD Befehl Nr. 201: Das Ende der Entnazifizierung
- I.5.1 Die Durchführung des Befehls Nr. 201..
- I.6. Das Ende der Entnazifizierung – der Befehl Nr. 35.
- C Schwerpunkte der Entnazifizierung.
- II.1. Die Polizei
- II.2 Die Verwaltung
- II.3 Das Gesundheitswesen
- D Schlussbemerkung.
- E Abkürzungen
- F Quellenverzeichnis
- G Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entnazifizierung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) von 1945 bis 1948. Sie untersucht die Herausforderungen und Probleme, die sich aus der Umsetzung der Entnazifizierung in der SBZ ergaben, und analysiert, wie sich die Entnazifizierungspolitik auf die Gesellschaft und den Wiederaufbau Deutschlands auswirkte.
- Die Beschlüsse der Siegermächte und die Umsetzung der Entnazifizierungspolitik in der SBZ.
- Die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der Entnazifizierung.
- Die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen aktiven und nominellen Nazis und die Folgen für die betroffene Bevölkerung.
- Die Auswirkungen der Entnazifizierung auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft, wie die Polizei, die Verwaltung und das Gesundheitswesen.
- Der Wandel des Ziels der Entnazifizierung hin zu einem stalinistischen Gesellschaftsmodell.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Kontext der Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Herausforderungen, vor denen die Siegermächte standen. Die Arbeit befasst sich mit dem Ziel, die Entnazifizierung in der SBZ zu analysieren, indem sie sich auf die Schwierigkeiten konzentriert, die sich aus der Unterscheidung zwischen aktiven und nominellen Nazis ergaben. Außerdem wird der Wandel des Entnazifizierungszieles hin zu einem stalinistischen Gesellschaftsmodell untersucht.
Kapitel B beschreibt die Beschlüsse der Siegermächte und den Beginn der Entnazifizierung in der SBZ. Es wird untersucht, wie die Unterscheidung zwischen aktiven und nominellen Nazis in der Praxis umgesetzt wurde, und es werden die ersten Gesetze und Verordnungen analysiert, die im Rahmen der Entnazifizierung erlassen wurden.
Kapitel C befasst sich mit den Schwerpunkten der Entnazifizierung, insbesondere in den Bereichen Polizei, Verwaltung und Gesundheitswesen. Es zeigt, wie die Entnazifizierung die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusste und welche Folgen sie für die betroffene Bevölkerung hatte.
Schlüsselwörter
Entnazifizierung, Sowjetische Besatzungszone (SBZ), Stalinismus, aktive Nazis, nominelle Nazis, SMAD, Kontrollratsdirektiven, Säuberungsphasen, Wiederaufbau, Gesellschaft, Politik, Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ziele der Entnazifizierung in der SBZ?
Die Entnazifizierung war Teil der „vier D’s“ (Denazifizierung, Demokratisierung, Dekartellisierung, Demilitarisierung). In der SBZ wurde sie zudem zunehmend für den Aufbau eines stalinistischen Systems genutzt.
Wie unterschied man zwischen aktiven und nominellen Nazis?
Aktive Nazis waren belastete Funktionäre, während nominelle Nazis oft nur einfache Parteimitglieder (Mitläufer) waren. Die Abgrenzung war in der Praxis jedoch oft ungenau und problematisch.
Was war der SMAD-Befehl Nr. 201?
Dieser Befehl markierte eine entscheidende Phase der Entnazifizierung, in der die Verantwortung teilweise an deutsche Kommissionen übertragen wurde, um die Säuberungen abzuschließen.
In welchen Bereichen war die Entnazifizierung besonders intensiv?
Besonders stark betroffen waren die Polizei, die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen, da diese Bereiche für die Kontrolle und Versorgung der Gesellschaft zentral waren.
Warum gab es lange Zeit kaum Forschung zur Entnazifizierung in der DDR?
Die offizielle Geschichtsschreibung der DDR ging davon aus, dass die Entnazifizierung bereits erfolgreich abgeschlossen sei, weshalb man keinen weiteren Forschungsbedarf sah.
Was änderte sich nach dem Zusammenbruch der DDR 1989?
Durch die Öffnung der Archive konnten Historiker erstmals detailliert untersuchen, ob die Entnazifizierung geplanten stalinistischen Umstrukturierungen folgte oder eher spontan verlief.
- Citar trabajo
- Carina Bornhäusser (Autor), 2006, Die Entnazifizierung in der SBZ 1945-1948, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91097