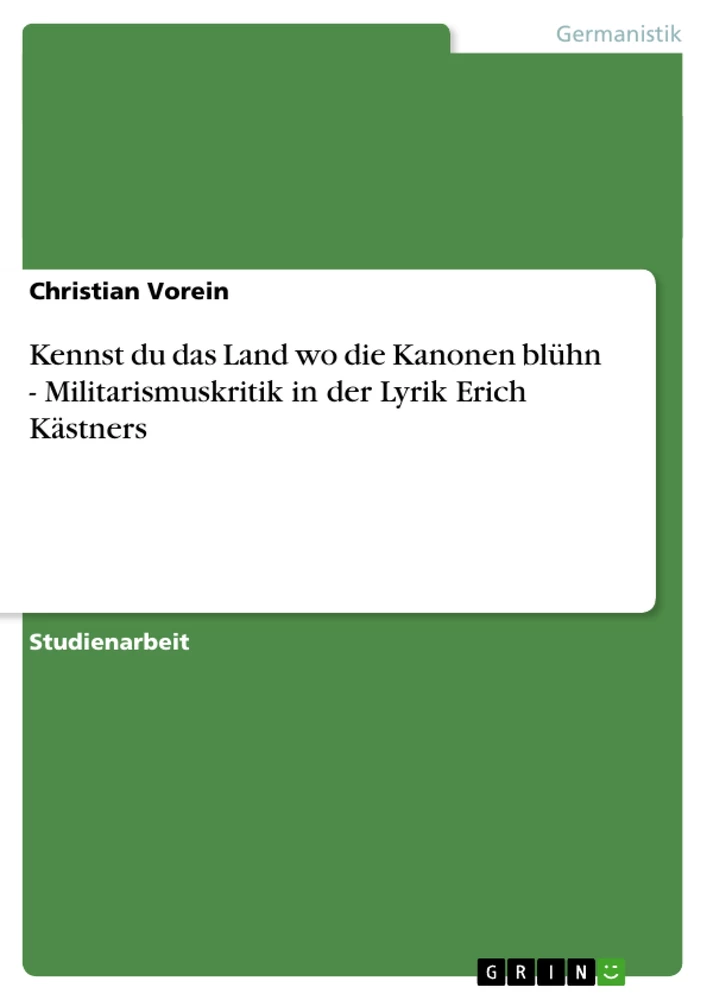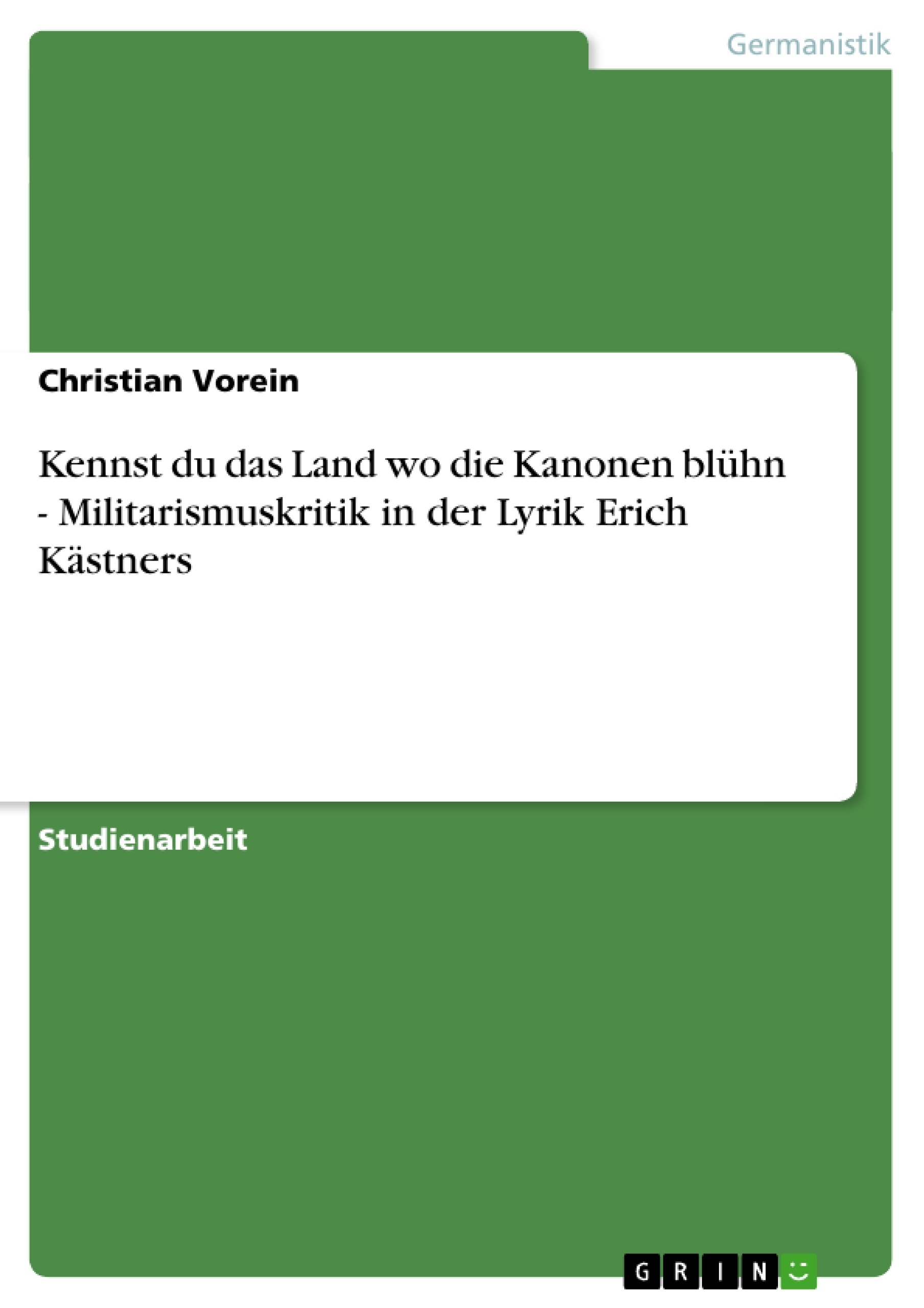Die Arbeit bietet einen kurzen Überblick über die Einflussfaktoren auf Kästners Lyrik (Lebenslauf, Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit) und versucht, die Hauptkritikpunkte seiner lyrischen Militarismuskritik aus der Opferperspektive (Überlebende und Tote) und der Täterperspektive (Kirche, Schule, Militär, Industrielle) zu charakterisieren. In einem abschließenden Kapitel wird Kästners Gebrauchslyrik anhand zeitgenössischer und aktueller Kritiken beurteilt. Dabei wird gesondert auf Kästners Weltsicht eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prolegomena zum Werk Kästners
- 2.1. „Kurzgefaßter Lebenslauf“ bis 1933
- 2.2. Weimarer Republik - Versuche, eine Gesellschaft zu ändern
- 2.3. Neue Sachlichkeit
- 2.4. Kästners Gebrauchslyrik
- 2.5. Die vier Gedichtbände
- 3. Auseinandersetzung mit dem Militarismus
- 3.1. Opfer
- 3.1.1. Lost Generation - überlebende Opfer
- 3.1.2. Stimmen aus dem Massengrab - tote Opfer
- 3.2. Täter
- 3.2.1. „Verlaßt Euch nie auf Gott und seine Leute!“
- 3.2.2. Staatliche Institutionen (Schule, Militär) und ihre militaristischen Vertreter
- 3.2.3. Ansprache an Millionäre
- 3.2.4. Hände an die Hosennaht! - Die Untertanen
- 3.3. Zusammenfassung
- 3.1. Opfer
- 4. Gebrauchslyrik ohne Gebrauchswert?
- 4.1. Wirkung und Wirkungslosigkeit - Kritikerstimmen
- 4.2. Der „Kästnerton“
- 4.3. Die Weltsicht Kästners in der Lyrik
- 4.4. Die Weltsicht Kästners in der Militarismuskritik
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die antimilitaristische Lyrik Erich Kästners im Kontext der Weimarer Republik. Ziel ist es, die Hauptkritikpunkte in Kästners Gedichten zu identifizieren und die Wirkungsmechanismen seiner Lyrik im Hinblick auf die Bekämpfung des Militarismus zu analysieren.
- Die Sozialisation und der Einfluss der Weimarer Republik auf Kästners Werk
- Die Entwicklung und die Charakteristika von Kästners Gebrauchslyrik
- Die Rolle der Opfer und Täter im Kontext des Militarismus in Kästners Gedichten
- Die Kritik an den staatlichen Institutionen und deren Vertreter
- Die Wirksamkeit und die Kritik an Kästners antimilitaristischer Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Erich Kästners Werk im Kontext der Weimarer Republik. Im Kapitel 2 werden die prägenden Faktoren von Kästners Schreibstil untersucht: seine Sozialisation, die kulturellen Wirkungsbedingungen in der Weimarer Republik und die „Neue Sachlichkeit“. Kapitel 3 widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Militarismus in Kästners Lyrik und untersucht die Hauptkritikpunkte, die Verantwortlichen und Lösungsvorschläge des Autors. In Kapitel 4 wird die Wirkung und Wirkungslosigkeit von Kästners Lyrik beleuchtet sowie die Frage nach dem „Gebrauchswert“ seiner Gedichte diskutiert.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Weimarer Republik, Militarismuskritik, Gebrauchslyrik, Neue Sachlichkeit, Opfer, Täter, Staatliche Institutionen, Kritikerstimmen, Weltsicht, Wirkungsmechanismen
- Citar trabajo
- Christian Vorein (Autor), 2002, Kennst du das Land wo die Kanonen blühn - Militarismuskritik in der Lyrik Erich Kästners, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9108