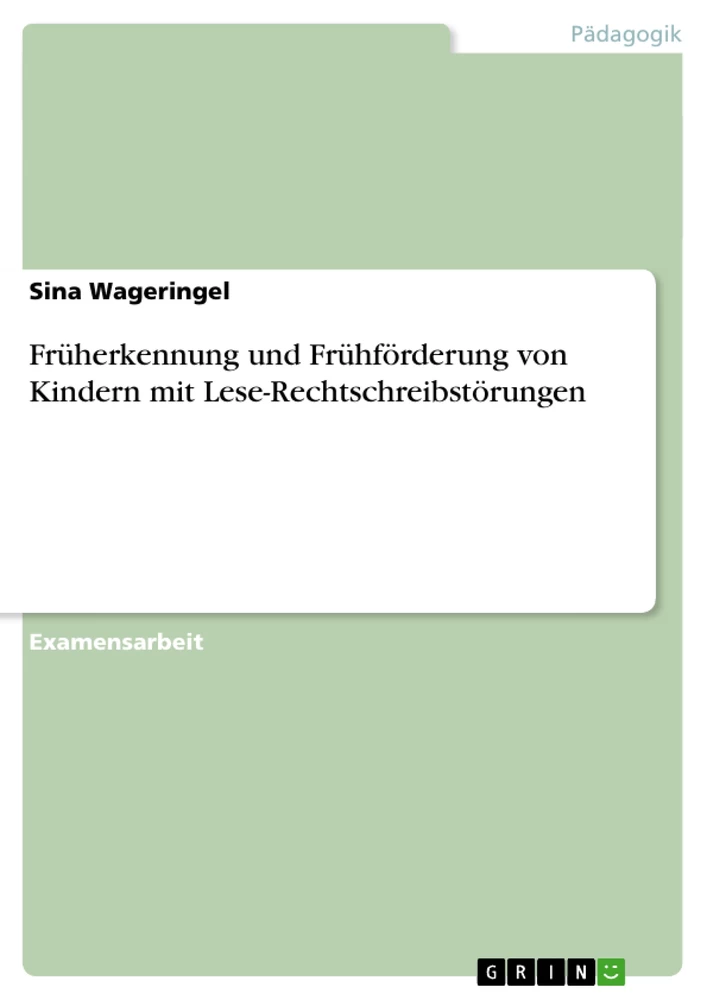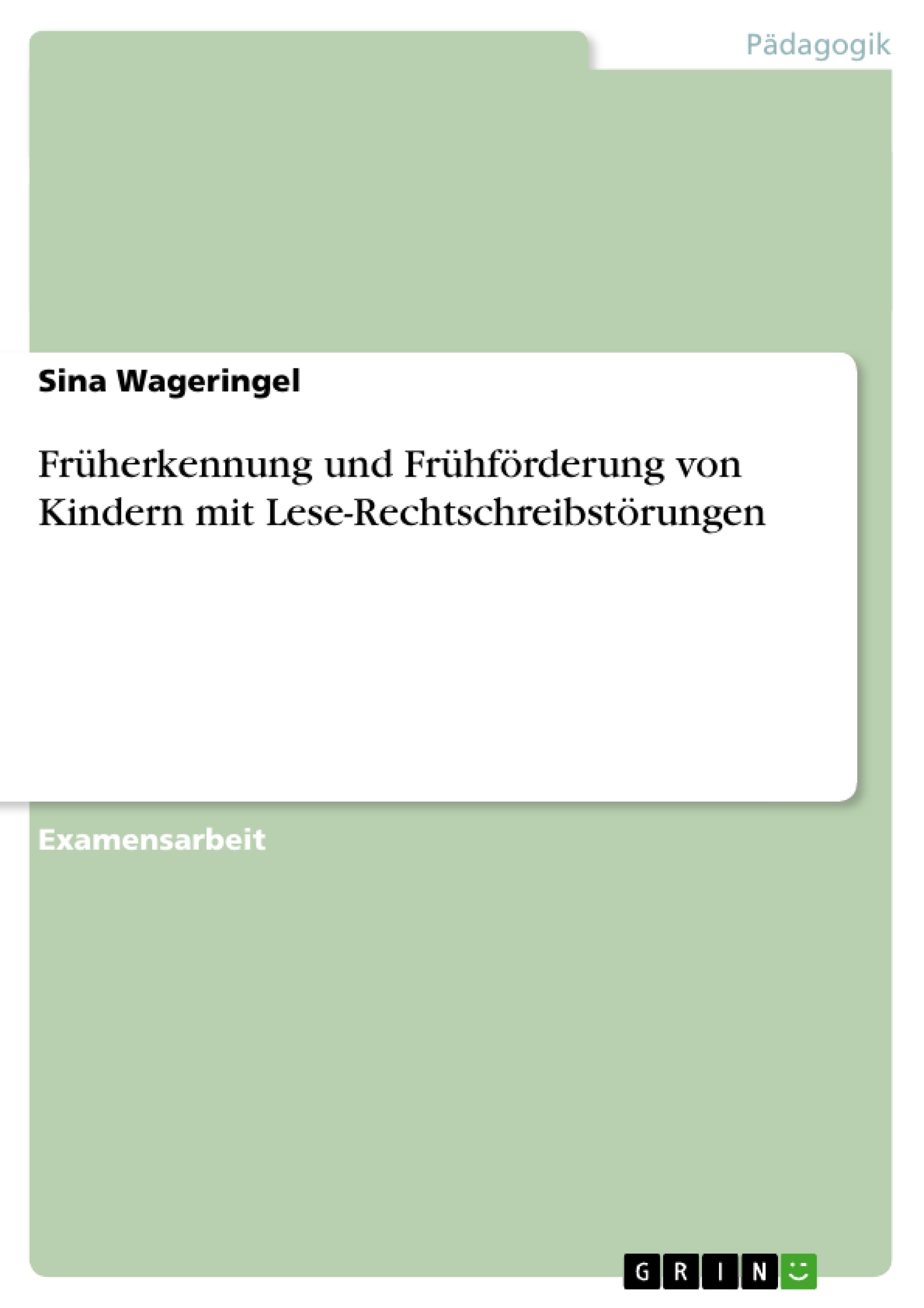Die Fertigkeiten des Lesens und Schreibens nehmen in unserer Gesellschaft einen besonderen Stellenwert ein. Sie gelten als grundlegende Kulturtechniken und helfen den Menschen, die Anforderungen des alltäglichen Lebens − sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich – zu bewältigen.
Für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten gibt es verschiedene Ursachen. Ein besonderes Problem stellt die „Umschriebene Lese- und Rechtschreibstörung“ (Legasthenie) dar, auf welche ich in dieser Arbeit näher eingehen werde. Bei einer Lese-Rechtschreibstörung bestehen ausgeprägte, spezifische Schwierigkeiten, die den Lernprozess des Lesens und Schreibens verzögern bzw. beeinträchtigen. In der „internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten“ (ICD-10), einem international anerkannten Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), gilt die Lese-Rechtschreibstörung als eine „umschriebene
Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten“ (vgl. Warnke, Hemminger, Roth & Schneck, 2002, S. 14).
Erfahrungsgemäß sind die betroffenen Kinder nicht etwa dumm oder faul,
sondern ihre Intelligenz liegt oft sogar weit oberhalb des Durchschnitts und steht in Diskrepanz zu ihren Lese- und Rechtschreibleistungen. Diese Kinder bedürfen einer speziellen Diagnostik und individuellen Förderung (a.a.O., S. 38, 90).
Aber wie kann man den betroffenen Kindern rechtzeitig helfen? Gibt es geeignete Möglichkeiten zur Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Lese-
Rechtschreibstörungen? Mit diesen Fragestellungen werde ich mich im Verlauf der vorliegenden Arbeit auseinandersetzen. Dabei beziehe ich mich vorwiegend auf die Früherkennung und Frühförderung im Vorschulalter sowie in den ersten beiden Jahrgangsstufen der Grundschule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Störung
- Begriffsbestimmung und Klassifikation
- Symptome
- Frühe Anzeichen vor Beginn der Schulzeit
- Symptome der Lesestörung
- Symptome der Rechtschreibstörung
- Begleitstörungen
- Ursachenannahmen
- Besonderheiten visueller Informationsverarbeitung
- Besonderheiten akustischer und sprachlicher Informationsverarbeitung
- Genetische Einflüsse
- Umwelteinflüsse und psychosoziale Faktoren
- Früherkennung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen
- Früherkennung von Kindern mit Risikofaktoren
- Die „Differenzierungsprobe“
- Das „Bielefelder Screening“
- Untersuchung der Lernvoraussetzungen
- Anamnese
- Differentialdiagnostik im Schulalter durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Überprüfung der intellektuellen Leistungsfähigkeit
- Überprüfung der Lese-Rechtschreibfertigkeit
- Körperliche Untersuchung
- Einschätzung psychischer Begleitsymptome
- Diagnosestellung
- Spezielle Testverfahren zur Früherkennung einer Lese-Rechtschreibstörung
- Der „Salzburger Lese- und Rechtschreibtest“
- Die „Würzburger Leise Leseprobe“
- Früherkennung von Kindern mit Risikofaktoren
- Frühförderung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen
- Prävention und Frühförderung vor Beginn der Schulzeit
- Hinweise zur frühen Prävention
- Das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“
- Fördermöglichkeiten und Hilfen im Schulalter
- Fördermöglichkeiten und Hilfen im schulischen Bereich
- Fördermöglichkeiten und Hilfen im außerschulischen Bereich
- Umgang mit den betroffenen Kindern
- Spezielle Förderprogramme zur Behandlung einer Lese-Rechtschreibstörung
- Der „Kieler Leseaufbau“
- Hinweise auf weitere Verfahren
- Prävention und Frühförderung vor Beginn der Schulzeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen Aspekte dieser Thematik zu beleuchten und hilfreiche Ansätze für die Praxis aufzuzeigen.
- Definition und Klassifikation von Lese-Rechtschreibstörungen
- Symptome und Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen
- Möglichkeiten zur Früherkennung im Vorschul- und Grundschulalter
- Präventions- und Fördermaßnahmen im schulischen und außerschulischen Bereich
- Spezielle Förderprogramme für Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Lesens und Schreibens in unserer Gesellschaft erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen, die Lese-Rechtschreibschwierigkeiten für betroffene Kinder darstellen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffsbestimmung und Klassifikation von Lese-Rechtschreibstörungen. Es werden verschiedene Symptome, Ursachen und mögliche Begleitstörungen beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt das Thema der Früherkennung von Lese-Rechtschreibstörungen. Es werden verschiedene Verfahren vorgestellt, die eine frühzeitige Identifizierung von Risikofaktoren ermöglichen.
Kapitel 4 befasst sich mit Präventions- und Fördermaßnahmen im Schulalter. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die betroffenen Kindern unterstützen können.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Lese-Rechtschreibstörung, Früherkennung, Frühförderung, Prävention, Förderprogramme, Symptome, Ursachen, Diagnose, Schriftspracherwerb, Grundschule, Vorschule.
- Quote paper
- Sina Wageringel (Author), 2006, Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91087