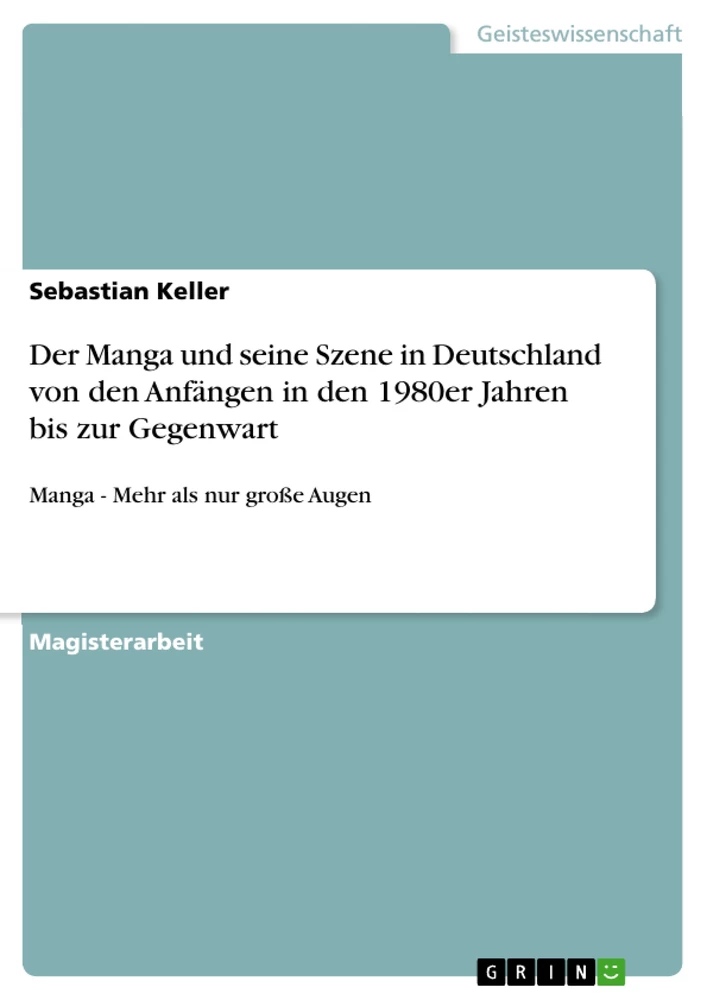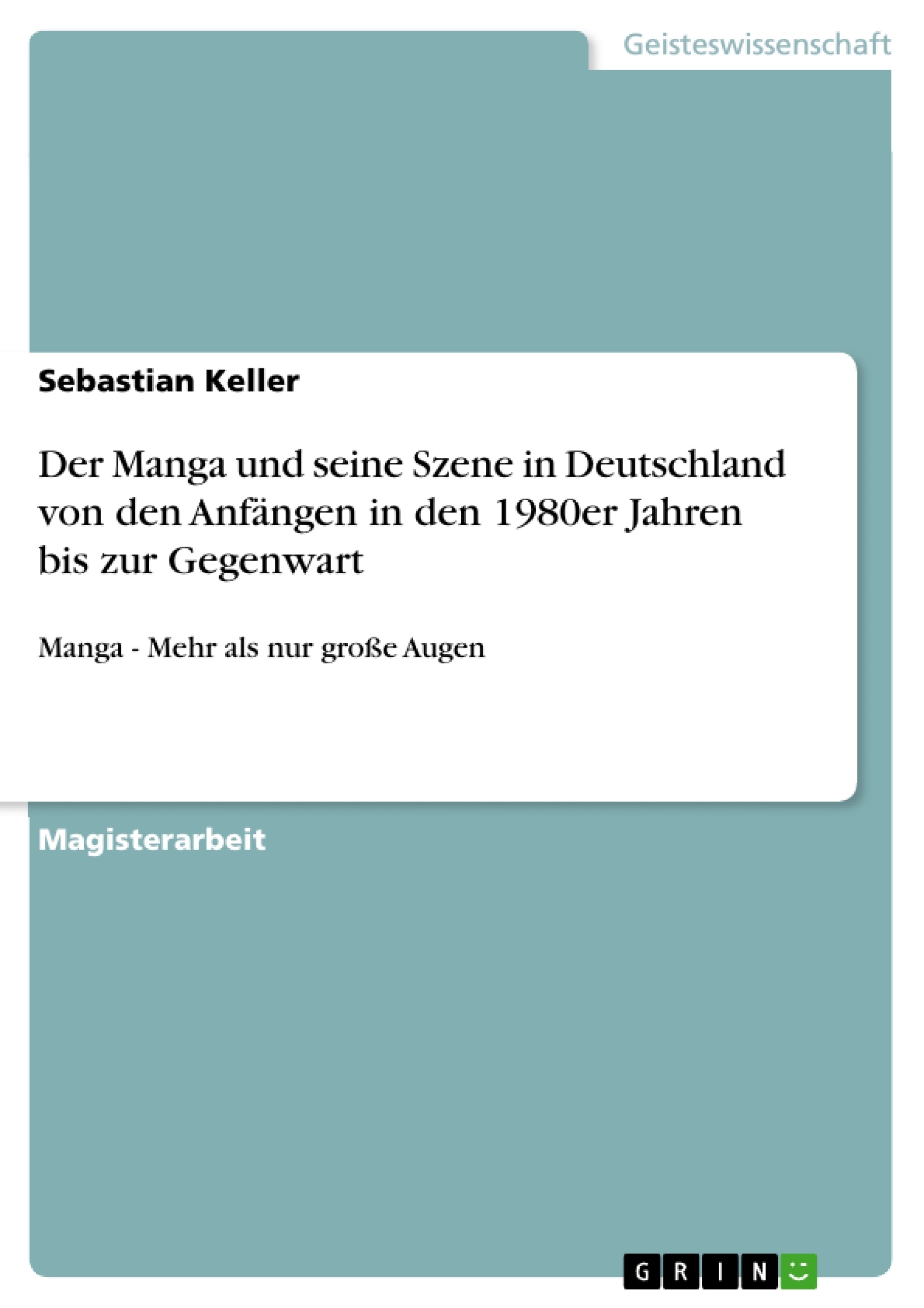Die vorliegende Arbeit wirft einen Blick auf die Szene um den Manga in Deutschland und beleuchtet die ihr innewohnenden Triebkräfte und die Protagonisten. Um die nötigen Grundlagen zu schaffen, wird die Geschichte des Manga unter besonderer Berücksichtigung des Manga in Deutschland ab den 1980ern vorangestellt.
Daraufhin werden die in Deutschland erhältliche Manga gegliedert und in ihren Rollenbildern eingeordnet. Kern der Arbeit ist aber der Mangaleser und seine Motivation sich auch über den Manga hinaus mit Japanischer oder generell asiatischer Kultur zu beschäftigen. Aus dieser Beschäftigung entwickelt sich eine eigene Subkultur, die viel mit anderen Jugendkulturen gemein hat.
Mit dem erneuten Erscheinen von ‚Barfuß durch Hiroshima’ in den Jahren 2004/ 2005 im Carlsen Verlag schließt sich der Kreis, den diese Arbeit zu umfassen versucht. Waren in den vorangegangenen Jahren einige Verlage in Konkurs gegangen oder von größeren Konkurrenten übernommen worden, so gab es nun die erste Neugründung eines unabhängigen deutschen Mangaverlages (Tokyopop) und eine gewisse Konsolidierung in der Szene.
Inhaltsverzeichnis
- 1. 1982: „Barfuss durch Hiroshima“, der erste Manga in Deutschland
- 1.1. Fragestellung und Relevanz
- 1.2. Methoden und Vorgehensweise
- 1.3. Forschungsstand
- 1.4. Das Medium Comic und die Spezifik des Manga
- 1.4.1. Andere asiatische Comics
- 1.4.2. Vorstufen des Manga bis ins 18. Jh.
- 1.4.3. Westliche Einflüsse und die Geburt des Manga im 19. Jh.
- 1.4.4. Die ersten Manga in den USA – die 60er und 70er
- 1.4.5. Manga in Europa – die 70er und 80er Jahre
- 2. Der Manga in Deutschland, seine Leser und ihre Aktivitäten
- 2.1. (Fernseh)animes als Wegbereiter des Manga schon vor 1982
- 2.2. Geschichte und Verbreitungswege des Manga in Deutschland
- 2.2.1. „Hadashi no Gen“ wandert 1982 nach Deutschland - barfuß!
- 2.2.2. „Genji Monogatari Asakiyumemishi“ – Späte Liebe im Jahr 1992
- 2.2.3. Doujinshi – Deutsche Eigenproduktionen schleichen sich ein
- 2.3. Typen und Rollen im Manga
- 2.3.1. Mangatypen
- 2.3.1.1. ‚Shonen Ai’ – Jungenliebe für Mädchen
- 2.3.1.2. ‚Hentai’ – die japanische Art des Porno Comics
- 2.3.1.3. ‚Magical Girl’ – Sailor Moon und ihre Schwestern
- 2.3.1.4. ‚Sachmanga’ – Delectare et prodesse im Comic
- 2.3.1.5. ‚Jidai’ - Historische Stoffe in allerlei Gewand
- 2.3.1.6. ‚Sweet’ – Kindchenschema mit Zuckerglasur
- 2.3.1.7. ‚konjo’ – Wettbewerb im und außerhalb des Manga
- 2.3.1.8. ‚Dojinshi’ – Von Fans für Fans
- 2.3.1.9. ‚Comedy’ – Humor teilbar durch vier
- 2.3.1.10. ‚Mecha’ – Große Maschinen für kleine Jungs
- 2.3.1.11. Andere
- 2.3.2. Auto- und Heterostereotype
- 2.3.3. Magical Girl, Samurai und andere Rollen
- 2.3.3.1. Kawaii! Mädchen im Manga
- 2.3.3.1.1 Deformiert und dennoch süß
- 2.3.3.1.2. Senshi – die Menge macht’s
- 2.3.3.1.3. Warten auf den Märchenprinz
- 2.3.3.1.4. Leben ohne Prinzen
- 2.3.3.2. Banzai! Jungen im Manga
- 2.3.3.2.1. Ein Junge wie ein Pferd
- 2.3.3.2.2. Gruppen auf dem Spielfeld und darüber hinaus
- 2.3.3.2.3. Der Held und sein Begleiter
- 2.3.3.2.4. Der Einzelgänger
- Exkurs: Schmerz
- 2.3.3.3. Das Bild vom anderen Geschlecht
- 2.3.3.3.1 Weibliche Protagonisten
- 2.3.3.3.2 Weibliche Statisten
- 2.3.3.1. Kawaii! Mädchen im Manga
- 2.4. Manga als alters- und geschlechtsgebundenes Medium?
- 2.4.1. Überlegungen zu Jugendkultur und -szene
- 2.4.2. Altersbedingte Unterschiede im Leseverhalten
- 2.4.3. Manga für Erwachsene?
- 2.4.4. Mädchen lieben Jungenliebe – Das Phänomen Shonen Ai
- 2.4.4.1. Darstellungsweise
- 2.4.4.2. Inhalt und Bedeutung
- 2.5. Conventions: Eine Bühne für Fans
- 2.5.1. Grundlegendes zu Conventions
- 2.5.2. Karneval mitten im Jahr?
- 2.5.3. Ausdrucksformen von Mangalesern
- 2.6. Leser, Fan oder Otaku?
- 2.6.1. Typologie der Mangaleser
- 2.6.2. Wertigkeiten bei den Lesern
- 2.6.3. Gestaltung des Privaten
- 2.6.4. Fanclubs und das Internet
- 3. Zusammenfassung
- 3.1. Japan und die Macht der Bilder
- 3.2. Veränderung der Lese- und Lebensgewohnheiten
- 3.3. Ausblick und Problematisierung
- 4. Glossar
- 5. Bibliographie
- 5.1. Publikationen
- 5.2. Video, DVD, Fernsehen & Radio
- 5.3. Internet
- 5.3.1. Verlage
- 5.3.2. Organisationen
- 5.3.3. Übersichten
- 5.3.4. Doujinshi
- 5.3.5. Sonstiges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Rezeption von Manga in Deutschland. Ziel ist es, die Wertigkeiten und kulturellen Praktiken der Manga-Leserschaft zu analysieren und deren „Kultur“ zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Szene seit den 1980er Jahren bis zur Gegenwart, wobei „Barfuss durch Hiroshima“ als ein zentraler Bezugspunkt dient.
- Entwicklung des Manga in Deutschland
- Typologisierung von Manga und deren Leser
- Rollenbilder und Stereotype in Manga
- Manga als Ausdruck von Jugendkultur
- Die Bedeutung von Conventions und Online-Communities
Zusammenfassung der Kapitel
1. 1982: „Barfuss durch Hiroshima“, der erste Manga in Deutschland: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es die Einführung von Manga in Deutschland mit der Veröffentlichung von „Barfuss durch Hiroshima“ im Jahr 1982 beleuchtet. Es analysiert die anfängliche Rezeption des Werkes im Kontext der damaligen politischen und gesellschaftlichen Stimmung, besonders die Angst vor Atomkrieg und der wachsenden wirtschaftlichen Macht Japans. Die ungewöhnliche, zunächst als „unattraktiv“ empfundene, Zeichenstil wird im Kontext der japanischen Comic-Tradition und im Vergleich zum westlichen Comic diskutiert. Der Kapitel beleuchtet auch die Entstehung von „Project Gen“, der Organisation die zur Übersetzung und Verbreitung des Mangas beitrug.
2. Der Manga in Deutschland, seine Leser und ihre Aktivitäten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung von Manga in Deutschland, beginnend mit dem Einfluss von Animeserien im Fernsehen. Es wird die chronologische Entwicklung des Mangamarktes beschrieben, von frühen, wenig beachteten Titeln bis zum Boom der 1990er Jahre und der Etablierung großer Verlage. Die unterschiedlichen Verbreitungswege (Verlage, Import, Scanlations) und die Entwicklung von Fan-Communities werden analysiert. Schließlich werden quantitative und qualitative Daten zum Leseverhalten, der Altersstruktur und den geschlechtsspezifischen Präferenzen der Leserschaft präsentiert.
2.1. (Fernseh)animes als Wegbereiter des Manga schon vor 1982: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Fernsehens bei der frühen Verbreitung von Anime und Manga in Deutschland. Es zeigt auf, wie billige Anime-Produktionen aus Japan zunächst den deutschen Fernsehmarkt füllten und mit umfassender Merchandising-Strategien verbunden waren (Beispiel: Heidi). Später werden Animeserien (z.B. Captain Future, Akira, Sailor Moon) als Wegbereiter für das Interesse an Manga hervorgehoben. Die unterschiedliche Rezeption von Animes im deutschen und französischen Fernsehen wird in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert.
2.2. Geschichte und Verbreitungswege des Manga in Deutschland: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Darstellung der Geschichte des Mangas in Deutschland, beginnend mit seiner späten Einführung in den 1980er Jahren und dem langsamen Wachstum der Szene in den 1990er Jahren. Es wird die Rolle wichtiger Verlage (Carlsen, Egmont Ehapa, Panini, Tokyopop) und die Entwicklung von Conventions analysiert. Die Verbreitung von Manga wird anhand von drei Fallstudien (‚Hadashi no Gen’, ‚Genji Monogatari’, Doujinshi) illustriert und der Einfluss der japanischen Mangaproduktion und deren Vertriebsstrategien diskutiert. Das Kapitel enthält auch eine Grafik zur Anzahl der in Deutschland erschienenen Mangaserien über die Jahre.
2.3. Typen und Rollen im Manga: Dieses Kapitel typologisiert Manga anhand formaler Kriterien (Panelzahl, Seitenumfang) und thematischer Kategorien (Shonen, Shojo, Seinen, Josei, Hentai, etc.), wobei die oft fließenden Übergänge zwischen den Genres hervorgehoben werden. Es werden auch typische Rollenbilder in Shonen- und Shojo-Manga analysiert, unter Berücksichtigung des „Kawaii“-Konzepts, der Darstellung von weiblichen und männlichen Protagonisten und der Frage nach der Darstellung von Gewalt und Sexualität.
2.4. Manga als alters- und geschlechtsgebundenes Medium?: Dieses Kapitel untersucht die Leserschaft von Manga in Deutschland anhand von statistischen Daten (Fragebögen, Marktforschung) und interpretiert diese im Kontext von Altersgruppen und Geschlechterrollen. Es werden unterschiedliche Studien verglichen und die Schwierigkeiten bei der Erhebung verlässlicher Daten hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen Manga-Rezeption und Jugendkultur wird diskutiert, wobei auch die Entwicklung in anderen europäischen Ländern Berücksichtigung findet.
2.5. Conventions: Eine Bühne für Fans: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der Manga- und Anime-Conventions in Deutschland. Es beschreibt die Struktur und das Angebot dieser Veranstaltungen (Händler, Workshops, Cosplay-Wettbewerbe) und analysiert die Rolle des Cosplays als Ausdruck von Identität und der Möglichkeit zur Interaktion mit Gleichgesinnten. Die Entwicklung der Conventions über die Jahre und die Zunahme von jüngeren Besuchern wird ebenfalls thematisiert.
2.6. Leser, Fan oder Otaku?: Dieses Kapitel beleuchtet die Identitätsfindung der Manga-Leserschaft und die Verwendung des Begriffs „Otaku“. Es wird zwischen verschiedenen Typen von Manga-Lesern differenziert (passive Leser, aktive Fans, Otaku) und die Bedeutung von Online-Communities und Fanclubs beschrieben. Die Rolle des Internets für die Kommunikation und den Austausch unter Manga-Fans wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Manga, Anime, Japan, Deutschland, Jugendkultur, Leseverhalten, Rollenbilder, Stereotype, Conventions, Online-Communities, Otaku, Scanlations, Doujinshi, Shonen Ai, Hentai, Genre, Rezeption, Kulturtransfer.
Häufig gestellte Fragen zu: Manga in Deutschland - Rezeption und kulturelle Praktiken
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Rezeption von Manga in Deutschland seit den 1980er Jahren. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wertigkeiten und kulturellen Praktiken der Manga-Leserschaft sowie der Beschreibung ihrer „Kultur“. "Barfuss durch Hiroshima" dient als wichtiger Bezugspunkt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Mangas in Deutschland, die Typologisierung von Manga und deren Lesern, Rollenbilder und Stereotype in Manga, Manga als Ausdruck von Jugendkultur, die Bedeutung von Conventions und Online-Communities sowie die Entwicklung der Szene von den 1980ern bis zur Gegenwart.
Welche Rolle spielt "Barfuss durch Hiroshima"?
"Barfuss durch Hiroshima" wird als der erste Manga in Deutschland betrachtet und seine Einführung im Jahr 1982 im Kontext der damaligen politischen und gesellschaftlichen Stimmung analysiert. Seine Rezeption und der ungewöhnliche Zeichenstil werden im Vergleich zum westlichen Comic diskutiert.
Wie wird die Verbreitung von Manga in Deutschland dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die chronologische Entwicklung des Mangamarktes, die Rolle wichtiger Verlage, verschiedene Verbreitungswege (Verlage, Import, Scanlations) und die Entwicklung von Fan-Communities. Drei Fallstudien (‚Hadashi no Gen’, ‚Genji Monogatari’, Doujinshi) illustrieren die Verbreitung.
Wie werden Mangatypen und Rollenbilder kategorisiert?
Manga wird anhand formaler Kriterien und thematischer Kategorien (Shonen, Shojo, Seinen, Josei, Hentai etc.) typologisiert. Typische Rollenbilder in Shonen- und Shojo-Manga werden analysiert, unter Berücksichtigung des „Kawaii“-Konzepts und der Darstellung von Gewalt und Sexualität.
Wie wird die Leserschaft von Manga charakterisiert?
Die Arbeit untersucht die Leserschaft anhand statistischer Daten und interpretiert diese im Kontext von Altersgruppen und Geschlechterrollen. Es wird zwischen verschiedenen Typen von Manga-Lesern differenziert (passive Leser, aktive Fans, Otaku) und die Bedeutung von Online-Communities und Fanclubs beschrieben.
Welche Rolle spielen Conventions und Online-Communities?
Die Arbeit beschreibt die Struktur und das Angebot von Manga- und Anime-Conventions, analysiert die Rolle des Cosplays und thematisiert die Entwicklung der Conventions über die Jahre und die Zunahme jüngerer Besucher. Die Rolle des Internets für die Kommunikation und den Austausch unter Manga-Fans wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Manga, Anime, Japan, Deutschland, Jugendkultur, Leseverhalten, Rollenbilder, Stereotype, Conventions, Online-Communities, Otaku, Scanlations, Doujinshi, Shonen Ai, Hentai, Genre, Rezeption und Kulturtransfer.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Publikationen, Video-, DVD-, Fernseh- und Radiomaterial sowie Internetquellen, einschließlich Verlage, Organisationen, Übersichten, Doujinshi und sonstige relevante Webseiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den Anfängen des Manga in Deutschland (mit "Barfuss durch Hiroshima" als Fallbeispiel), der Entwicklung der Szene, den verschiedenen Mangatypen und -rollen, der Leserschaft und deren Aktivitäten (inkl. Conventions), einer Zusammenfassung, einem Glossar und einer Bibliographie.
- Quote paper
- Sebastian Keller (Author), 2006, Der Manga und seine Szene in Deutschland von den Anfängen in den 1980er Jahren bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91074