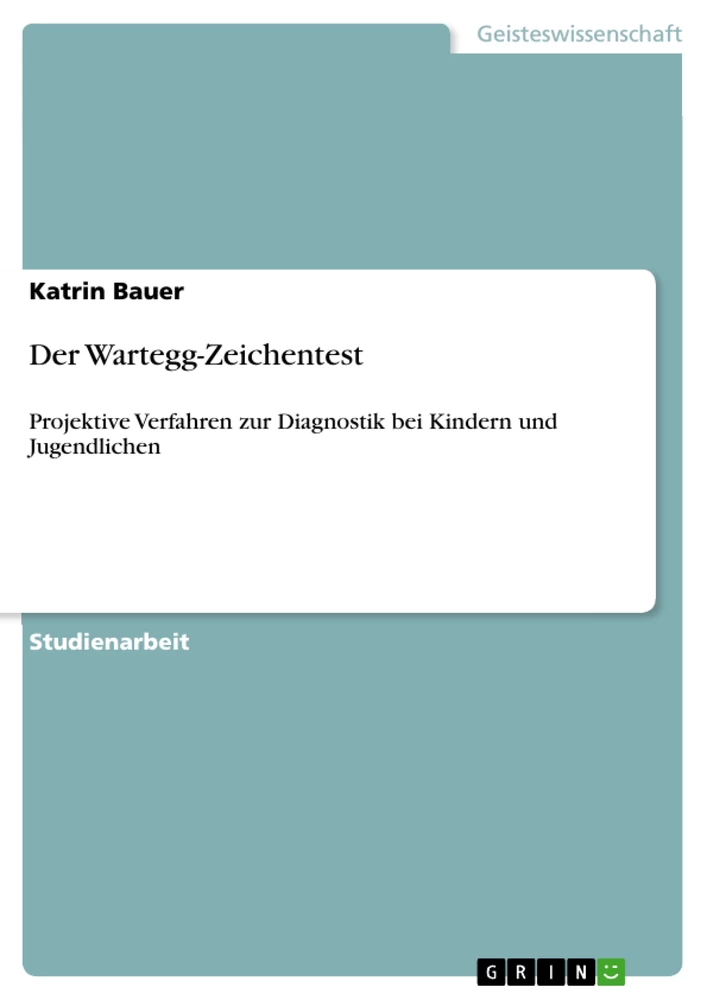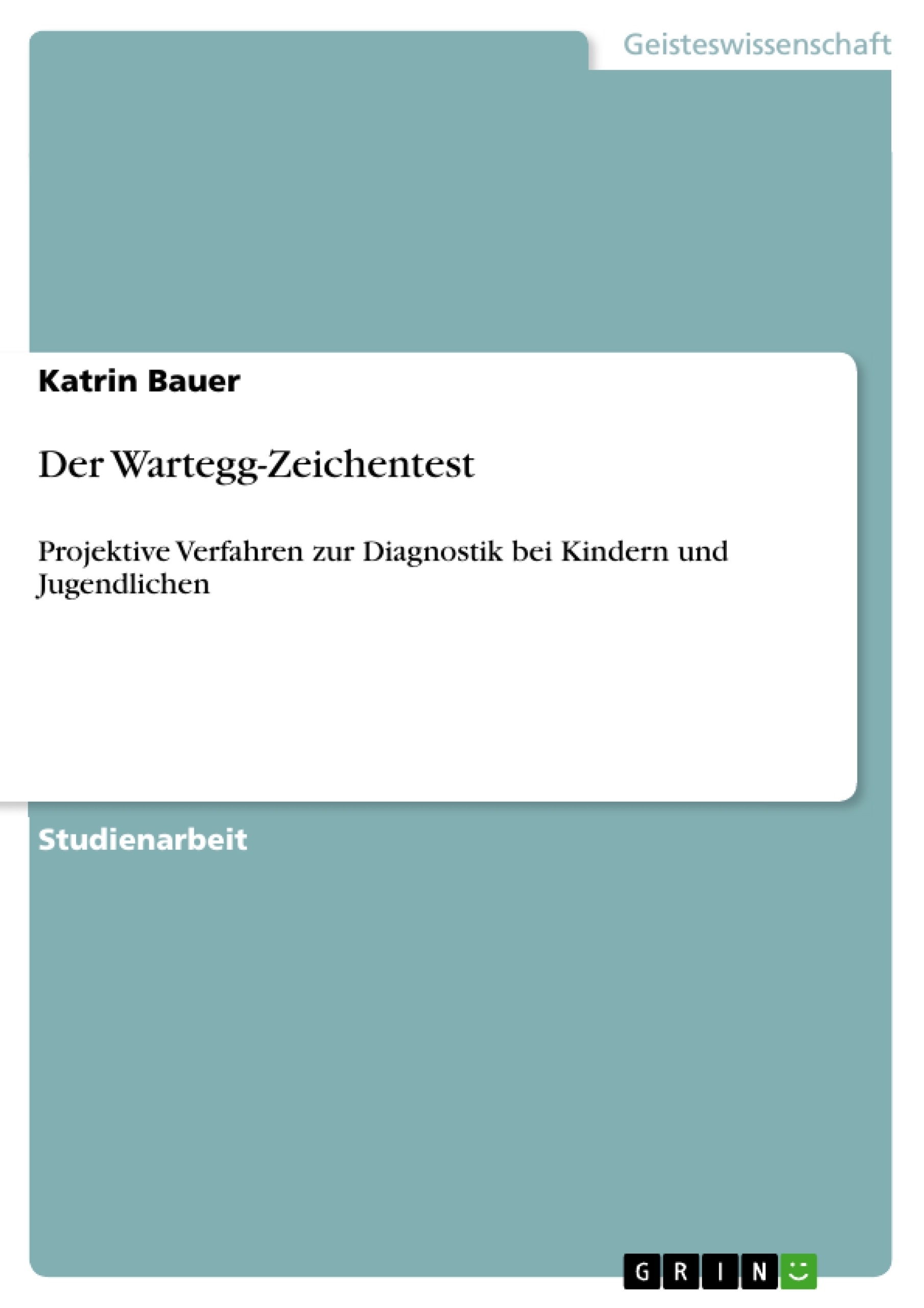Projektive Verfahren zur Diagnostik sind ebenso verbreitet wie umstritten. In der Behandlung Erwachsener spielen sie heute eher eine untergeordnete Rolle. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie werden sie dagegen häufig angewandt. Eines dieser Verfahren ist der Wartegg-Zeichen-Test.
Wider Erwarten gibt es nur wenig und zudem kaum neuere Literatur zu diesem Test.
Im Folgenden werden zunächst der Entwicklungshintergrund projektiver Verfahren, ihre Grenzen und Möglichkeiten sowie ihre Anwendungsbereiche dargestellt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit befasst sich mit dem Wartegg-Zeichentest. Es werden seine theoretischen Grundlagen, Intentionen und Anwendungsbereiche sowie Testdurchführung und Auswertung beschrieben. Im Anschluss wird auf die Besonderheiten bei seiner Anwendung im Kinder- und Jugendbereich eingegangen sowie Kritik am Wartegg-Zeichentest diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Projektive Verfahren
- 2.1 Entwicklung
- 2.2 Grenzen und Möglichkeiten
- 2.3 Anwendungsbereiche projektiver Verfahren
- 3. Der Wartegg-Zeichentest
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Theoretische Grundlagen
- 3.3 Testdurchführung
- 3.4 Testauswertung
- 3.4.1 Formale Auswertung
- 3.4.1.1 Graphische Merkmale
- 3.4.1.2 Formbehandlung
- 3.4.1.3 Flächenbehandlung
- 3.4.1.3 Auffassung der Formqualitäten
- 3.4.2 Inhaltliche Auswertung
- 3.4.2.1 Inhaltliche Gesamtbetrachtung
- 3.4.2.2 Inhaltliche Einzelbetrachtung
- 3.4.1 Formale Auswertung
- 4. Anwendung bei Kindern und Jugendlichen
- 5. Kritik am Wartegg-Zeichentest
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Wartegg-Zeichentest, ein projektives Verfahren, das in der psychologischen Diagnostik, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, häufig eingesetzt wird. Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund projektiver Verfahren, untersucht ihre Grenzen und Möglichkeiten sowie ihre Anwendungsbereiche. Im Zentrum steht die Darstellung des Wartegg-Zeichentests, inklusive seiner theoretischen Grundlagen, seiner Anwendung in der Praxis sowie der Kritik an diesem Verfahren.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung projektiver Verfahren
- Grenzen und Möglichkeiten projektiver Verfahren in der psychologischen Diagnostik
- Der Wartegg-Zeichentest als ein Beispiel für ein projektives Verfahren
- Anwendungsbereiche des Wartegg-Zeichentests, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- Kritik am Wartegg-Zeichentest
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der projektiven Verfahren ein und stellt den Wartegg-Zeichentest als den Fokus dieser Arbeit vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung projektiver Verfahren im Kontext der Psychoanalyse und Gestaltpsychologie, wobei die Grenzen und Möglichkeiten dieser Verfahren sowie ihre Anwendungsbereiche erörtert werden. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf den Wartegg-Zeichentest, indem die theoretischen Grundlagen, Testdurchführung und -auswertung, einschließlich formaler und inhaltlicher Aspekte, detailliert betrachtet werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Anwendung des Wartegg-Zeichentests bei Kindern und Jugendlichen, während das fünfte Kapitel kritische Punkte zu diesem Test aufzeigt.
Schlüsselwörter
Projektive Verfahren, Wartegg-Zeichentest, Diagnostik, Kinder, Jugendliche, Psychoanalyse, Gestaltpsychologie, Testdurchführung, Testauswertung, Kritik, Anwendungsbereiche.
- Quote paper
- Katrin Bauer (Author), 2007, Der Wartegg-Zeichentest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91047