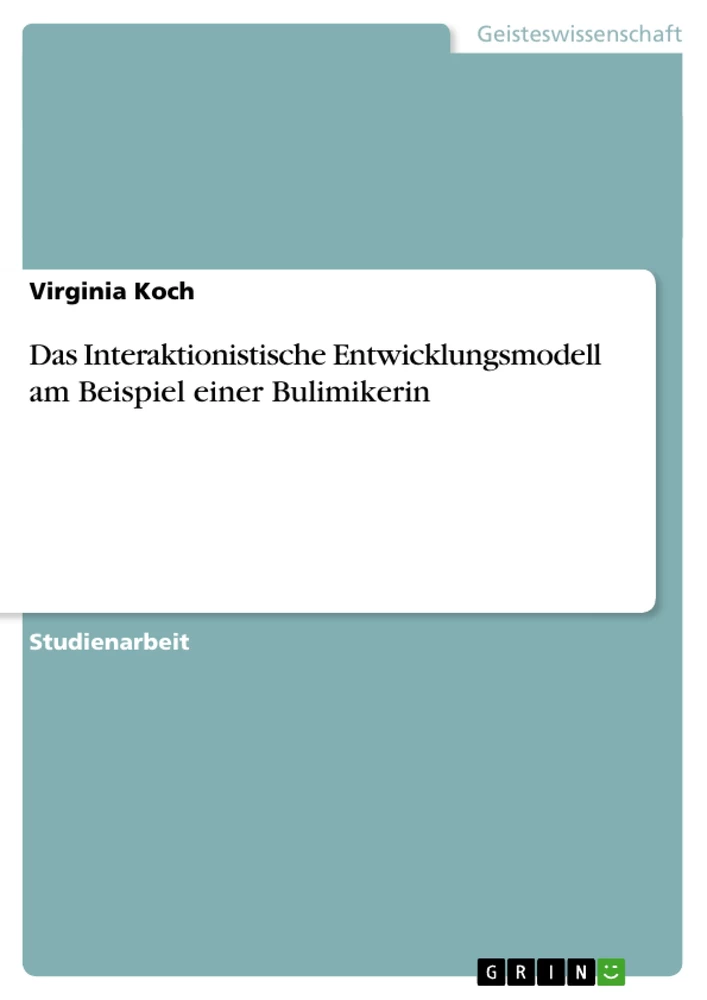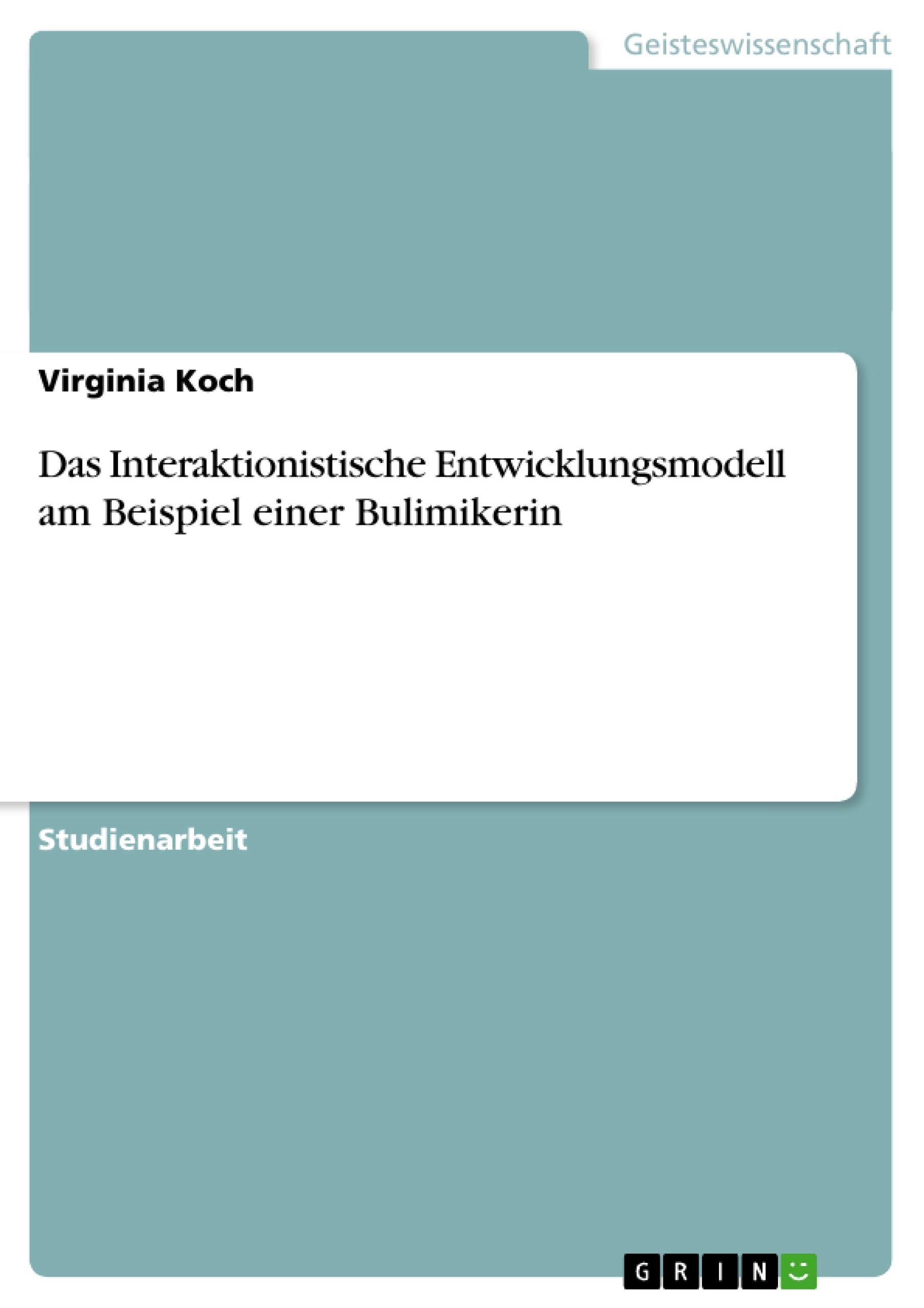Die Entwicklungspsychologie als Teildisziplin der Psychologie beschäftigt sich laut Schenk - Danzinger mit den Gesetzmäßigkeiten, „ …nach denen sich das Verhalten des Menschen sowie seine Denkformen, seine Wahrnehmung, seine Haltungen und Einstellungen, aber auch seine Leistungen im Laufe des Lebens verändern.“.
Laut momentanem Stand der Wissenschaft werden vier Grundüberzeugungen unterschieden, bei denen sowohl der Mensch als auch die Umwelt als aktiver oder passiver Part an der Entwicklung konzipiert werden. Es handelt sich dabei um Selbstgestaltungstheorien, Endo- bzw. Exogenistische Theorien und Interaktionistische Theorien.
Bei der letztgenannten Kategorie stehen Mensch und Umwelt in ständiger Wechselwirkung zueinander. Sowohl die Person als auch ihr Kontext sind aktiv an der Entwicklung beteiligt. Präformations, - und Milieutheoretiker sind sich uneins, wie viel Bedeutung den Erbanlagen einerseits und deren Beeinflussung durch auf sie wirkende Umweltbedingungen andererseits zukommt. Dass beide Größen eine Rolle spielen ist in der wissenschaftlichen Forschung unbestritten.
Inhalt:
Einleitung 3
1. Interaktionistische Entwicklungstheorie 4
1.1 Einordnung in die Metamodelle der Entwicklung 4
1.2 Wesentliche Aussagen des Interaktionistischen Entwicklungsmodells 4
1.3 Arten der Passung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt 5
2. Praxisbeispiel 6
3. Präventions - und Interventionsmaßnahmen 8
3.1 Präventionsmaßnahmen 8
3.2 Interventionsmaßnahmen 8
4. Fazit 9
Quellenverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interaktionistische Entwicklungstheorie
- Einordnung in die Metamodelle der Entwicklung
- Wesentliche Aussagen des Interaktionistischen Entwicklungsmodells
- Arten der Passung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt
- Praxisbeispiel
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Präventionsmaßnahmen
- Interventionsmaßnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der interaktionistischen Entwicklungstheorie und deren Anwendung auf ein Praxisbeispiel. Ziel ist es, die zentralen Aussagen des Modells zu erläutern und deren Relevanz für die Entwicklung des Menschen zu verdeutlichen. Dabei wird der Fokus auf die Wechselwirkung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt gelegt.
- Die interaktionistische Entwicklungstheorie und ihre Einordnung in verschiedene Entwicklungsmodelle.
- Die Bedeutung der Passung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt für die Entwicklung.
- Die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds in der Entwicklung.
- Anwendung der Theorie auf ein Praxisbeispiel einer jungen Frau mit Bulimie.
- Mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Entwicklungspsychologie ein und stellt verschiedene Grundüberzeugungen zur Entwicklung vor, darunter Selbstgestaltungstheorien, Endo- bzw. Exogenistische Theorien und Interaktionistische Theorien. Sie betont die ständige Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt und die Bedeutung beider Faktoren für die Entwicklung. Die Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Auseinandersetzung mit der interaktionistischen Entwicklungstheorie im Hauptteil der Arbeit.
1. Interaktionistische Entwicklungstheorie: Dieses Kapitel beschreibt die interaktionistische Entwicklungstheorie eingehend. Es ordnet sie in die Metamodelle der Entwicklung ein, wobei das dialektische Modell im Vordergrund steht, das einen sich verändernden Organismus in einer sich verändernden Welt postuliert. Das Kapitel erläutert wesentliche Aussagen des Modells, wie z.B. die untrennbare Verbindung von Mensch und Umwelt, die Abhängigkeit der Entwicklung vom Subjekt und Kontext, sowie die Rolle der genetischen Ausstattung und der Umwelt. Es werden drei Arten der Passung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt differenziert: passive, evokative und aktive Genom-Umwelt-Passung. Die komplexe Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Faktoren und die Bedeutung der Familie werden hervorgehoben.
2. Praxisbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel einer jungen Frau mit Bulimie Nervosa. Es beschreibt ihren aktuellen Zustand, ihre soziale Isolation und die Schwierigkeiten beim Aufbau von Vertrauen. Das Kapitel dient als Grundlage für die Anwendung der interaktionistischen Entwicklungstheorie und die Erörterung möglicher Ursachen für die Entstehung der Erkrankung im Kontext der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt.
3. Präventions- und Interventionsmaßnahmen: Dieses Kapitel befasst sich mit möglichen Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Es bietet einen Überblick über Strategien und Methoden, die helfen können, negative Entwicklungsverläufe zu verhindern oder zu korrigieren und positive Entwicklungsprozesse zu fördern. Die Maßnahmen werden im Kontext des interaktionistischen Entwicklungsmodells betrachtet, das die Bedeutung der Berücksichtigung individueller Faktoren und des sozialen Kontextes unterstreicht.
Schlüsselwörter
Interaktionistische Entwicklungstheorie, Genom-Umwelt-Passung, Entwicklungspsychologie, Familie, Umwelt, Bulimie Nervosa, Prävention, Intervention, Wechselwirkung, Entwicklungsaufgaben, Genotyp, Phänotyp.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Interaktionistischen Entwicklungstheorie
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die interaktionistische Entwicklungstheorie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Interaktionistische Entwicklungstheorie, Praxisbeispiel, Präventions- und Interventionsmaßnahmen, Fazit) sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Wechselwirkung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt und deren Einfluss auf die menschliche Entwicklung, illustriert anhand eines Praxisbeispiels einer jungen Frau mit Bulimie.
Welche Entwicklungstheorie wird behandelt?
Das Dokument konzentriert sich auf die interaktionistische Entwicklungstheorie. Diese Theorie betont die ständige Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt als entscheidenden Faktor für die Entwicklung. Im Gegensatz zu rein endogenen oder exogenen Theorien, betont sie die untrennbare Verbindung von Mensch und Umwelt und die Bedeutung beider Faktoren für die Entwicklung.
Wie wird die interaktionistische Entwicklungstheorie eingeordnet?
Die interaktionistische Entwicklungstheorie wird im Kontext verschiedener Metamodelle der Entwicklung eingeordnet, wobei das dialektische Modell im Vordergrund steht. Dieses Modell postuliert einen sich verändernden Organismus in einer sich verändernden Welt. Es wird erklärt, wie sich die interaktionistische Perspektive von rein endogenen oder exogenen Ansätzen unterscheidet.
Welche Rolle spielen genetische Anlagen und Umwelt?
Das Dokument betont die entscheidende Rolle der Wechselwirkung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt. Es differenziert drei Arten der Passung zwischen Genotyp und Umwelt: passive, evokative und aktive Genom-Umwelt-Passung. Die komplexe Interaktion dieser Faktoren und die Bedeutung der Familie werden hervorgehoben.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Als Praxisbeispiel wird der Fall einer jungen Frau mit Bulimie Nervosa vorgestellt. Dieser Fall dient dazu, die Anwendung der interaktionistischen Entwicklungstheorie zu illustrieren und mögliche Ursachen für die Erkrankung im Kontext der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt zu erörtern. Die soziale Isolation und Schwierigkeiten im Aufbau von Vertrauen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Das Dokument beschreibt mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen, die helfen können, negative Entwicklungsverläufe zu verhindern oder zu korrigieren und positive Entwicklungsprozesse zu fördern. Diese Maßnahmen werden im Kontext des interaktionistischen Entwicklungsmodells betrachtet, welches die Berücksichtigung individueller Faktoren und des sozialen Kontextes betont.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Interaktionistische Entwicklungstheorie, Genom-Umwelt-Passung, Entwicklungspsychologie, Familie, Umwelt, Bulimie Nervosa, Prävention, Intervention, Wechselwirkung, Entwicklungsaufgaben, Genotyp, Phänotyp.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Interaktionistische Entwicklungstheorie (inkl. Einordnung in Metamodelle, wesentliche Aussagen und Arten der Passung), Praxisbeispiel (Bulimie), Präventions- und Interventionsmaßnahmen und Fazit.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist es, die zentralen Aussagen der interaktionistischen Entwicklungstheorie zu erläutern und deren Relevanz für die Entwicklung des Menschen zu verdeutlichen. Der Fokus liegt dabei auf der Wechselwirkung zwischen genetischen Anlagen und Umwelt.
- Quote paper
- Virginia Koch (Author), 2007, Das Interaktionistische Entwicklungsmodell am Beispiel einer Bulimikerin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91034