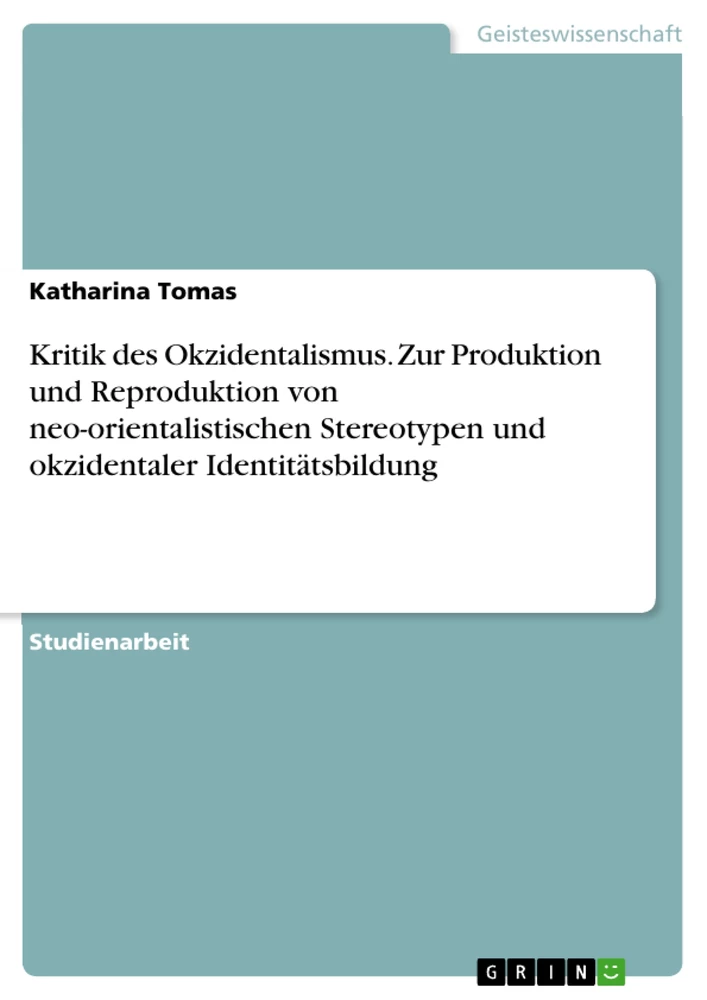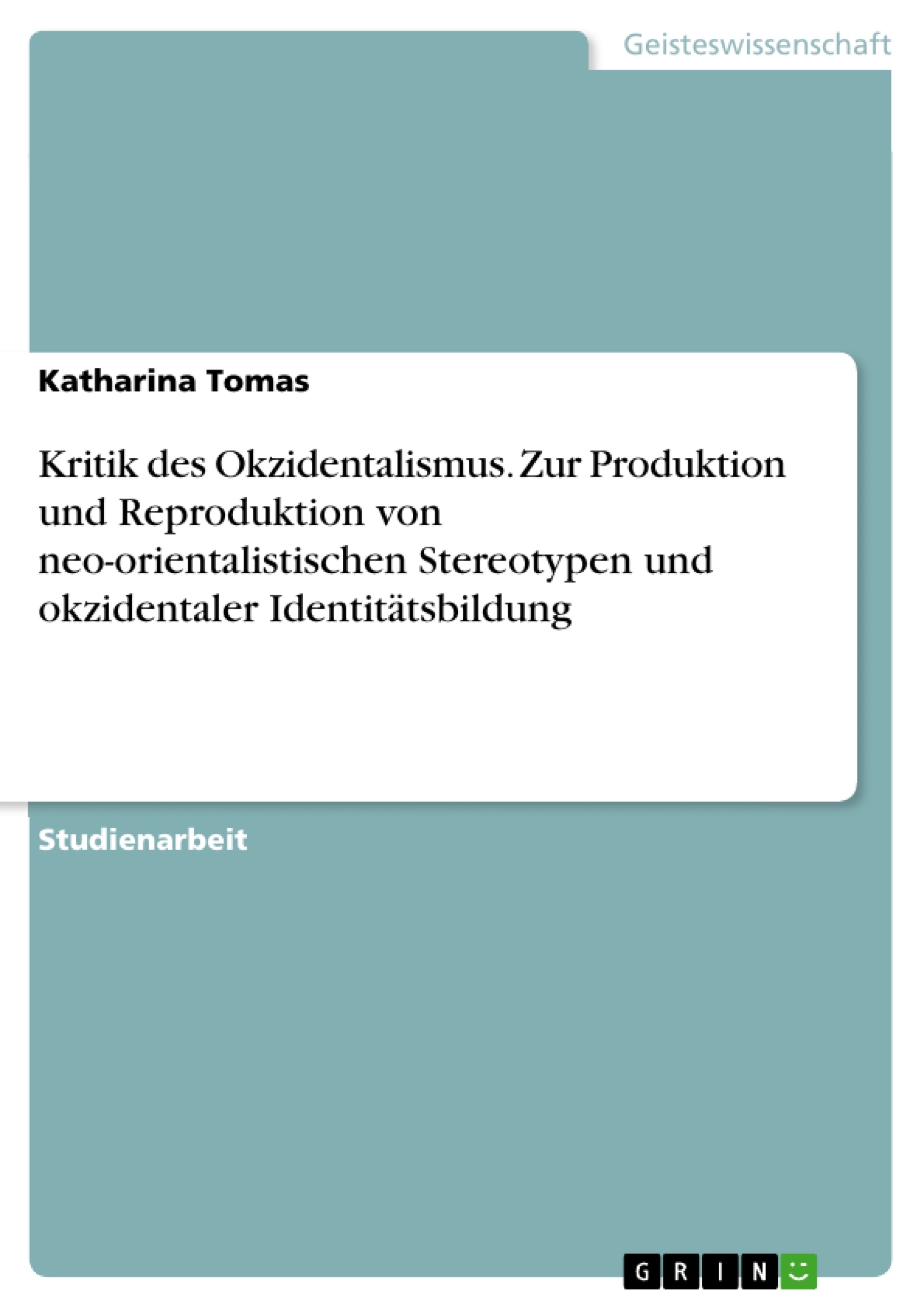Die Arbeit analysiert und kritisiert die Konferenz des Frankfurter Forschungszentrum globaler Islam im Mai 2019, an welcher auch Alice Schwarzer teilgenommen hat, anhand postkolonialer Theorie.
Feministische Mainstreammedien und von ihnen beeinflusste gesellschaftliche Diskurse fokussieren sich immer mehr auf die Unterdrückung der muslimischen Frau – symbolisiert in deren Verschleierung, anstatt ein westliches Patriarchat zu problematisieren. Im akademischen Kontext wird der Diskurs unter anderem vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) der Goethe Universität gestützt. Mit der im Mai 2019 stattfindenden Konferenz des FFGI „Das islamische Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ wurde anti-muslimischen Positionen eine Plattform gegeben. Gehört wurden fast ausschließlich Personen, die das Kopftuch als Unterdrückungsmerkmal deuten. Sowohl Universitätsleitung als auch das breite Medienecho standen hinter der Konferenz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Orientalismus und Kritik des Okzidentalismus
- Orientalismus nach Edward Said
- Kritik des Okzidentalismus
- Anti-muslimischer Rassismus als Methode der okzidentalen Identitätsbildung in Deutschland
- Neo-Orientalismus und Geschlecht
- Geschlechterverhältnisse als Marker der konstruierten Differenz
- Feministischer Orientalismus
- Neuer Realismus
- Zur Reproduktion von Okzidentalismus und feministischem Neo-Orientalismus anhand der Konferenz „Das islamische Kopftuch“
- Die Konferenz „Das islamische Kopftuch“
- Zur Reproduktion des feministischen Neo-Orientalismus
- Zur Reproduktion der Diskursstrategie des neuen Realismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Konferenz „Das islamische Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ des Frankfurter Forschungszentrum globaler Islam im Mai 2019 aus einer postkolonialen Perspektive. Die zentrale These ist, dass die Konferenz feministisch neo-orientalistische Stereotype reproduziert und damit eine hegemoniale, okzidentale Identität untermauert.
- Die Reproduktion feministisch neo-orientalistischer Stereotype in der Konferenz.
- Die okzidentalismuskritische Analyse der Konferenz.
- Die Verbindung zwischen Orientalismus, Okzidentalismus und anti-muslimischem Rassismus in Deutschland.
- Die Rolle von Geschlechterverhältnissen in neo-orientalistischen Diskursen.
- Die Bedeutung der Konferenz im Kontext der deutschen Identitätsbildung und der Konstruktion von „anderen“ Kulturen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Konferenz „Das islamische Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ und ihre problematische Positionierung in Bezug auf anti-muslimische Diskurse vor. Sie führt den Begriff des Okzidentalismus ein und formuliert die These, dass die Konferenz diesen reproduziert.
- Orientalismus und Kritik des Okzidentalismus: Dieses Kapitel definiert die Konzepte von Orientalismus und Okzidentalismus nach Edward Said und Fernando Coronil. Es analysiert die Produktion von Wissens- und Repräsentationssystemen über den Orient und deren Funktion als koloniale Herrschaftsstrategie.
- Anti-muslimischer Rassismus als Methode der okzidentalen Identitätsbildung in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Konstruktion der deutschen Identität nach dem Kalten Krieg und die Entstehung des anti-muslimischen Rassismus als Methode der okzidentalen Identitätsbildung.
- Neo-Orientalismus und Geschlecht: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Geschlechterverhältnissen in neo-orientalistischen Diskursen und zeigt, wie die konstruierte Opposition zwischen „westlicher“ und „orientalisch“ gelesenen Geschlechterverhältnissen den anti-muslimischen Rassismus unterstützt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Orientalismus, Okzidentalismus, anti-muslimischer Rassismus, feministisch neo-orientalistischer Diskurs, Geschlechterverhältnisse, hegemoniale Identitätsbildung, Konferenz „Das islamische Kopftuch“, postkoloniale Perspektive.
- Quote paper
- Katharina Tomas (Author), 2019, Kritik des Okzidentalismus. Zur Produktion und Reproduktion von neo-orientalistischen Stereotypen und okzidentaler Identitätsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/910088