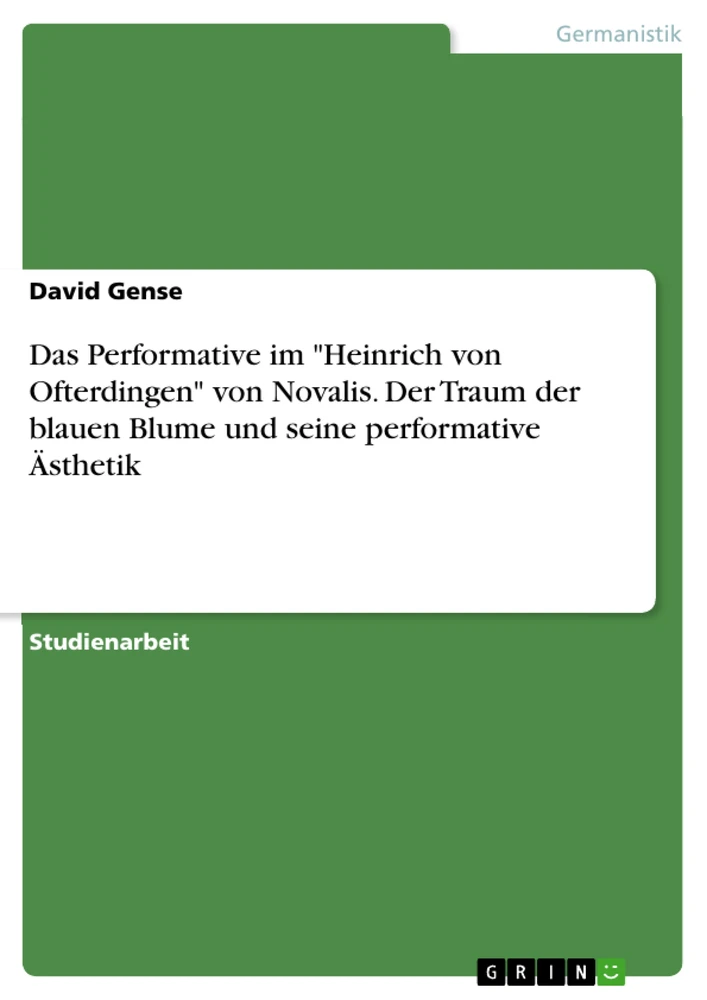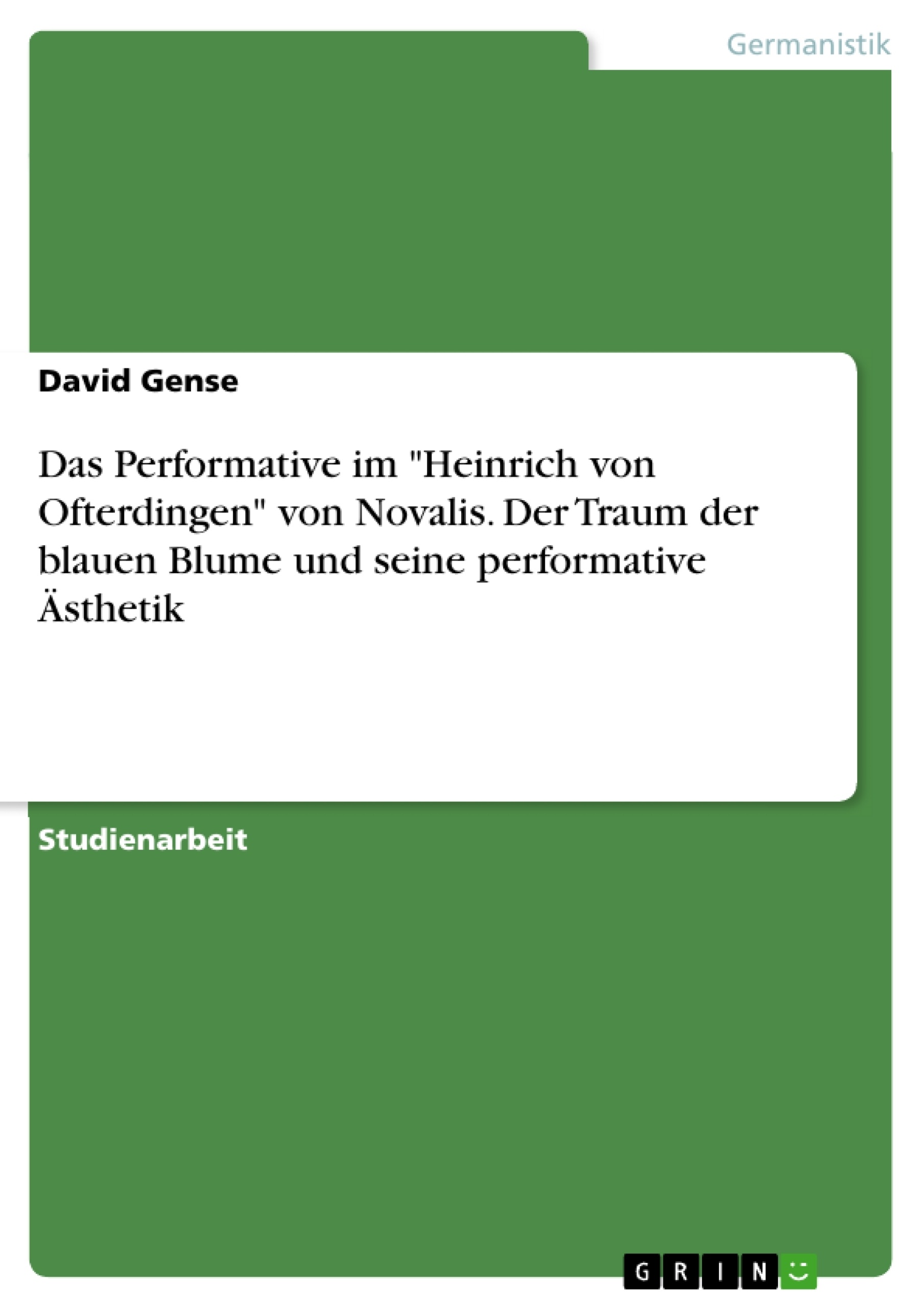Von Interesse für diese Arbeit ist der erste Traum, in dem Heinrichs Gefühlswelt dargelegt und damit das Primat der Aufklärung, Erkenntnisse durch die empirische Beobachtung der Natur zu gewinnen, umgekehrt wird. Novalis sucht die Erkenntnis sozusagen nicht im Äußeren, sondern im Inneren. Überdies zeigt der Traum, so wie er zu einem Ort der Erfahrbarkeit und Präsenz wird, nicht mehr stellvertretend auf etwas Abwesendes, sondern erzeugt etwas Neuartiges.
Bewerkstelligt wird dies durch Erzählstrategien der performativen Präsenzerzeugung, die teilweise mit Novalis’ Romantisierungspostulat korrespondieren. Um diese Strategien aufzuspüren, verwende ich größtenteils das textbezogene Performativitätskonzept nach Häsner et al., welches eine geeignete Trennschärfe zur Strukturierung der performativen Elemente darbietet. Zuvor jedoch folgt ein kurzer Querschnitt in Novalis’ Denken, sodass sich etwas mehr erhellt, welche Ambitionen ihn zur Wiederverzauberung der Welt treiben.
Die Epoche der Aufklärung wurde einst als „Entzauberung der Welt“ bezeichnet. In ihrer Dialektik der Aufklärung demonstrieren Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, wie durch das wissenschaftliche Kalkül seit der Neuzeit nicht nur Mythen aufgelöst werden, sondern auch das menschliche Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen und damit auch das Sinnliche verdrängt werden. Die Aufklärung trägt so gesehen eine totalisierende Dynamik in sich, welche auch schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Argwohn betrachtet wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Tendenzen seiner Zeit
- Theorien des Performativen
- Das sprachphilosophische Performanzkonzept
- Das literaturwissenschaftliche Verständnis der Performativität.
- Das Performative im Traum des Heinrich von Ofterdingen.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der performativen Ästhetik in Novalis' Roman „Heinrich von Ofterdingen“. Im Zentrum steht die Frage, wie Novalis' Traum von der „blauen Blume“ in der performativen Dimension des Textes realisiert wird und welche Rolle das Performative in der frühromantischen Gegenbewegung zur Aufklärung spielt.
- Die Rolle des Performativen in der frühromantischen Poesie
- Die Kritik der Aufklärung und ihre ästhetische Gegenbewegung
- Die Bedeutung des Traums in Novalis' Werk und seine performative Verwirklichung
- Die performative Präsenzerzeugung in „Heinrich von Ofterdingen“
- Die Beziehung zwischen performativer Ästhetik und Romantisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung thematisiert die Entzauberung der Welt in der Aufklärung und die frühromantische Reaktion auf diese Entwicklung. Novalis' Werk wird als Versuch vorgestellt, der Entfremdung des Menschen durch eine poetische Rückbesinnung auf das Sinnliche entgegenzuwirken.
Die Tendenzen seiner Zeit
Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen und literarischen Tendenzen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die Novalis' Werk prägten. Hierzu gehören die Kritik an der Aufklärung, die Betonung der Sinnlichkeit und die Suche nach einer neuen ästhetischen Grundlegung der Weltanschauung.
Theorien des Performativen
Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene Konzepte des Performativen in der Sprachphilosophie und Literaturwissenschaft. Die Relevanz dieser Konzepte für die Analyse von Novalis' Text wird hervorgehoben.
Das Performative im Traum des Heinrich von Ofterdingen.
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des ersten Traums im Roman „Heinrich von Ofterdingen“. Hierbei wird untersucht, wie Novalis' performative Strategien das Primat der empirischen Beobachtung umkehren und eine neue Form der Erkenntnisgewinnung im Inneren des Protagonisten und des Lesers schaffen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Performativität, Frühromantik, Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Traum, „blaue Blume“, Aufklärung, Gegenaufklärung, Romantisierung, Ästhetik, Poesie, Sinnlichkeit, Erkenntnis, Präsenzerzeugung.
- Quote paper
- David Gense (Author), 2018, Das Performative im "Heinrich von Ofterdingen" von Novalis. Der Traum der blauen Blume und seine performative Ästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/909163