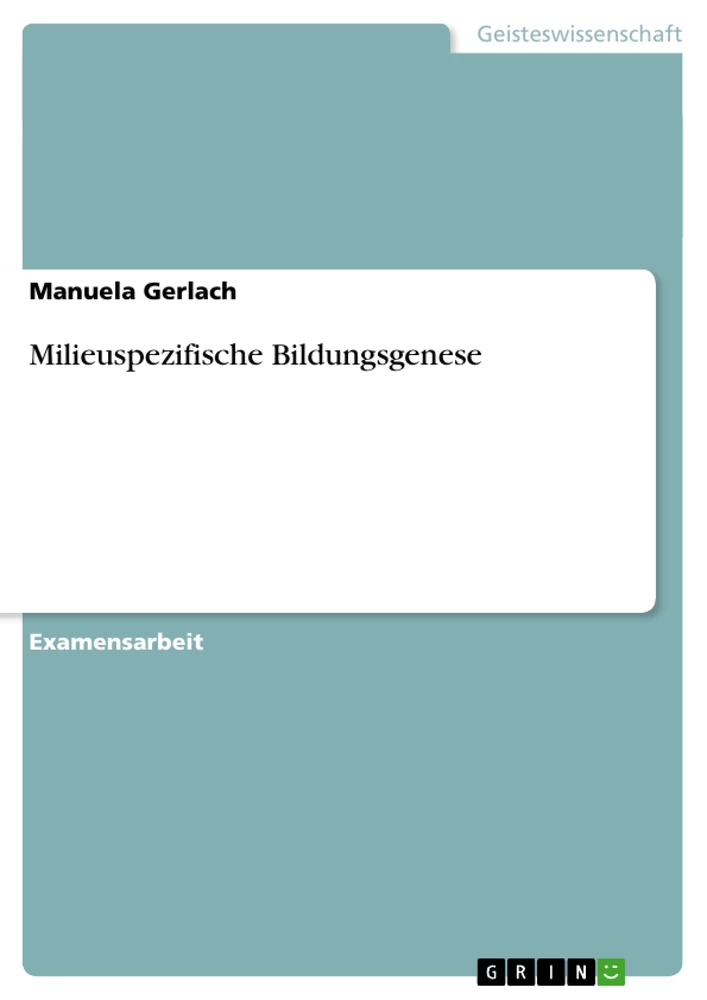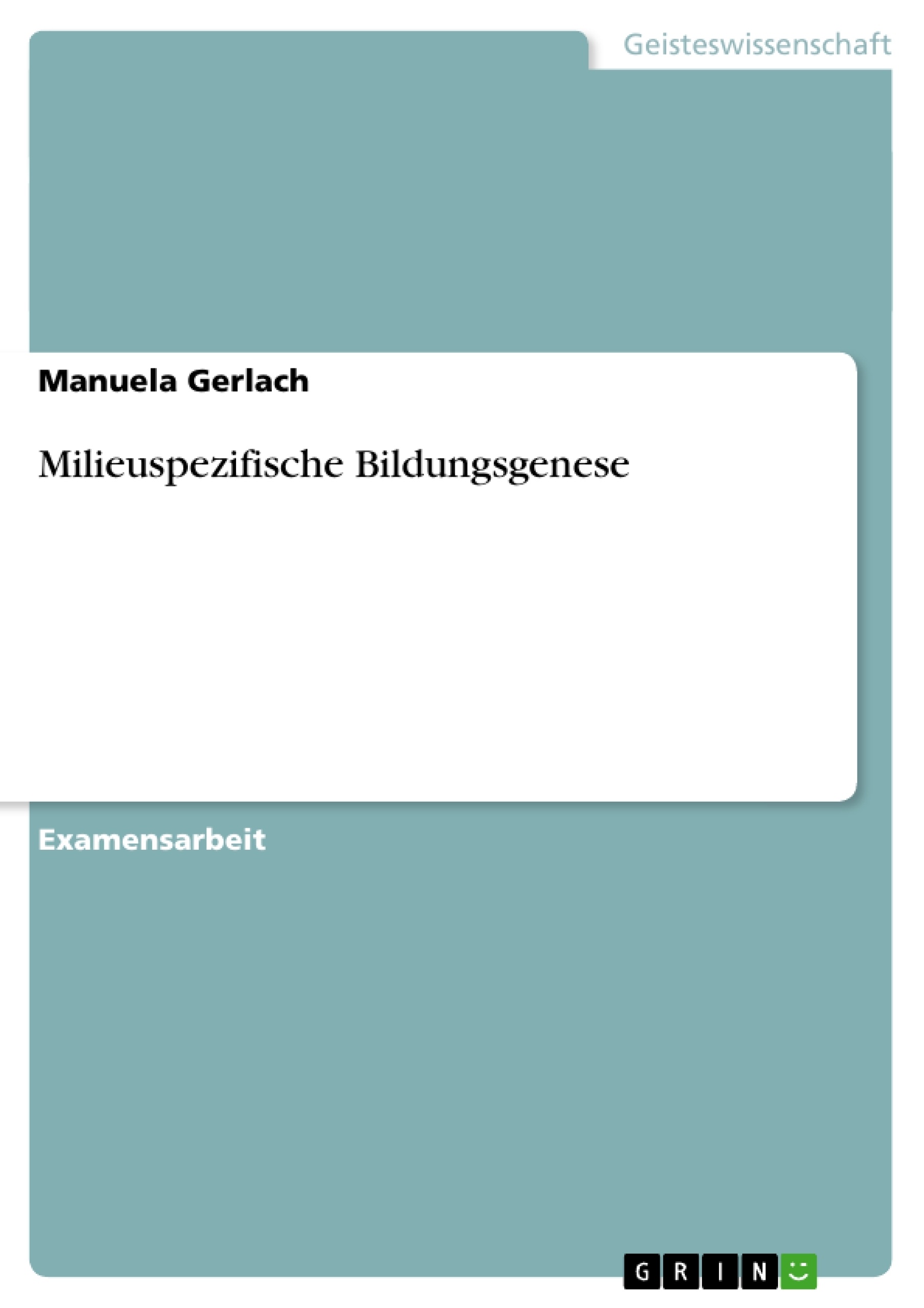Vom 13. bis 21. Februar 2006 besuchte der UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Bildung, Vernor Munoz, die Bundesrepublik Deutschland. In
seiner in diesem Zusammenhang am 9. März 2007 vor der Generalversammlung
der UN veröffentlichten Resolution stellt er fest, dass das dreigliedrige
Schulsystem der Bundesrepublik Deutschland als ungerecht angesehen
werden müsse. Kinder sozial schwacher Familien, Kinder, deren
Muttersprache nicht deutsch ist, und lernbehinderte Kinder werden nicht
adäquat gefördert. Munoz verweist auf die Erfahrungen anderer Länder,
die konsequenter vorschulische Bildung vermitteln, vermehrt auf Ganztagsschulen
und/oder Gesamtschulen setzen und somit die persönlichen
Stärken der Kinder gezielter fördern können.
Milieuspezifische Bildungsgenese
2
Letztendlich beanstandet Munoz an einigen Stellen seiner Resolution,
dass es scheinbar von privilegierten Milieus erwünscht wird, eben benannte
Ungleichheiten bestehen zu lassen.
Abermals steht also die hohe Selektivität des deutschen Schulsystems in
der Kritik. Bereits durch die Ergebnisse des erstmals im Jahr 2000 im
dreijährigen Turnus stattfindenden Programms zur Schülerbeurteilung der
OECD, Program for International Student Assessment (PISA), wurde diese
Kritik deutlich. Anders als in den 60er Jahren, als die am stärksten benachteiligte
idealtypische Figur der katholischen Arbeitertochter vom Lande
zur Disposition stand, geht es in der heutigen Debatte um Kinder bildungsferner
Schichten - um Kinder, deren Eltern einen relativ niedrigen
Bildungsstand aufweisen, und um Kinder mit Migrationshintergrund (vgl.
Georg, Werner 2006).
Es ist zudem erneut die Frage aufgekommen, wie Bildungsinhalte eigentlich
vermittelt werden. Für die Autorin ist interessant, was eigentlich unter
Bildung verstanden wird und wie Bildungsinhalte entstehen. Um diese
Frage zu beantworten, muss zunächst der allgemein vorherrschende
funktionale Bildungsbegriff erläutert werden. Dieser bezeichnet allgemein
einen funktionalen Prozess, an dessen Ende Bildungsabschlüsse erreicht
werden. Beispielsweise sind Jugendliche mit dem Abschluss des Gymnasiums
befähigt, zu studieren. Bildung ist also nach dieser Definition ein
persönliches Gut. Dieser funktionale Bildungsbegriff versteht Bildung als
Kapital, dass auf dem Arbeitsmarkt eingelöst werden kann. Somit wird
über Bildungsprozesse eine gesellschaftliche Stellung erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Forschungsansatz
- Aufbau der Arbeit
- Feldtheorien
- Die Entstehung eines Feldes
- Was sind Milieus?
- Der Milieubegriff
- Milieuformation
- Die innere und äußere Form eines Milieus
- Raumstrukturen
- Competition and Communication or the struggle for existence
- Bildungsinhalte sozialer Milieus
- Zwischenfazit
- Humanökologische Sichtweise sozialer Milieus
- Die Verhaltensformel
- Determinanten milieuspezifischen Verhaltens I
- Der Lebensraum
- Determinanten milieuspezifischen Verhaltens II
- Zwischenfazit
- Milieuspezifische Bildungsgenese
- Handlungsanforderungen der unterschiedlichen Milieus
- Milieuspezifische Tätigkeiten
- Bildungsgenese mittels Kapitalakkumulation
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Milieuspezifisches Bildungspotential
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung von Bildung innerhalb verschiedener sozialer Milieus zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf die spezifischen Bedingungen und Einflüsse gelegt, die die Bildungsgenese in unterschiedlichen Milieus prägen.
- Der Milieubegriff und seine Bedeutung für Bildungsprozesse
- Die Rolle von Raumstrukturen und sozialen Interaktionen in der Milieuformation
- Die Auswirkungen von kulturellem und sozialem Kapital auf die Bildungsgenese
- Die Analyse von Handlungsanforderungen und Tätigkeiten in verschiedenen Milieus
- Der Einfluss von milieuspezifischen Bildungsressourcen auf die Bildungsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit behandelt die Bedeutung des Milieubegriffs für die Bildungsentwicklung und stellt die Fragestellung sowie den Forschungsansatz vor. Es werden wichtige Begriffsdefinitionen und theoretische Grundlagen eingeführt.
- Was sind Milieus?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Milieubegriff und seinen verschiedenen Facetten. Es werden die Entstehung und Charakteristika von Milieus sowie deren Auswirkungen auf Bildungsprozesse beleuchtet.
- Humanökologische Sichtweise sozialer Milieus: Hier werden die humanökologischen Aspekte von Milieus beleuchtet und deren Einfluss auf die Bildungsgenese dargestellt. Es werden insbesondere die Determinanten milieuspezifischen Verhaltens untersucht.
- Milieuspezifische Bildungsgenese: Dieses Kapitel untersucht die Bildungsgenese in unterschiedlichen Milieus. Es werden die Handlungsanforderungen und Tätigkeiten in verschiedenen Milieus sowie das Konzept der Kapitalakkumulation im Bildungsprozess betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Milieu, Bildungsgenese, Kapitalakkumulation, kulturelles Kapital, soziales Kapital, Raumstrukturen, Handlungsanforderungen, Tätigkeiten und Bildungspotential. Es wird die Wechselwirkung zwischen Milieu und Bildung untersucht und die Bedeutung dieser Faktoren für die Bildungsentwicklung in unterschiedlichen sozialen Kontexten hervorgehoben.
- Quote paper
- Manuela Gerlach (Author), 2007, Milieuspezifische Bildungsgenese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90806