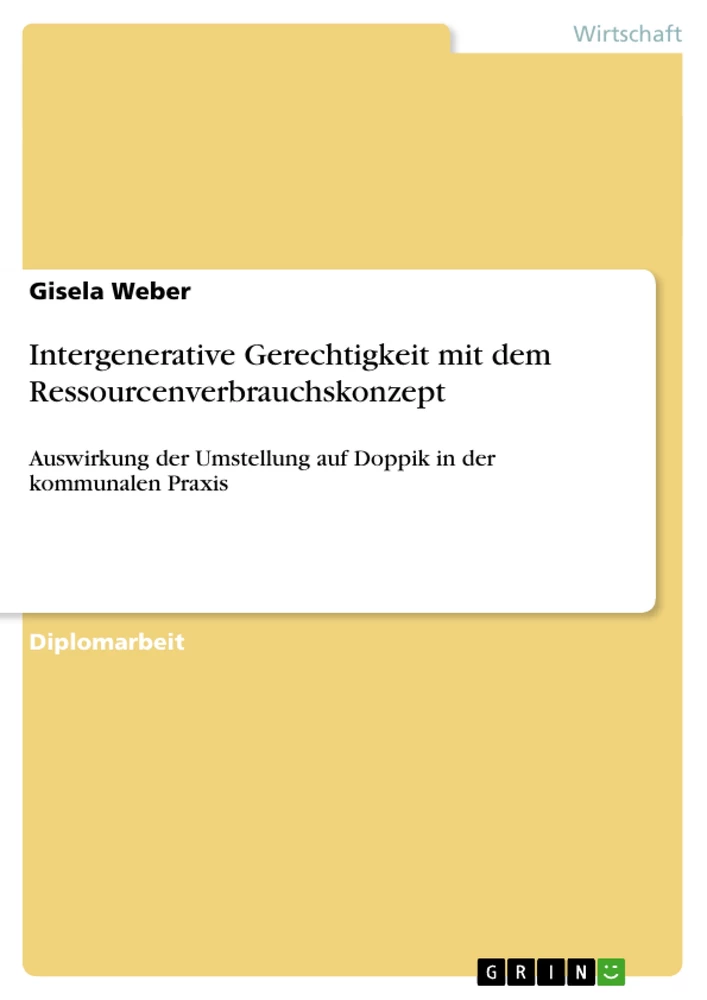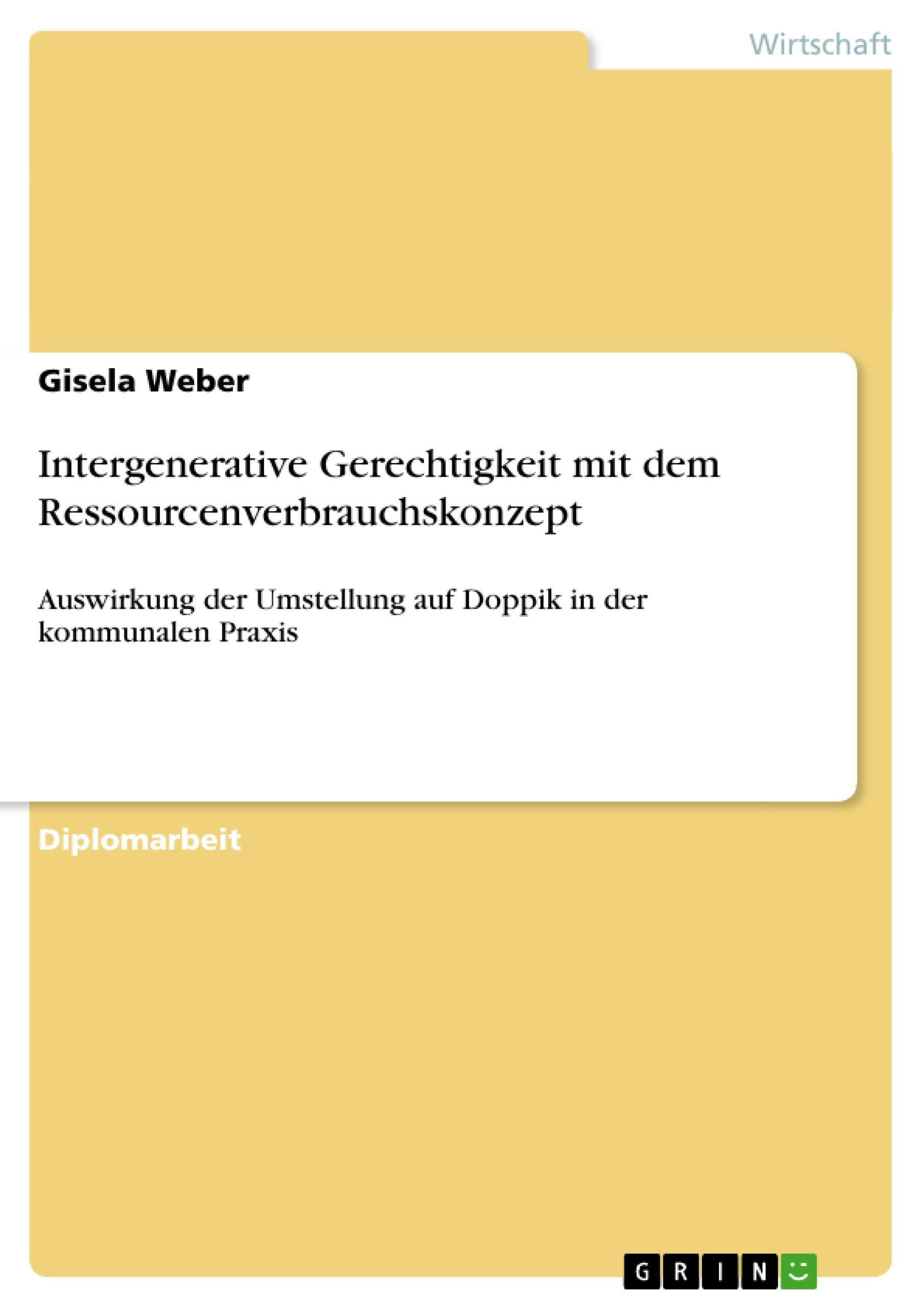Das derzeitige Haushaltsrecht stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommens unzureichend dar. Es mangelt an einer vollständigen Erfassung des Vermögens. Abschreibungen werden nicht flächendeckend berechnet und künftige Finanzlasten (Pensionsverpflichtungen) werden nicht zeitgerecht zugeordnet . Mit Einführung der Doppelten Buchführung in die öffentlichen Verwaltungen soll ein wichtiges Ziel erreicht werden. Die intergenerative Gerechtigkeit, ein demokratisches Grundprinzip, soll mit dem Neuen Rechnungs- und Steuerungssystem verwirklicht werden. Auch der anhaltenden Finanznot der Städte und Gemeinden soll mit dem neuen Rechnungswesen erfolgreich begegnet werden.
Der Deutsche Bundestag hat seinen letzten ausgeglichenen Haushalt 1969 beschlossen. Bis zum Jahre 2004 ist der gesamtstaatliche Schuldenstand auf 1,4 Billionen Euro angestiegen. Der Verteilungsschlüssel der Einnahmen wurde bundesfreundlicher und es erfolgte zunehmend eine Entlastung des Bundeshaushaltes durch Aufgabenübertragungen auf Länder und Kommunen. Alarmierend ist die Verschuldung der Kommunalhaushalte (8,5 Milliarden € Defizit) und dramatisch ist die Entwicklung der Kassenkredite (gestiegen in 2003 um 5,0 Milliarden € auf 16,25 Milliarden € und im 1. Quartal 2004 weitergestiegen auf 17,7 Milliarden €). Die Investitionen gingen zeitgleich um 12 Milliarden € zurück .
Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert und die Länder kommen der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Gewährleistung einer ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen nicht nach.
Seit der Beschlussfassung der Innenministerkonferenz vom 20. und 21.11.2003 zur Einführung der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik) stehen die deutschen Kommunen vor einer tiefgreifenden Reform ihres Rechnungswesens. Die zahlungsorientierte Kameralistik wird abgelöst durch das ertrags- und aufwandsorientierte Ressourcenverbrauchskonzept . Das Rechnungskonzept basiert auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, welches sicherstellen soll, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben ersetzen soll um damit nicht die Nachfolgegenerationen zu belasten. Dieses Prinzip gilt als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und Basis für die Definition des doppischen Haushaltsausgleichs.
Inhaltsverzeichnis
- Die Wahrung des demokratischen Grundprinzips
- Grundlagen, Instrumente, Bausteine und Ziele des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens
- Die Entwicklung vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept
- Die Instrumente des Neuen Steuerungsmodells
- Bausteine des Ressourcenverbrauchskonzepts
- Die Drei-Komponenten-Rechnung
- Die erweiterte Kameralistik
- Ziele des Ressourcenverbrauchskonzepts
- Der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen
- Das Ziel der Vergleichbarkeit
- Der Haushaltsausgleich und die intergenerative Gerechtigkeit
- Die Vermögensbewertung
- Bewertungsverfahren
- Die Bewertung nach Zeitwerten sowie nach Anschaffungs- und Herstellungskosten
- Bewertung in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen
- Kritik am Bewertungsverfahren
- Kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
- Berücksichtigung des Abzugskapitals bei kalkulatorischer Verzinsung
- Berücksichtigung des Abzugskapitals bei kalkulatorischer Abschreibung
- Konsequenzen für die Gebührenkalkulation
- Bewertungsverfahren
- Die Zielerreichung des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit
- Der Haushaltsausgleich, das oberste Finanzziel des Ressourcenverbrauchskonzepts
- Die intergenerative Gerechtigkeit als Konsequenz aus dem Haushaltsausgleich
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Umstellung auf die Doppik (Doppelte Buchführung) in der kommunalen Praxis im Hinblick auf intergenerative Gerechtigkeit und den Ressourcenverbrauch. Sie analysiert die Grundlagen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens und bewertet dessen Zielerreichung bezüglich Haushaltsausgleich und intergenerativer Gerechtigkeit.
- Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts in der kommunalen Haushaltsführung
- Analyse der Vermögensbewertung im Kontext der Doppik
- Bewertung des Haushaltsausgleichs als Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts
- Untersuchung der intergenerativen Gerechtigkeit im Zusammenhang mit kommunalen Finanzen
- Kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Implikationen der Doppik-Umstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Wahrung des demokratischen Grundprinzips: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die gesamte Arbeit, indem es die Bedeutung des demokratischen Grundprinzips im Kontext der kommunalen Haushaltsführung erläutert. Es wird dargelegt, wie ein transparentes und nachvollziehbares Haushaltswesen die Partizipation der Bürger sicherstellt und die demokratische Legitimation kommunaler Entscheidungen stärkt. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und die Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung werden als essentiell für die Wahrung des demokratischen Prinzips hervorgehoben.
Grundlagen, Instrumente, Bausteine und Ziele des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das neue Haushalts- und Rechnungswesen, insbesondere die Entwicklung vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Es analysiert die Instrumente des neuen Steuerungsmodells, die Bausteine des Ressourcenverbrauchskonzepts (Drei-Komponenten-Rechnung und erweiterte Kameralistik), und die damit verbundenen Ziele. Ein zentraler Aspekt ist die Erläuterung, wie das neue System einen wirtschaftlicheren Umgang mit Ressourcen ermöglichen und die Vergleichbarkeit von Haushalten verbessern soll. Der Zusammenhang mit intergenerativer Gerechtigkeit wird bereits hier angedeutet.
Die Vermögensbewertung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Vermögensbewertung im Rahmen der Doppik. Es werden verschiedene Bewertungsverfahren (Zeitwerte, Anschaffungs- und Herstellungskosten) detailliert dargestellt und kritisch beleuchtet. Die Herausforderungen der Bewertung in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen unterschiedlicher Bewertungsmethoden auf die Darstellung der kommunalen Finanzlage und die langfristige Finanzplanung.
Die Zielerreichung des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit: Dieses Kapitel analysiert, inwieweit der Haushaltsausgleich, als oberstes Finanzziel des Ressourcenverbrauchskonzepts, tatsächlich erreicht wird. Es wird untersucht, wie der Haushaltsausgleich zur intergenerativen Gerechtigkeit beiträgt. Die Kapitel erörtert die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Ziele in der kommunalen Praxis und beleuchtet mögliche Konflikte zwischen kurzfristigen politischen Interessen und langfristigen finanziellen Zielen. Konkrete Beispiele aus der kommunalen Praxis könnten hier zur Veranschaulichung dienen.
Schlüsselwörter
Doppik, Ressourcenverbrauchskonzept, intergenerative Gerechtigkeit, Haushaltsausgleich, Vermögensbewertung, kommunale Finanzwirtschaft, Kameralistik, Drei-Komponenten-Rechnung, wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen, Vergleichbarkeit von Haushalten.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Auswirkungen der Doppik auf intergenerative Gerechtigkeit und Ressourcenverbrauch
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Umstellung auf die Doppik (Doppelte Buchführung) in der kommunalen Praxis auf die intergenerative Gerechtigkeit und den Ressourcenverbrauch. Sie analysiert die Grundlagen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens und bewertet dessen Zielerreichung hinsichtlich Haushaltsausgleich und intergenerativer Gerechtigkeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, die Analyse der Vermögensbewertung im Kontext der Doppik, die Bewertung des Haushaltsausgleichs als Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts, die Untersuchung der intergenerativen Gerechtigkeit im Zusammenhang mit kommunalen Finanzen und eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Implikationen der Doppik-Umstellung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Wahrung des demokratischen Grundprinzips, den Grundlagen, Instrumenten, Bausteinen und Zielen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, der Vermögensbewertung, der Zielerreichung des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit sowie eine kritische Würdigung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was versteht man unter dem Ressourcenverbrauchskonzept?
Das Ressourcenverbrauchskonzept ist ein Kernbestandteil der Doppik. Es stellt eine Weiterentwicklung vom bisherigen Geldverbrauchs- hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept dar. Es zielt auf einen wirtschaftlicheren Umgang mit Ressourcen und die verbesserte Vergleichbarkeit von Haushalten ab.
Welche Rolle spielt die Vermögensbewertung?
Die Vermögensbewertung ist ein zentraler Aspekt der Doppik. Die Arbeit untersucht verschiedene Bewertungsverfahren (Zeitwerte, Anschaffungs- und Herstellungskosten) und deren Auswirkungen auf die Darstellung der kommunalen Finanzlage und die langfristige Finanzplanung. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird der Haushaltsausgleich im Kontext der intergenerativen Gerechtigkeit betrachtet?
Der Haushaltsausgleich wird als oberstes Finanzziel des Ressourcenverbrauchskonzepts betrachtet. Die Arbeit analysiert, inwieweit dieser erreicht wird und wie er zur intergenerativen Gerechtigkeit beiträgt. Mögliche Konflikte zwischen kurzfristigen politischen Interessen und langfristigen finanziellen Zielen werden beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Doppik, Ressourcenverbrauchskonzept, intergenerative Gerechtigkeit, Haushaltsausgleich, Vermögensbewertung, kommunale Finanzwirtschaft, Kameralistik, Drei-Komponenten-Rechnung und wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen.
Welche Bedeutung hat das demokratische Grundprinzip?
Die Einhaltung des demokratischen Grundprinzips wird als essentiell für ein transparentes und nachvollziehbares Haushaltswesen betrachtet. Dies soll die Partizipation der Bürger sicherstellen und die demokratische Legitimation kommunaler Entscheidungen stärken.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Doppik-Umstellung diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Implikationen der Umstellung auf die Doppik, insbesondere die Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts und die Erreichung des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit in der kommunalen Praxis.
- Quote paper
- Gisela Weber (Author), 2005, Intergenerative Gerechtigkeit mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90514