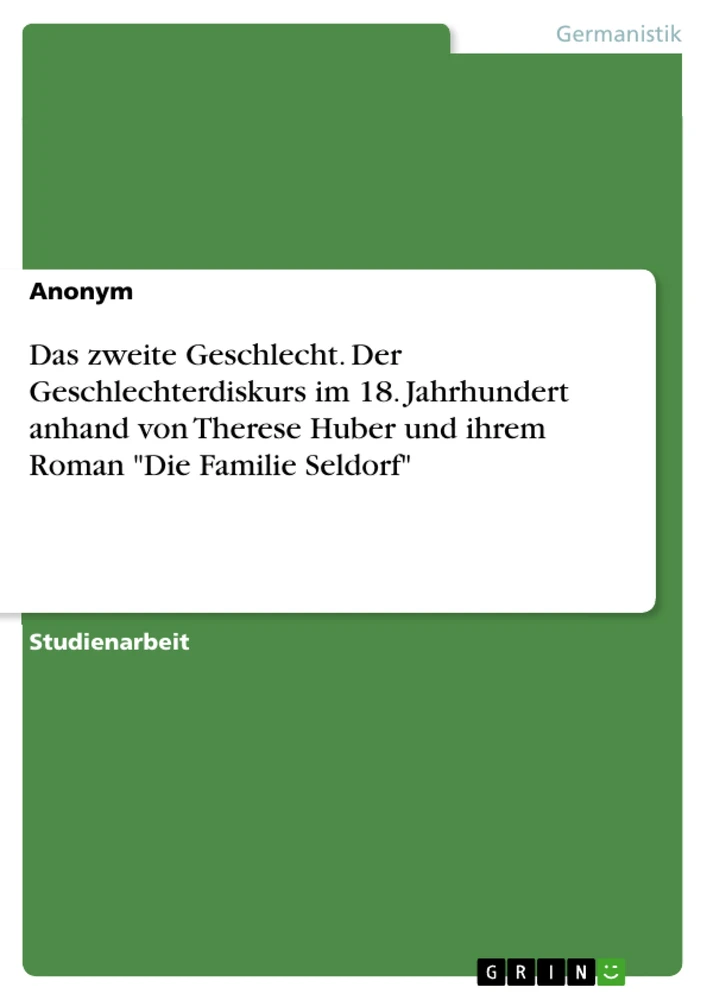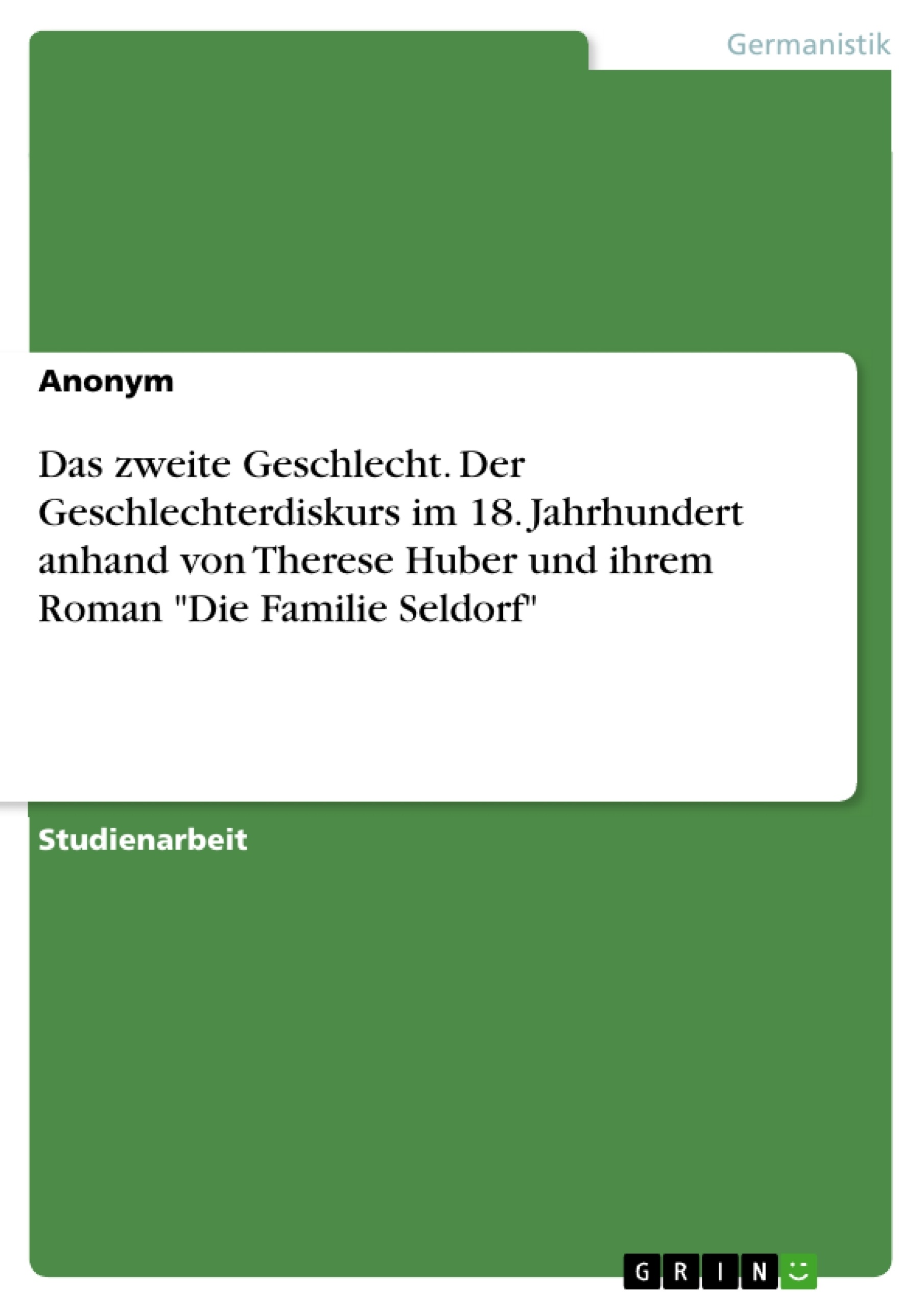Betrachtet man die didaktischen Jahrespläne der Sekundarstufen I und II, so fallen unter der zu lesenden Pflichtlektüre fast ausschließlich Werke von männlichen Schriftstellern. Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, E.T.A Hoffmann, Heinrich von Kleist- sie alle sind und waren literarische Größen des 18. Jahrhunderts. Das Frauen bis heute weitestgehend unbekannt in der deutschen Literatur sind, liegt vorwiegend an der damaligen sozialen Situation der Frau in der Gesellschaft. Doch war es nicht so, dass es keine Frauen gab, die literarisch tätig gewesen wären oder nur Werke veröffentlicht hätten, die in ihrer Qualität der männlichen Literatur nachstanden. Autorinnen wie Anna Louisa Karsch, Sophia von La Roche, Christiana Mariana von Ziegler, Henriette Herz und Therese Huber sind Autorinnen, die aufgrund ihres Geschlechts einen Kampf führen mussten, um ihre Werke und literarischen Leistungen als würdig gelten zu lassen.
Eine weniger bekannte, aber durchaus erfolgreiche Schriftstellerin ist Therese Huber, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und in den Anfängen des 19. Jahrhunderts tätig gewesen ist und zahlreiche Werke veröffentlicht hat. Als Zeitzeugin der Französischen Revolution hat sie eine schwierige Zeit miterlebt, die sie in dem Roman Die Familie Seldorf verarbeitet.
Deshalb wird sich diese Arbeit zunächst mit dem sozial-gesellschaftlichen Hintergrund des 18. Jahrhunderts beschäftigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frau, die in der Epoche der Aufklärung unter der Vormundschaft der Männer stand und mit vielen Rollenzuschreibungen, Erwartungen und dem gesellschaftlichen Druck umzugehen versuchte. Dabei soll deutlich werden, welche Hindernisse die Frau, im Vergleich zu den Hindernissen des Mannes, hatte und wie sie diese bewältigen konnte. Als Beispiel dient dazu dient Therese Huber. Die Beleuchtung ihres durchaus ereignisreichen Lebens und ihrer Schriftstellerinnentätigkeit soll den Beruf der Schriftstellerin zur Zeit der Aufklärung verbildlichen, wie sie zunächst im Schatten ihrer Ehemänner stand und dann den Lebensunterhalt selbst verdiente. Ihre Verarbeitung der französischen Revolution wird besonders im Roman deutlich. Die Entwicklung des literarischen Werks wird hierbei näher beleuchtet und der Inhalt spielt dabei auch eine zentrale Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Sozial-gesellschaftlicher Hintergrund...
- 2.1 Das 18. Jahrhundert- Aufklärung
- 2.2 Abhängigkeit- die soziale Situation der Frau im 18. Jahrhundert..
- 2.3 Die Frau des Mannes- Erziehung, Schulbildung, Berufstätigkeit.
- 2.4 Französische Revolution.
- 3. Therese Huber..
- 4. Die Familie Seldorf..
- 4.1 Entwicklung....
- 4.2 Handlung....
- 4.3 Die Politisierung des weiblichen Geschlechts.....
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Roman „Die Familie Seldorf“ von Therese Huber im Kontext des Geschlechterdiskurses des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht die soziale Situation der Frau in der Epoche der Aufklärung und die Herausforderungen, denen sie im Hinblick auf Bildung, Beruf und gesellschaftliche Erwartungen gegenübersah. Darüber hinaus betrachtet die Arbeit, wie Huber die Französische Revolution in ihrem Roman verarbeitet und welche Kritik sie an der bestehenden Gesellschaftsordnung übt.
- Die soziale Situation der Frau im 18. Jahrhundert.
- Die Rolle der Aufklärung im Hinblick auf den Geschlechterdiskurs.
- Therese Huber als Schriftstellerin und Zeitzeugin der Französischen Revolution.
- Die Analyse des Romans „Die Familie Seldorf“ und seine Relevanz für den Geschlechterdiskurs.
- Huber’s Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die literarische Relevanz von Therese Huber und die Bedeutung ihres Romans „Die Familie Seldorf“ dar. Sie führt in die Thematik des Geschlechterdiskurses im 18. Jahrhundert ein und beleuchtet die Herausforderungen, denen Frauen im Bereich der Literatur und Gesellschaft begegneten.
Kapitel 2 analysiert den sozial-gesellschaftlichen Hintergrund des 18. Jahrhunderts, wobei der Fokus auf der Situation der Frau liegt. Es werden die wichtigsten Strömungen der Aufklärung beleuchtet, die Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft, ihre Abhängigkeit von den Männern und die Begrenzungen ihrer Bildung und Berufsmöglichkeiten.
Kapitel 3 präsentiert Therese Huber als Person, beleuchtet ihr Leben und ihre Schriftstellerinnentätigkeit. Das Kapitel zeigt, wie Huber als Frau mit den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen umging, ihre Karriere als Schriftstellerin verfolgte und ihre Erfahrungen mit der Französischen Revolution in ihr Werk einfließen ließ.
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Analyse des Romans „Die Familie Seldorf“. Es werden die Handlung des Romans, die Entwicklung der Figuren und die politischen Botschaften, die Huber in ihrem Werk verpackt, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Therese Huber, Die Familie Seldorf, Geschlechterdiskurs, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Französische Revolution, soziale Situation der Frau, Bildung, Beruf, Literatur, Kritik, Gesellschaftsordnung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Das zweite Geschlecht. Der Geschlechterdiskurs im 18. Jahrhundert anhand von Therese Huber und ihrem Roman "Die Familie Seldorf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904835