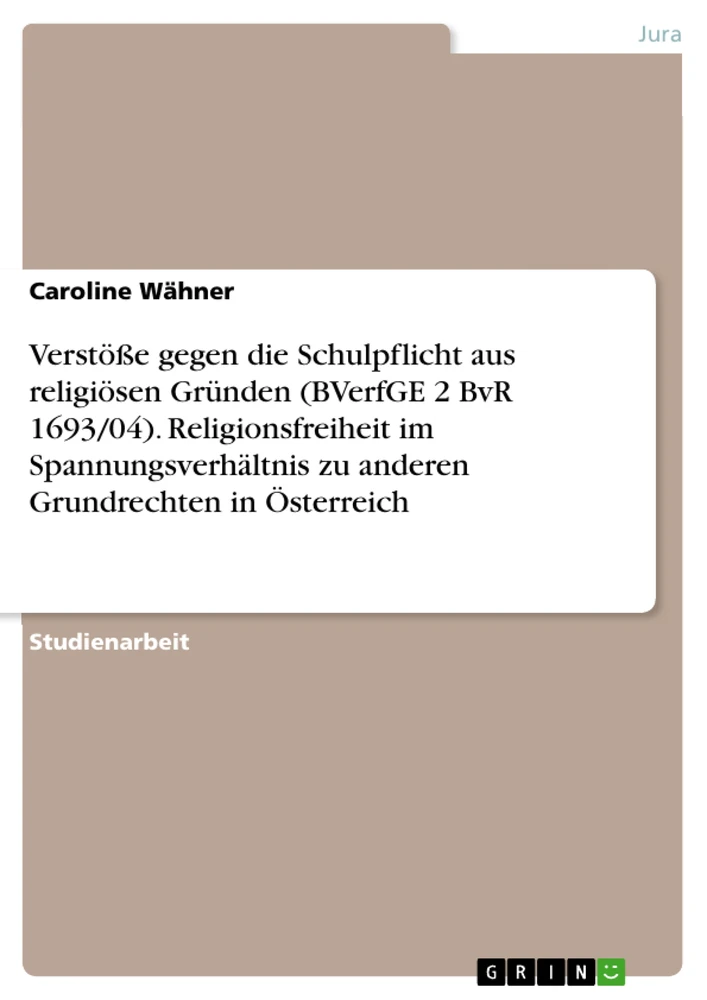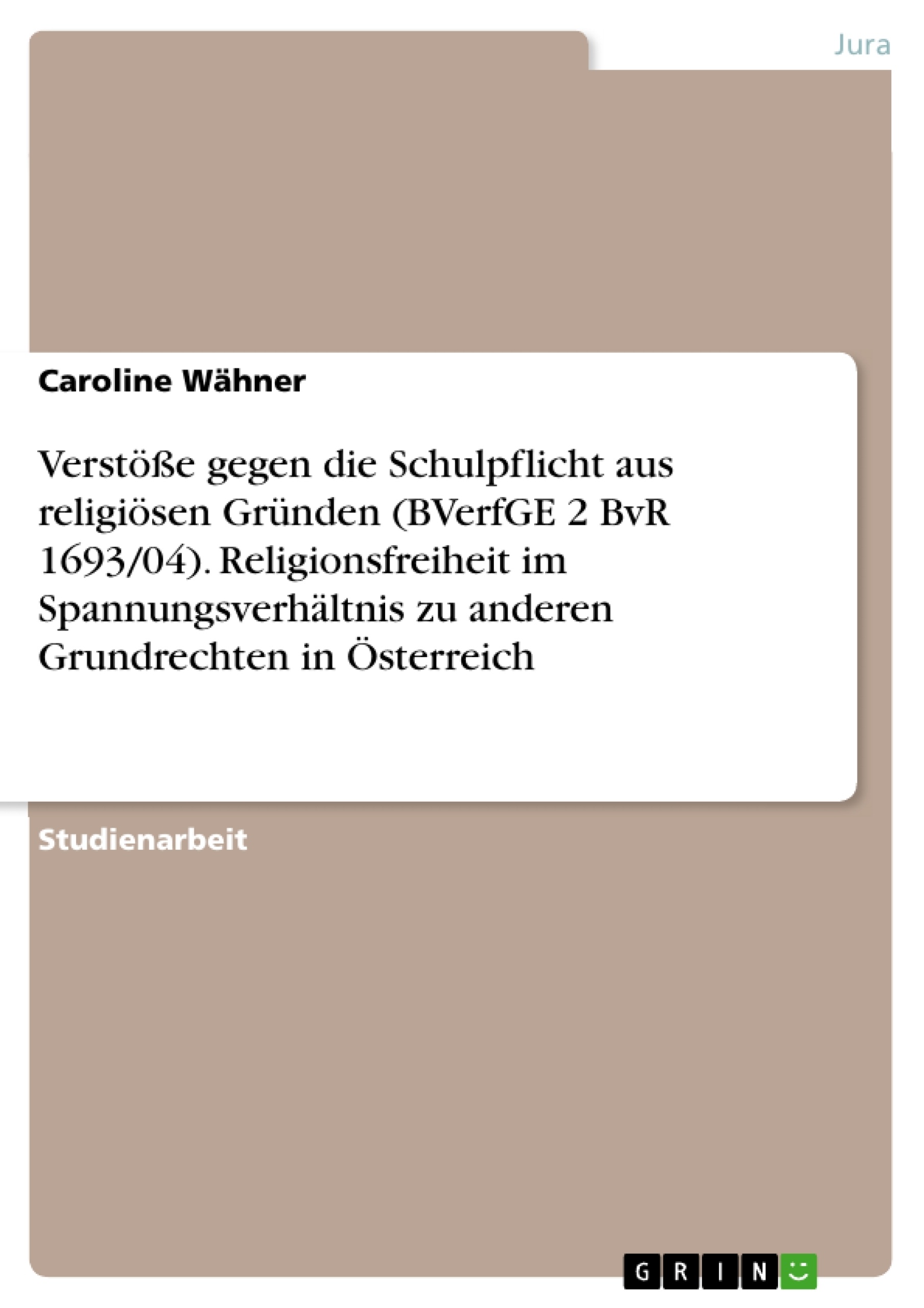Um die Verstöße besorgter (religiöser) Eltern und ihrer Kinder gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen näher beleuchten zu können, geht diese Arbeit zunächst auf die einzelnen Begrifflichkeiten und ihre Bedeutung ein, um im Anschluss den zu diskutierenden Fall und seine rechtliche Dimension verstehen zu können.
Ausgangspunkt ist der heutige neuzeitliche Staat geprägt von einer gegen die religiös-politische Einheitswelt des Mittelalters gerichteten Vorganges, dem Säkularisierungsvorgang. Damit kommt aus der Historie der Wunsch der pluralistischen Gemeinschaft nach Glaubens- und Gewissensfreiheit als zentraler Bedeutung der Menschenrechte zum Ausdruck.
Daraus resultiert in Anerkennung der menschlichen Freiheit ein individueller Rechtsanspruch, indem ein Kern des Menschenrechts gelegen ist. Dem trägt die Rechtsprechung des EGMR insoweit Rechnung, als dass die in Art. 9 EMRK gewährleistete Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit durch viele Urteile einige Teilbereiche des Grundrechts ausjudiziert hat.
Dies macht wiederum deutlich, dass die Gewährleistung des Artikels 9 EMRK einen der „Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft“ im Sinne der EMRK bildet und verdeutlicht, dass das Grundrecht aus Artikel 9 EMRK menschliche Überzeugungen schützt, die in besonderem Maße an die eigene Identität verbunden mit der Würde eines jeden Menschen, anknüpfen. Zu hinterfragen ist die Intensität, mit welcher der Staat in punkto Schulpflicht die Autonomie und die Eigengesetzlichkeit des religiösen Lebens und derer verschiedener religiöser Betätigungen respektiert und nicht ausgrenzt. Dies wird anhand des "Verstoßes gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen" rechtlich näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff und Definitionsproblematik von Religion und Religionsfreiheit
- Einordnung des Begriffs der Religionsfreiheit in völkerrechtlicher Hinsicht
- Begriff der Religionsfreiheit im österreichischen Recht
- Einordnung des Begriff Religion vs. Weltanschauung aus dt. Rechtsansicht
- Verfassungsrechtliche Grundlagen für Glaubens- & Gewissensfreiheit gemäß Art. 14 StGG, Art. 9 EMRK sowie Art. 63 Abs. 2 StV St. Germain in Österreich
- Rechtliche Grundlagen für religiöse und weltanschauliche Kindererziehung in Österreich
- Schulhoheit und staatlicher Erziehungsauftrag
- Das Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung
- Religiöse Kindererziehung als Teil des Obsorgerechts
- Abgestufte Religionsmündigkeit
- Verfassungsrechtliche Grundlage der Religionsfreiheit in Deutschland
- Schutzbereich des Art. 4 GG
- Eingriff in den Schutzbereich der Religionsfreiheit
- Verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Einschränkungsmöglichkeit
- Schulpflicht in Deutschland
- Definition von Schulpflicht
- Rechtliche Verankerung der Schulpflicht
- Durchsetzung der Schulpflicht
- Religiöse und weltanschauliche Kindererziehung i.F.d. Religionsunterrichts
- Keine Pflicht zum Besuch von konfessionellen Religionsunterricht
- Problem der Befreiung vom Unterricht aus religiösen Gründen
- Beispielsfall einer erfolglosen Verfassungsbeschwerde gegen die strafr. Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen nach -BVerfGE 2 BvR 1693/04-
- Alternativlösung Homeschooling?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Spannungen zwischen Religionsfreiheit und anderen Grundrechten, insbesondere im Kontext der Schulpflicht. Sie analysiert, inwieweit Verstöße gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit vereinbar sind.
- Begriff und Definitionsproblematik von Religion und Religionsfreiheit
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Religionsfreiheit in Österreich und Deutschland
- Rechtliche Grundlagen der Schulpflicht und religiösen Kindererziehung
- Konflikte zwischen Religionsfreiheit und Schulpflicht
- Alternativen zur Schulpflicht für religiöse Minderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext des modernen Staates. Sie beleuchtet den Säkularisierungsvorgang und die historische Entwicklung der Religionsfreiheit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff und der Definitionsproblematik von Religion und Religionsfreiheit. Es untersucht die Einordnung der Religionsfreiheit in völkerrechtlicher Hinsicht sowie im österreichischen und deutschen Recht.
Das dritte Kapitel analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen für Glaubens- und Gewissensfreiheit in Österreich. Es betrachtet die einschlägigen Artikel in der österreichischen Verfassung und den Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen für religiöse und weltanschauliche Kindererziehung in Österreich. Es untersucht den staatlichen Erziehungsauftrag, das Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung sowie die Rolle des Obsorgerechts und der abgestuften Religionsmündigkeit.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtliche Grundlage der Religionsfreiheit in Deutschland. Es analysiert den Schutzbereich des Artikels 4 des Grundgesetzes (GG) und die Möglichkeiten der Einschränkung dieses Grundrechts.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Schulpflicht in Deutschland. Es definiert den Begriff der Schulpflicht, beschreibt ihre rechtliche Verankerung und die Durchsetzungsmöglichkeiten. Es behandelt auch das Problem der Befreiung vom Unterricht aus religiösen Gründen und den Fall einer erfolglosen Verfassungsbeschwerde gegen die strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen.
Das siebte Kapitel untersucht die Alternativlösung des Homeschooling für Familien, die aus religiösen Gründen die Schulpflicht nicht erfüllen möchten.
Schlüsselwörter
Religionsfreiheit, Schulpflicht, Grundrechte, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Kindererziehung, Weltanschauung, Verfassungsrecht, Österreich, Deutschland, BVerfGE, Homeschooling.
- Quote paper
- Caroline Wähner (Author), 2009, Verstöße gegen die Schulpflicht aus religiösen Gründen (BVerfGE 2 BvR 1693/04). Religionsfreiheit im Spannungsverhältnis zu anderen Grundrechten in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903583