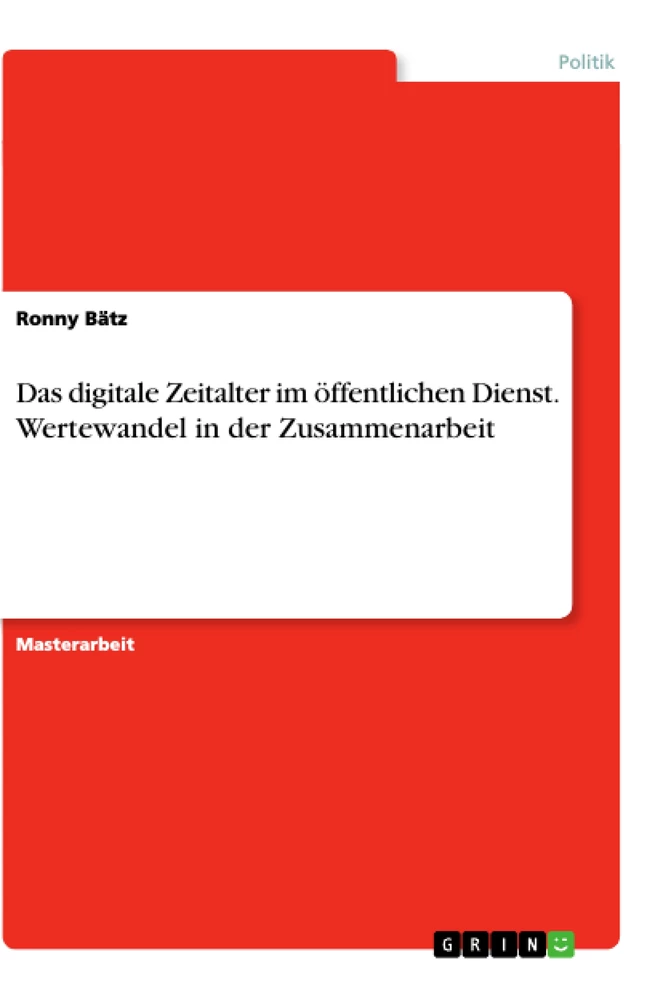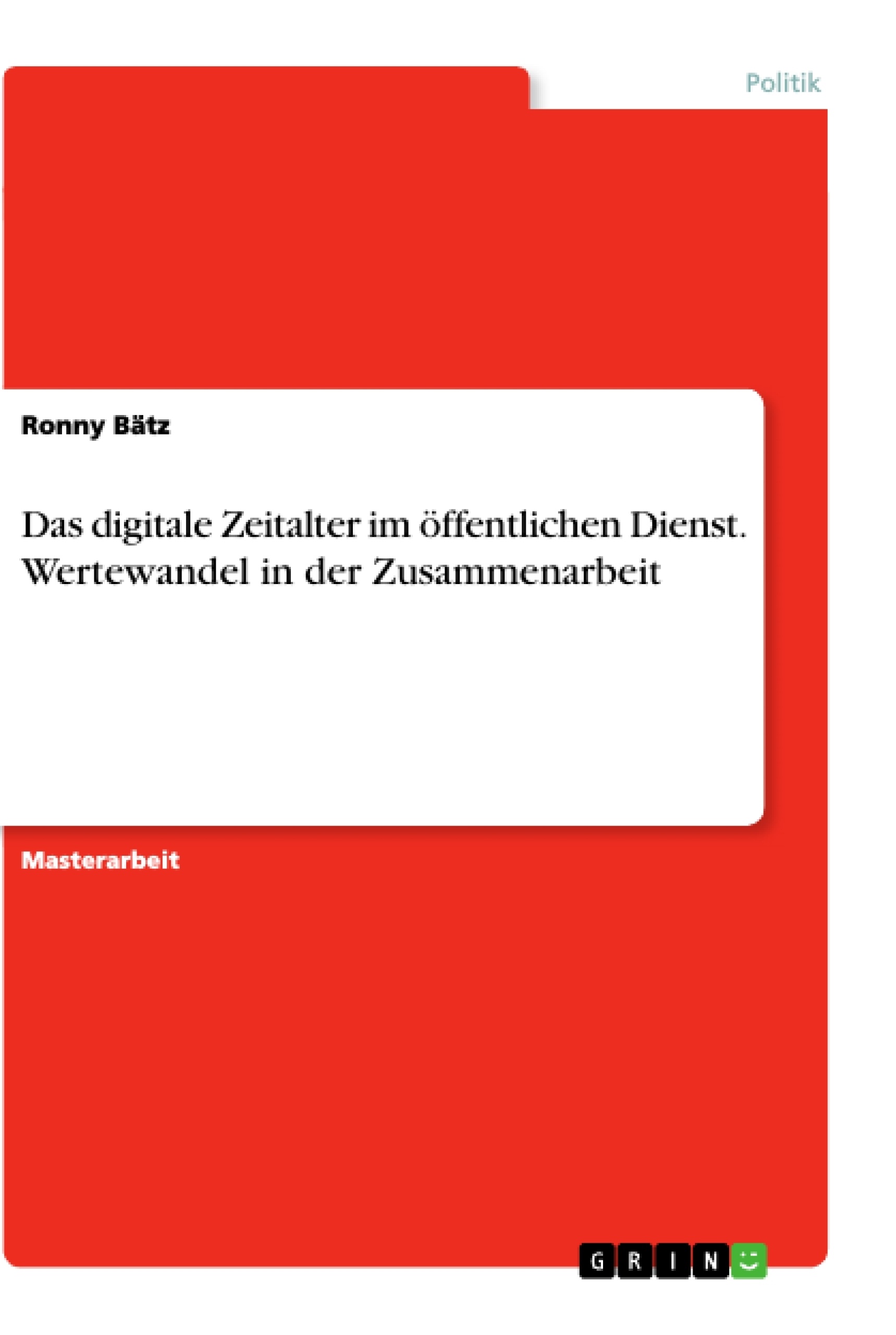Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Werte Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Allgemeinen und insbesondere für eine gute Zusammenarbeit wichtig sind. Im Fokus steht dabei die Zusammenarbeit in virtuellen Strukturen durch Nutzung mobiler und flexibler Arbeitsformen.
Nach der definitorischen Klärung relevanter Begrifflichkeiten und einer Aufarbeitung des Forschungsstandes, werden die aktuellen Rahmenbedingungen erläutert. Daran schließt sich der zentrale Abschnitt der Arbeit zur empirischen Untersuchung an. Hier werden Forschungsvorgehen- und Design beschrieben sowie wesentliche Ergebnisse der Erhebung präsentiert und diskutiert. Im letzten Abschnitt sollen aus den gewonnen Erkenntnissen Schlussfolgerungen im Hinblick auf aktuelle Wertorientierungen in der Arbeitswelt des öffentlichen Dienstes gezogen werden.
Wenngleich sich Digitalisierungsprozesse in Organisationen des öffentlichen Dienstes noch im Anfangsstadium befinden, bildet die Digitalisierung eine der Rahmenbedingungen, die auch die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst maßgeblich beeinflusst wird. Mancherorts ermöglichen aktuell bereits die E-Akte, ein Laptop und ein Diensthandy den Dienst orts- und zeitunabhängig auszuüben. Es ist davon auszugehen, dass mobile und flexible Arbeitsmodelle in Zukunft auch im öffentlichen Dienst an Bedeutung gewinnen werden.
Oberste Bundesbehörden wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben bereits entsprechende Dienstvereinbarungen getroffen und bieten allen Beschäftigten unabhängig von jedweden Begründungszwängen die Möglichkeit das Angebot zu nutzen. Doch eine räumliche Trennung von Organisationen und die Teilung von Arbeitseinheiten bedingen auch ein Umdenken in der virtuellen Zusammenarbeit. Face-to-face-Kontakte werden seltener. Die Kommunikation erfolgt primär über E-Mail, Telefon und andere elektronische Medien
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
- 1.2 Zielstellung
- 1.3 Aufbau und Methodik
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.2 Bisheriger Forschungsstand
- 2.3 Aktuelle Rahmenbedingungen
- 2.3.1 Wertewandel in der Arbeitswelt
- 2.3.2 Die (Arbeits-)Kultur im öffentlichen Dienst
- 2.3.3 Demografischer Wandel
- 2.3.4 Digitalisierungsprozesse im öffentlichen Dienst
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Befragung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst
- 3.1.1 Hypothesen
- 3.1.2 Operationalisierung
- 3.1.3 Forschungsdesign
- 3.1.4 Durchführung
- 3.1.5 Stichprobe
- 3.1.6 Ergebnisse
- 3.2 Diskussion der Ergebnisse
- 4 Handlungsempfehlungen
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Werte von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, insbesondere im Hinblick auf gute Zusammenarbeit in virtuellen Strukturen. Die Arbeit analysiert den Einfluss des Wertewandels, der Digitalisierung und des demografischen Wandels auf die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst.
- Wertewandel im öffentlichen Dienst und dessen Auswirkungen auf die Arbeitskultur.
- Der Einfluss der Digitalisierung auf die Zusammenarbeit und die Wertorientierungen der Beschäftigten.
- Die Bedeutung traditioneller und moderner Werte für die Arbeitszufriedenheit und die Zusammenarbeit.
- Herausforderungen des demografischen Wandels für das Personalmanagement im öffentlichen Dienst.
- Handlungsempfehlungen für ein werteorientiertes Personalmanagement.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Wertewandels und dessen Relevanz für die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst ein. Sie beschreibt die Ausgangssituation, die Problemstellung, die Zielsetzung und die Methodik der Arbeit. Es wird auf den bestehenden Forschungsstand und die aktuellen Herausforderungen wie Digitalisierung und demografischen Wandel eingegangen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, welche Werte für Beschäftigte im öffentlichen Dienst wichtig sind und wie sich diese im Kontext der zunehmenden virtuellen Zusammenarbeit auswirken.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff „Wert“ anhand verschiedener wissenschaftlicher Ansätze und grenzt ihn von verwandten Begriffen ab. Der Kapitel befasst sich mit dem bisherigen Forschungsstand zum Wertewandel, wobei verschiedene Theorien wie die Postmaterialismus-These von Inglehart und das Wertesynthese-Konzept von Klages vorgestellt und verglichen werden. Abschließend werden die aktuellen Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst, wie Wertewandel, die Arbeitskultur, demografischer Wandel und Digitalisierung, analysiert und ihre Bedeutung für die Interpretation der empirischen Ergebnisse erläutert.
3 Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um die Forschungsfragen zu beantworten. Es erläutert das Forschungsdesign, die Operationalisierung der verwendeten Begriffe, die Durchführung der quantitativen Online-Befragung und die Zusammensetzung der Stichprobe. Die Ergebnisse der Befragung werden präsentiert und diskutiert, wobei die einzelnen Hypothesen geprüft und interpretiert werden.
4 Handlungsempfehlungen: Dieses Kapitel enthält Handlungsempfehlungen, die auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung basieren. Es gibt Empfehlungen zum Umgang mit den verschiedenen Wertorientierungen im öffentlichen Dienst und zur Gestaltung einer modernen Arbeitskultur. Die Handlungsempfehlungen fokussieren sich auf das Schaffen von Bewusstsein für Wertorientierungen, die positive Einordnung von Selbstentfaltungswerten, die Schaffung neuer Verantwortungs- und Kreativitätsrollen, die Verbesserung der digitalen Kompetenz, die individuelle Gestaltung von Arbeitszeitmodellen und die Stärkung der virtuellen Zusammenarbeit. Die Notwendigkeit weiterer Forschung wird ebenfalls betont.
Schlüsselwörter
Wertewandel, öffentlicher Dienst, virtuelle Zusammenarbeit, Digitalisierung, demografischer Wandel, Arbeitszufriedenheit, Wertorientierungen, Pflicht- und Akzeptanzwerte, Selbstentfaltungswerte, Personalmanagement, Handlungsempfehlungen, Empirische Untersuchung, Qualitative Forschung, Quantitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Wertewandel im öffentlichen Dienst
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Werte von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, insbesondere im Hinblick auf gute Zusammenarbeit in virtuellen Strukturen. Sie analysiert den Einfluss des Wertewandels, der Digitalisierung und des demografischen Wandels auf die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wertewandel im öffentlichen Dienst und dessen Auswirkungen auf die Arbeitskultur, dem Einfluss der Digitalisierung auf die Zusammenarbeit und die Wertorientierungen der Beschäftigten, der Bedeutung traditioneller und moderner Werte für die Arbeitszufriedenheit und die Zusammenarbeit, den Herausforderungen des demografischen Wandels für das Personalmanagement im öffentlichen Dienst und Handlungsempfehlungen für ein werteorientiertes Personalmanagement.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Ausgangssituation, Problemstellung, Zielsetzung, Methodik), Theoretische Grundlagen (Begriffsbestimmungen, Forschungsstand, aktuelle Rahmenbedingungen), Empirische Untersuchung (Befragung von Beschäftigten, Ergebnisse, Diskussion), Handlungsempfehlungen und Fazit/Ausblick. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Methodik. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar, einschließlich des bisherigen Forschungsstands und der aktuellen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung (quantitative Online-Befragung). Kapitel 4 enthält Handlungsempfehlungen, und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Forschungsmethode, basierend auf einer Online-Befragung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das Kapitel "Empirische Untersuchung" beschreibt detailliert das Forschungsdesign, die Operationalisierung der verwendeten Begriffe, die Durchführung der Befragung und die Zusammensetzung der Stichprobe.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Befragung werden im Kapitel "Empirische Untersuchung" präsentiert und diskutiert. Die Ergebnisse werden im Kontext der Hypothesen interpretiert und liefern die Grundlage für die Handlungsempfehlungen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Handlungsempfehlungen konzentrieren sich auf den Umgang mit verschiedenen Wertorientierungen, die Gestaltung einer modernen Arbeitskultur, das Schaffen von Bewusstsein für Wertorientierungen, die positive Einordnung von Selbstentfaltungswerten, die Schaffung neuer Verantwortungs- und Kreativitätsrollen, die Verbesserung der digitalen Kompetenz, die individuelle Gestaltung von Arbeitszeitmodellen und die Stärkung der virtuellen Zusammenarbeit. Die Notwendigkeit weiterer Forschung wird ebenfalls betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wertewandel, öffentlicher Dienst, virtuelle Zusammenarbeit, Digitalisierung, demografischer Wandel, Arbeitszufriedenheit, Wertorientierungen, Pflicht- und Akzeptanzwerte, Selbstentfaltungswerte, Personalmanagement, Handlungsempfehlungen, Empirische Untersuchung, Quantitative Forschung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" definiert den Begriff "Wert" anhand verschiedener wissenschaftlicher Ansätze und grenzt ihn von verwandten Begriffen ab. Es befasst sich mit dem bisherigen Forschungsstand zum Wertewandel, wobei verschiedene Theorien wie die Postmaterialismus-These von Inglehart und das Wertesynthese-Konzept von Klages vorgestellt und verglichen werden. Die aktuellen Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst (Wertewandel, Arbeitskultur, demografischer Wandel und Digitalisierung) werden analysiert und ihre Bedeutung für die Interpretation der empirischen Ergebnisse erläutert.
- Citation du texte
- Ronny Bätz (Auteur), 2019, Das digitale Zeitalter im öffentlichen Dienst. Wertewandel in der Zusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902353