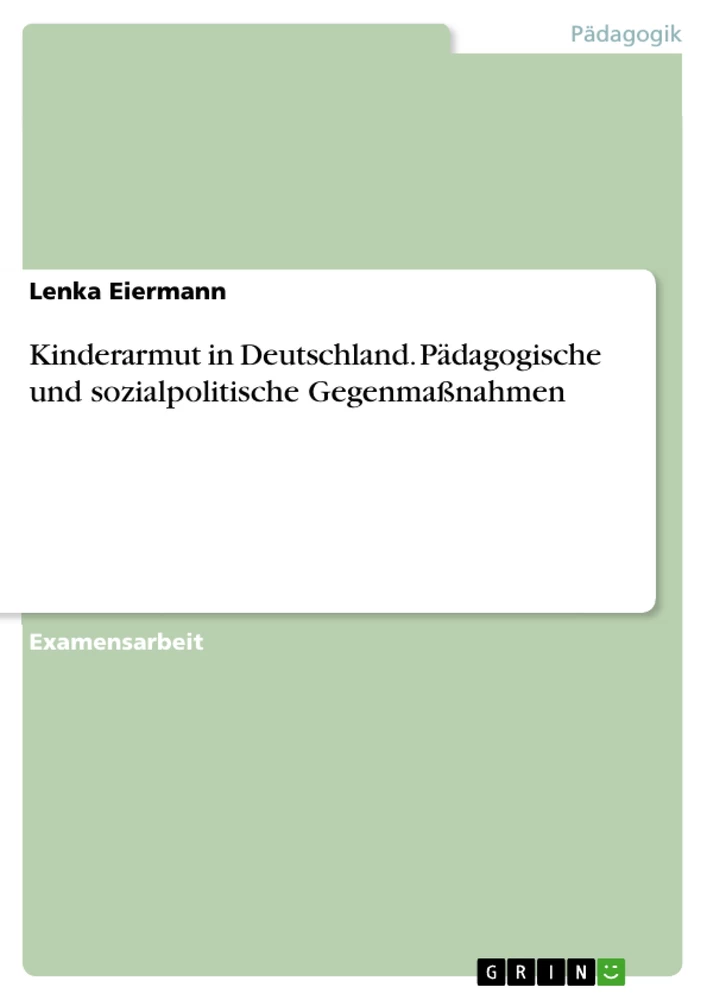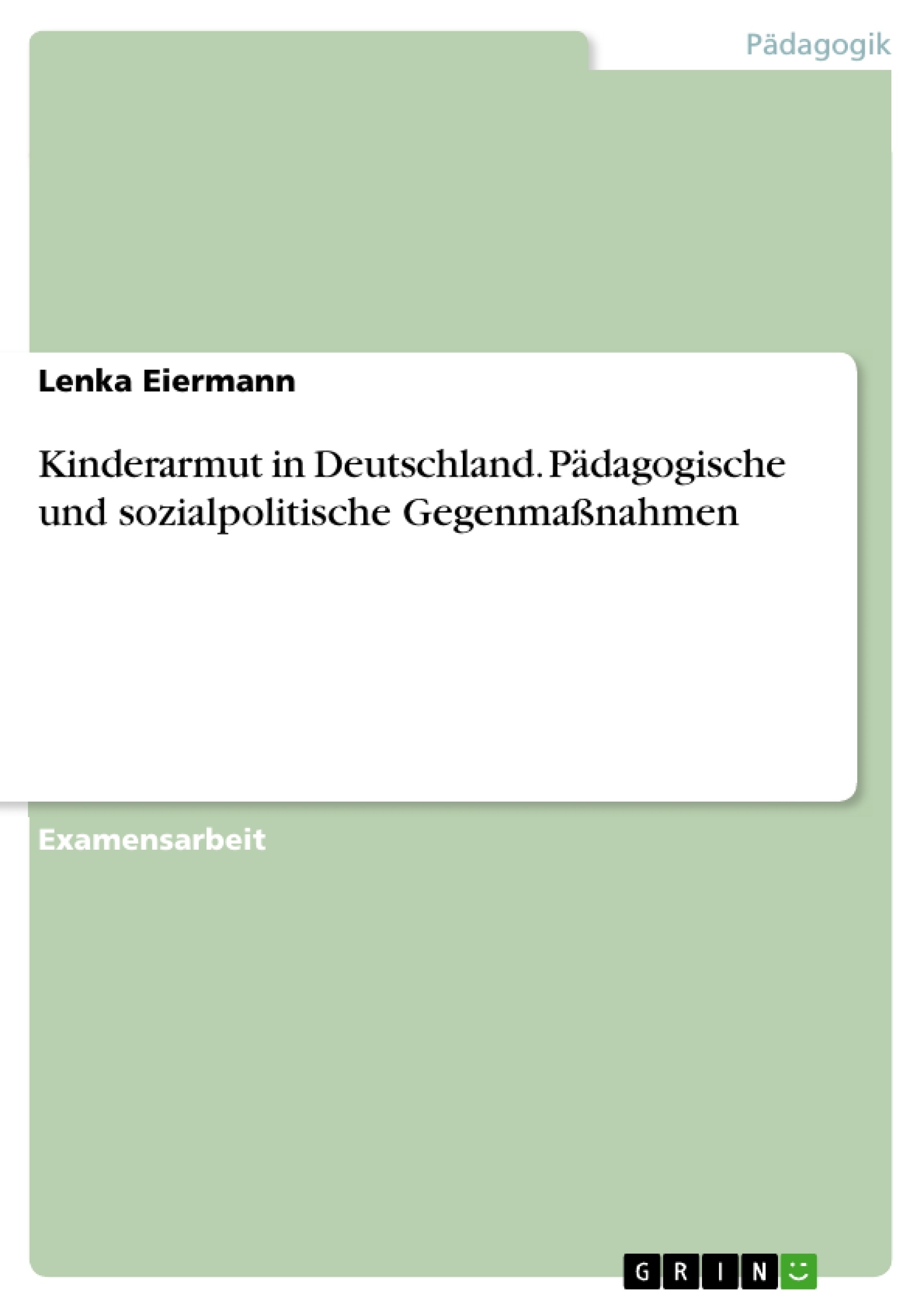Die Annahme, dass Kinder in Deutschland behütet aufwachsen, während in der Dritten Welt Not und Elend herrschen, ist weit verbreitet. Es scheint weder Armengettos in den Außenbezirken der Großstädte wie in den USA noch das Phänomen der Straßenkinder wie in Südamerika zu geben. Doch die Idylle trügt: Obwohl die meisten Kinder in Deutschland in gesicherten Verhältnissen aufwachsen, sind sie, nach jeder Definition, unter den Armen die am stärksten vertretene Gruppe. Derzeit lebt hier fast jedes zehnte Kind in relativer Armut - das sind nach amtlicher Statistik 1,5 Millionen der unter 18-jährigen, nach neuesten Angaben sind es sogar 2,5 Millionen.
In deutschen Großstädten ist eine sozialräumliche Segregation von finanziell schlecht gestellten Menschen zu beobachten, es gibt also Wohnviertel, in denen überwiegend Sozialhilfeempfänger leben. Insbesondere Kinder aus Ein-Eltern-Familien, mit vielen Geschwistern oder mit Migrationshintergrund haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Da der Risikofaktor „Migration“ den Umfang dieser Hausarbeit sprengen würde, wird auf ihn nur am Rande eingegangen.
Dass sich Armut in einer reichen, wohlhabenden Gesellschaft deprimierender, bedrückender und bedrängender auswirkt als in einer armen Gesellschaft, wo sie zu Solidarisierung und nicht zur Stigmatisierung und Ausgrenzung der Betroffenen führt, findet wenig Beachtung. Bereits im Kindesalter macht sich bei vielen Betroffenen eine soziale Exklusion und eine Perspektivlosigkeit bemerkbar.
Kinderarmut wird in den Medien und in Fachdiskussionen immer mehr als gesamtgesellschaftliches und nicht mehr als individuelles Problem wahrgenommen. So stand das Phänomen auch im Mittelpunkt des diesjährigen Weltkindertages sowie der Nationalen Armutskonferenz. Hier wurde die Forderung laut, das Existenzminimum von Kindern neu zu berechnen, da der derzeitige Sozialhilfesatz den Bedarf von Kindern nicht ausreichend decke. Sowohl in Zeitungen als auch im Fernsehen wird das Thema Kinderarmut immer präsenter. Es gibt immer häufiger Dokumentationen über arme Familien, Talk-Shows, in denen Politiker und Betroffene diskutieren, oder auch, insbesondere auf den privaten Fernsehsendern, Sendungen, die sich mit Verschuldung befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- TEIL A
- I. Definition von Armut
- II. Kinderarmut in Deutschland
- 2.1. Kinderarmutsentwicklung
- 2.1.1. Auslöser von Kinderarmut
- 2.1.2. Formen von Kinderarmut
- 2.2. Die aktuelle Situation in Deutschland
- 2.3. Kinderarmut im internationalen Vergleich
- 2.4. Tendenzen
- III. Auswirkungen von Armutslagen bei Kindern
- 3.1. Psychosoziale Folgen
- 3.2. Gesundheitliche Folgen
- 3.3. Bewältigungsstrategien
- Exkurs: Auswirkungen von Kinderarmut auf den Schulerfolg
- TEIL B
- IV. Präventionsmaßnahmen gegen Kinderarmut
- 4.1. Gegenstrategien der Bundesregierung
- 4.1.1. Sozialpolitische Gegenstrategien
- 4.1.2. Familienpolitische Gegenstrategien
- 4.1.3. Pädagogische Gegenstrategien
- V. Projekte zur Förderung armer Kinder
- 5.1. Initiatoren von Projekten
- 5.2. Die Arche
- 5.3. Mo.Ki-Monheim für Kinder
- Endresümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht das Problem der Kinderarmut in Deutschland. Ziel ist es, die Ursachen, Auswirkungen und mögliche Gegenmaßnahmen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der aktuellen Situation, der Analyse sozialer und gesundheitlicher Folgen sowie der Vorstellung von präventiven Strategien und konkreten Projekten.
- Definition und Entwicklung von Kinderarmut in Deutschland
- Auswirkungen von Kinderarmut auf die psychosoziale und gesundheitliche Entwicklung
- Analyse sozialpolitischer, familienpolitischer und pädagogischer Gegenmaßnahmen
- Vorstellung konkreter Projekte zur Förderung armer Kinder
- Internationaler Vergleich der Kinderarmutsquoten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die weit verbreitete, aber irreführende Annahme in Frage, dass Kinderarmut in Deutschland kein relevantes Problem sei. Sie unterstreicht die hohe Zahl von Kindern in relativer Armut und die damit verbundene soziale Exklusion und Perspektivlosigkeit. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil gliedert. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, Kinderarmut als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten und die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen zu betonen.
I. Definition von Armut: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition von Armut. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von politischen Grenzziehungen bis hin zu mehrdimensionalen Definitionsansätzen aus der Armutsforschung. Die verschiedenen Perspektiven werden einander gegenübergestellt, um ein umfassendes Verständnis des Begriffs Armut zu schaffen und die Herausforderungen bei der Messung von Armut zu beleuchten. Dies legt die Grundlage für die folgende Analyse der Kinderarmut.
II. Kinderarmut in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Kinderarmut in Deutschland. Es werden die Auslöser und Ursachen der Kinderarmut untersucht, wobei der höhere Anteil armer Kinder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung hervorgehoben wird. Verschiedene Formen der Kinderarmut, wie beispielsweise Kindesvernachlässigung, werden dargestellt. Die aktuelle Situation in Deutschland wird anhand aktueller statistischer Daten beschrieben (wobei die Einschränkungen durch die Verzögerung bei der Datenverarbeitung erwähnt werden). Ein internationaler Vergleich mit anderen OECD-Ländern wird durchgeführt, um die deutsche Situation einzuordnen und Tendenzen in der Entwicklung der Kinderarmutsquote aufzuzeigen.
III. Auswirkungen von Armutslagen bei Kindern: Dieses Kapitel widmet sich den negativen Auswirkungen von Armut auf die Entwicklung von Kindern. Es werden sowohl psychosoziale als auch gesundheitliche Folgen detailliert beschrieben und deren Langzeitfolgen auf das spätere Erwachsenenleben der Betroffenen beleuchtet. Der Fokus liegt darauf, warum Armutsfolgen auftreten und welche am häufigsten zu beobachten sind. Die verschiedenen Bewältigungsstrategien von Kindern in Armutssituationen werden untersucht, inklusive einer Betrachtung möglicher geschlechtsspezifischer Unterschiede in den Auswirkungen und der Bewältigung von Armut. Ein Exkurs beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Schulerfolg, untersucht warum Kinder aus armen Familien oftmals niedrigere Schulabschlüsse erreichen als ihre nichtarmen Altersgenossen.
IV. Präventionsmaßnahmen gegen Kinderarmut: Dieses Kapitel präsentiert Möglichkeiten der Armutsprävention und der Bekämpfung der Armutsfolgen. Es werden die Strategien der Bundesregierung im Detail analysiert, aufgeteilt in sozialpolitische, familienpolitische und pädagogische Maßnahmen. Dieser Teil der Arbeit bewertet die Effektivität der bestehenden Maßnahmen und identifiziert mögliche Stärken und Schwächen.
V. Projekte zur Förderung armer Kinder: Dieses Kapitel stellt konkrete Projekte zur Förderung armer Kinder vor, wobei die verschiedenen Initiatoren dieser Projekte vorgestellt und verschiedene Projekte beispielhaft analysiert werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung und Bewertung unterschiedlicher Ansätze zur Unterstützung von Kindern in Armut.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Deutschland, Armutsforschung, Sozialpolitik, Familienpolitik, Pädagogik, Prävention, Armutsfolgen, psychosoziale Entwicklung, Gesundheit, Schulerfolg, Projekte, soziale Exklusion, Existenzminimum, OECD-Länder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Kinderarmut in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend das Thema Kinderarmut in Deutschland. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Armut, eine Analyse der Kinderarmut in Deutschland (inkl. Entwicklung, Auslöser, Formen, internationaler Vergleich), die Auswirkungen von Kinderarmut (psychosozial, gesundheitlich), Präventionsmaßnahmen der Bundesregierung (sozialpolitisch, familienpolitisch, pädagogisch) und eine Vorstellung konkreter Projekte zur Förderung armer Kinder. Ein Exkurs befasst sich mit dem Einfluss von Kinderarmut auf den Schulerfolg.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Ursachen, Auswirkungen und möglichen Gegenmaßnahmen zur Kinderarmut in Deutschland. Der Fokus liegt auf der aktuellen Situation, der Analyse sozialer und gesundheitlicher Folgen sowie der Vorstellung präventiver Strategien und konkreter Projekte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Teil A befasst sich mit der Definition von Armut, der Analyse der Kinderarmut in Deutschland und deren Auswirkungen. Teil B präsentiert Präventionsmaßnahmen und stellt konkrete Projekte vor. Die Arbeit enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Definition von Armut wird verwendet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze zur Definition von Armut, von politischen Grenzziehungen bis hin zu mehrdimensionalen Definitionsansätzen aus der Armutsforschung. Die verschiedenen Perspektiven werden einander gegenübergestellt, um ein umfassendes Verständnis des Begriffs Armut zu schaffen und die Herausforderungen bei der Messung von Armut zu beleuchten.
Wie wird die Kinderarmut in Deutschland dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Kinderarmut in Deutschland, untersucht deren Auslöser und Ursachen und beschreibt die aktuelle Situation anhand statistischer Daten (unter Berücksichtigung der Datenverzögerungen). Ein internationaler Vergleich mit anderen OECD-Ländern wird durchgeführt, um die deutsche Situation einzuordnen und Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. Verschiedene Formen der Kinderarmut werden ebenfalls dargestellt.
Welche Auswirkungen von Kinderarmut werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die psychosozialen und gesundheitlichen Folgen von Kinderarmut und deren Langzeitfolgen. Sie untersucht verschiedene Bewältigungsstrategien von Kindern in Armutssituationen und betrachtet mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Schulerfolg.
Welche Präventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die Strategien der Bundesregierung zur Prävention von Kinderarmut, unterteilt in sozialpolitische, familienpolitische und pädagogische Maßnahmen. Die Effektivität der bestehenden Maßnahmen wird bewertet, und Stärken und Schwächen werden identifiziert.
Welche Projekte zur Förderung armer Kinder werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Projekte zur Förderung armer Kinder vor, präsentiert deren Initiatoren und analysiert beispielhaft unterschiedliche Ansätze zur Unterstützung von Kindern in Armut.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderarmut, Deutschland, Armutsforschung, Sozialpolitik, Familienpolitik, Pädagogik, Prävention, Armutsfolgen, psychosoziale Entwicklung, Gesundheit, Schulerfolg, Projekte, soziale Exklusion, Existenzminimum, OECD-Länder.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die detaillierte Ausarbeitung der oben genannten Punkte findet sich im vollständigen Text der wissenschaftlichen Hausarbeit.
- Quote paper
- Lenka Eiermann (Author), 2007, Kinderarmut in Deutschland. Pädagogische und sozialpolitische Gegenmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90204