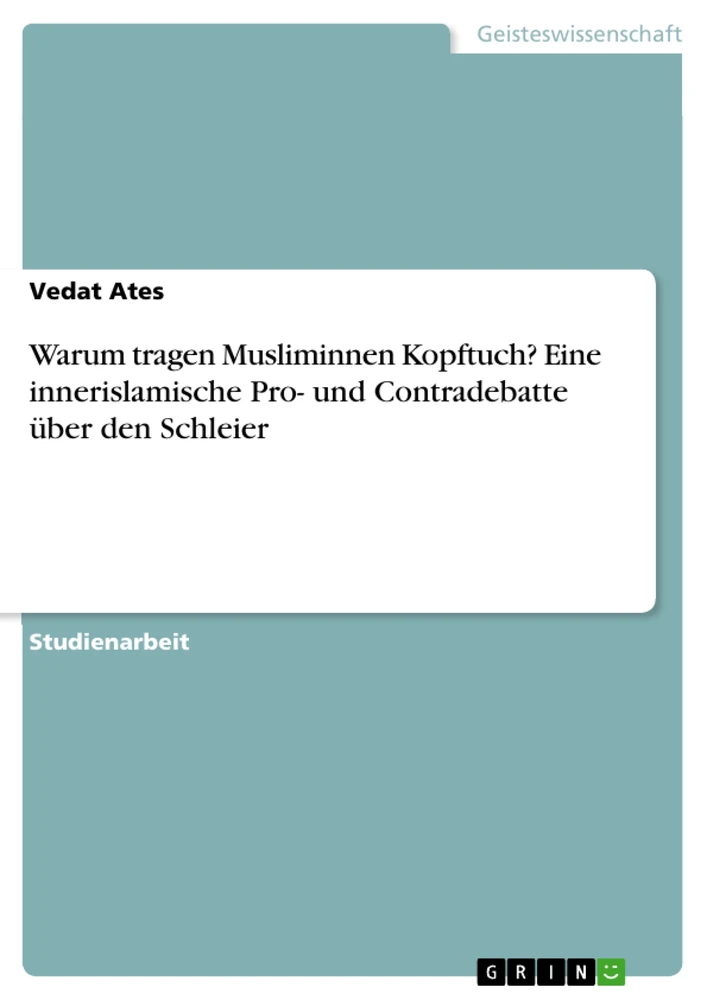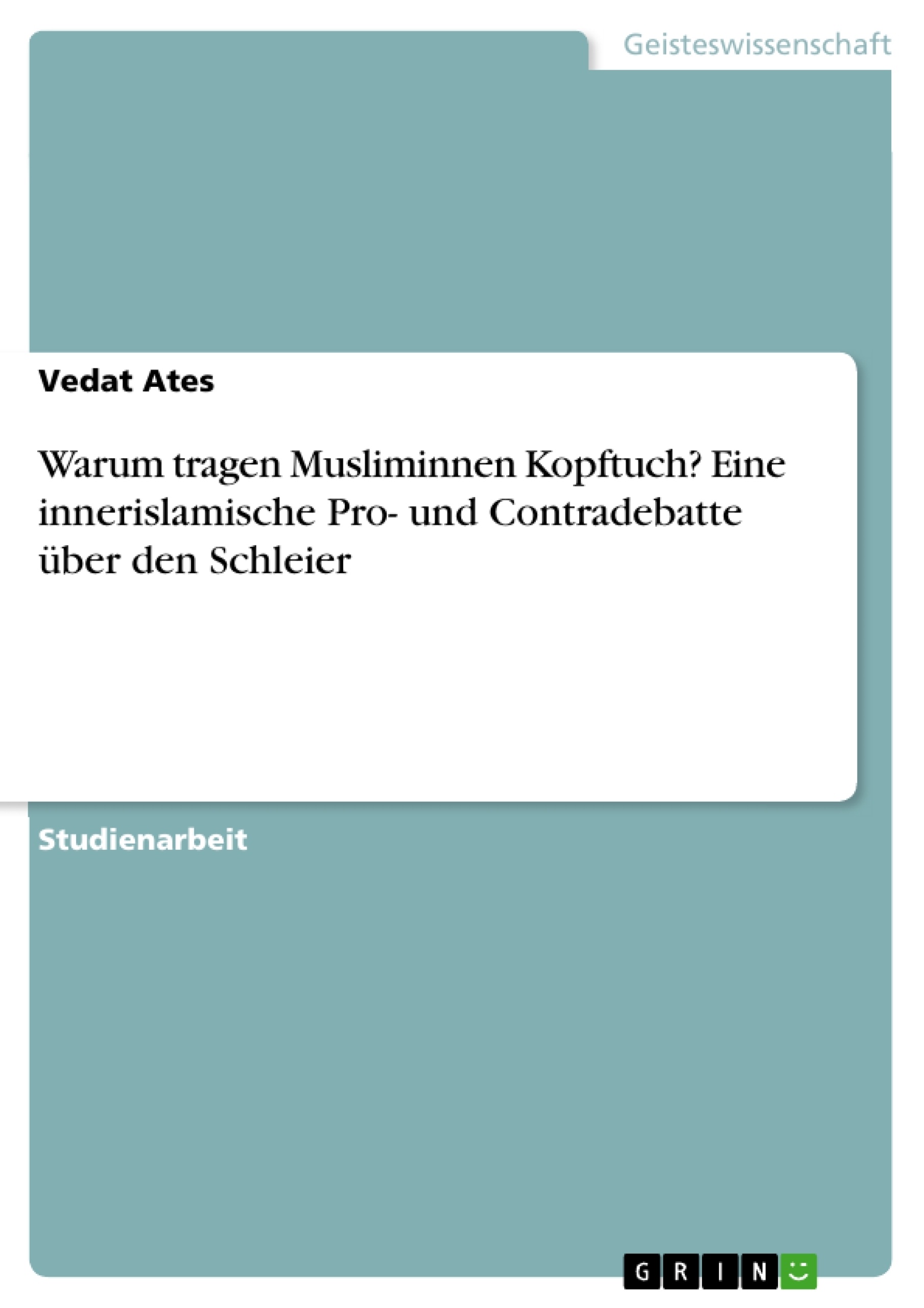Es ist das Ziel dieser Arbeit, herauszukristallisieren, ob die Frauen Kopftuch tragen, weil sie glauben, dass Koran und Islam das verlangen und dass sie sich Gott und seiner Offenbarung zuliebe verschleiern oder ob es andere Gründe gibt: der Zwang einer patriarchalischen Familienstruktur, Erziehung oder islamischer Druck vom Herkunftsland über Institutionen wie die Moschee und Koranschulen.
Es werden in einem ersten Schritt diejenigen Koranstellen, welche Aussagen über den Schleier machen, mit der Hilfe von Fachliteratur und dem Koran untersucht. In einem zweiten Teil werden Aussagen von Kopftuchträgerinnen zum Thema, warum sie sich in Europa bzw. in der Schweiz verschleiern, im Zentrum stehen. Damit das Thema aber besser verknüpft und nachvollziehbar gemacht werden kann, wird interne (d.h. zwischen Muslim*innen) Kritik an den Begründungen, welche die Befürworter*innen bringen, aufgezeigt.
Am Schluss wird die Akzeptanz des Kopftuches auf gesellschaftlicher und gesetzlicher Ebene hier in der Schweiz betrachtet. Für die Analyse wird die Theorie der „Panoptischen männlichen Herrschaft“ von Dietz Gabriella verwendet. Es ist offensichtlich, dass so ein komplexes Thema nicht in einer Proseminararbeit vielfältig und vollendendet erläutert werden kann. Mein Ziel ist aber, mit dieser Proseminararbeit einen Denkanstoss zu liefern, der die Grenzen zwischen kulturellen Phänomenen, Religionsfreiheit und Geschlecht abtastet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. WAS STEHT IM KORAN?
- 3. WIESO TRAGEN MUSLIM*INNEN KOPFTUCH?
- 3.1. PRO-ARGUMENTE
- 3.2. CONTRA-ARGUMENTE
- 4. SEXUALISIERUNG DER FRAU UND PANOPTISCHE MÄNNLICHE HERRSCHAFT
- 6. DIE KULTUREN TREFFEN SICH UND WAS DANN?
- 6.1. VORURTEILSFREIE AUSEINANDERSETZUNG
- 7. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für das Tragen des Kopftuchs bei muslimischen Frauen. Sie analysiert die Rolle des Korans und der Hadithe, beleuchtet Pro- und Contra-Argumente innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und betrachtet den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren, wie die Sexualisierung der Frau und patriarchaler Strukturen. Das Ziel ist es, einen Denkanstoß zu liefern, der die komplexen Zusammenhänge zwischen kulturellen Phänomenen, Religionsfreiheit und Geschlechterrollen diskutiert.
- Die Interpretation von Koranversen zum Thema Schleier und Kopftuch.
- Pro- und Contra-Argumente zum Kopftuchtragen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft.
- Der Einfluss gesellschaftlicher und patriarchaler Strukturen auf die Kopftuchfrage.
- Die Rolle der Sexualisierung der Frau im Kontext des Kopftuchs.
- Die gesellschaftliche Akzeptanz des Kopftuchs in der Schweiz.
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung präsentiert den aktuellen Diskurs um das Kopftuch, ausgehend von Beispielen wie dem Besuch von Micheline Calmy-Rey im Iran. Sie verdeutlicht die unterschiedlichen Interpretationen des Kopftuchs – von Unterdrückungssymbol bis religiöses Identitätsmerkmal – und leitet zur zentralen Forschungsfrage über: Tragen Frauen Kopftuch aus religiöser Überzeugung oder aufgrund anderer Einflüsse wie familiärer oder gesellschaftlicher Druck?
2. WAS STEHT IM KORAN?: Dieses Kapitel analysiert relevante Koranstellen, die im Zusammenhang mit dem Schleier diskutiert werden. Es wird deutlich, dass der Koran keine eindeutige Vorschrift zum Kopftuchtragen enthält, sondern eher auf die allgemeine Schambedeckung von Frauen hinweist. Die Interpretation dieser Verse variiert stark je nach Kontext und theologischer Ausrichtung. Die unterschiedlichen Übersetzungen und Interpretationen des Korans werden hier als zentraler Punkt für die Vielfalt der Meinungen zum Kopftuch hervorgehoben.
3. WIESO TRAGEN MUSLIM*INNEN KOPFTUCH?: Dieses Kapitel erörtert die verschiedenen Gründe, die von muslimischen Frauen für das Tragen des Kopftuchs genannt werden. Es werden sowohl die Argumente der Befürworterinnen als auch die Kritikpunkte innerhalb der muslimischen Gemeinschaft dargelegt. Die Zusammenfassung zeigt auf, dass die Gründe vielschichtig sind und religiöse Überzeugungen mit soziokulturellen und gesellschaftlichen Faktoren verwoben sind. Die historische Entwicklung des Kopftuchs und seine pragmatische Nutzung in der Vergangenheit werden ebenfalls angesprochen.
4. SEXUALISIERUNG DER FRAU UND PANOPTISCHE MÄNNLICHE HERRSCHAFT: Dieses Kapitel analysiert die Sexualisierung der Frau im Kontext des Kopftuchs, möglicherweise unter Bezugnahme auf die "Panoptische männliche Herrschaft" als theoretisches Framework. Es untersucht, wie gesellschaftliche Normen und Machtstrukturen die Wahrnehmung und Bedeutung des Kopftuchs beeinflussen. Die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen, die zur Entstehung und Verbreitung des Kopftuchs führten, werden hier umfassend diskutiert.
6. DIE KULTUREN TREFFEN SICH UND WAS DANN?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begegnung verschiedener Kulturen und der damit verbundenen Herausforderungen im Umgang mit dem Kopftuch. Es wird wahrscheinlich die Bedeutung von Vorurteilsfreiheit und interkulturellem Verständnis im Kontext des Kopftuchs diskutiert. Die Analyse untersucht, wie die verschiedenen Perspektiven aufeinander treffen und wie ein respektvoller Umgang mit kulturellen Unterschieden geschaffen werden kann.
Schlüsselwörter
Kopftuch, Islam, Koran, Hadithe, Religionsfreiheit, Geschlechterrollen, Sexualisierung, Patriarchat, Kulturelle Identität, Interkultureller Dialog, Gesellschaftliche Akzeptanz, Schweiz, Muslimische Frauen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Kopftuch und muslimische Frauen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gründe für das Tragen des Kopftuchs bei muslimischen Frauen. Sie analysiert die Rolle des Korans und der Hadithe, beleuchtet Pro- und Contra-Argumente innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und betrachtet den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren wie die Sexualisierung der Frau und patriarchaler Strukturen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte einen Denkanstoß liefern und die komplexen Zusammenhänge zwischen kulturellen Phänomenen, Religionsfreiheit und Geschlechterrollen im Kontext des Kopftuchs diskutieren. Sie zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis für die vielschichtigen Gründe des Kopftuchtragens zu schaffen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interpretation von Koranversen zum Thema Schleier und Kopftuch, Pro- und Contra-Argumente zum Kopftuchtragen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, den Einfluss gesellschaftlicher und patriarchaler Strukturen, die Rolle der Sexualisierung der Frau im Kontext des Kopftuchs und die gesellschaftliche Akzeptanz des Kopftuchs (am Beispiel der Schweiz).
Wie wird der Koran in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert relevante Koranstellen, die im Zusammenhang mit dem Schleier diskutiert werden. Es wird gezeigt, dass der Koran keine eindeutige Vorschrift zum Kopftuchtragen enthält, sondern eher auf die allgemeine Schambedeckung von Frauen hinweist. Die unterschiedlichen Interpretationen dieser Verse und ihre Abhängigkeit vom Kontext und der theologischen Ausrichtung werden hervorgehoben.
Welche Argumente für und gegen das Kopftuchtragen werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert sowohl Pro- als auch Contra-Argumente zum Kopftuchtragen, die innerhalb der muslimischen Gemeinschaft diskutiert werden. Es wird deutlich, dass die Gründe für das Tragen des Kopftuchs vielschichtig sind und religiöse Überzeugungen mit soziokulturellen und gesellschaftlichen Faktoren verwoben sind.
Welche Rolle spielt die Sexualisierung der Frau?
Die Arbeit analysiert die Sexualisierung der Frau im Kontext des Kopftuchs und untersucht, wie gesellschaftliche Normen und Machtstrukturen die Wahrnehmung und Bedeutung des Kopftuchs beeinflussen. Die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen, die zur Entstehung und Verbreitung des Kopftuchs beitrugen, werden diskutiert.
Wie wird der interkulturelle Aspekt behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Begegnung verschiedener Kulturen und den Herausforderungen im Umgang mit dem Kopftuch. Sie betont die Bedeutung von Vorurteilsfreiheit und interkulturellem Verständnis und untersucht, wie verschiedene Perspektiven aufeinander treffen und wie ein respektvoller Umgang mit kulturellen Unterschieden geschaffen werden kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kopftuch, Islam, Koran, Hadithe, Religionsfreiheit, Geschlechterrollen, Sexualisierung, Patriarchat, Kulturelle Identität, Interkultureller Dialog, Gesellschaftliche Akzeptanz, Schweiz, Muslimische Frauen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels: Einleitung, Analyse des Korans, Gründe für das Kopftuchtragen, Sexualisierung der Frau und panoptische männliche Herrschaft, Begegnung verschiedener Kulturen und Fazit. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt und die Argumentation jedes Kapitels.
- Quote paper
- Vedat Ates (Author), 2018, Warum tragen Musliminnen Kopftuch? Eine innerislamische Pro- und Contradebatte über den Schleier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/901761