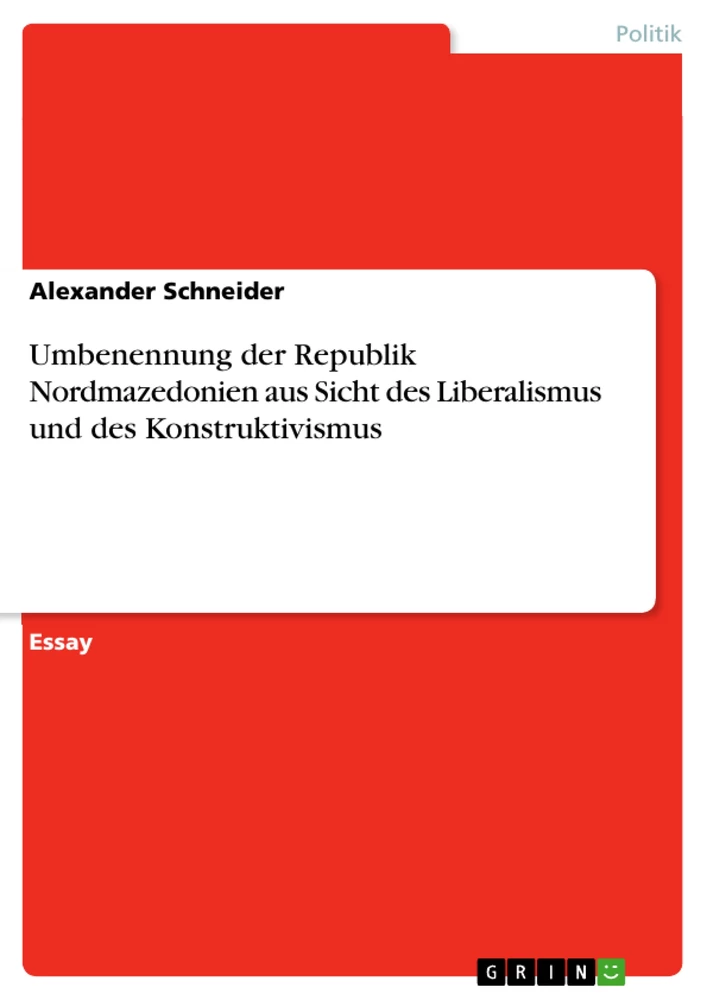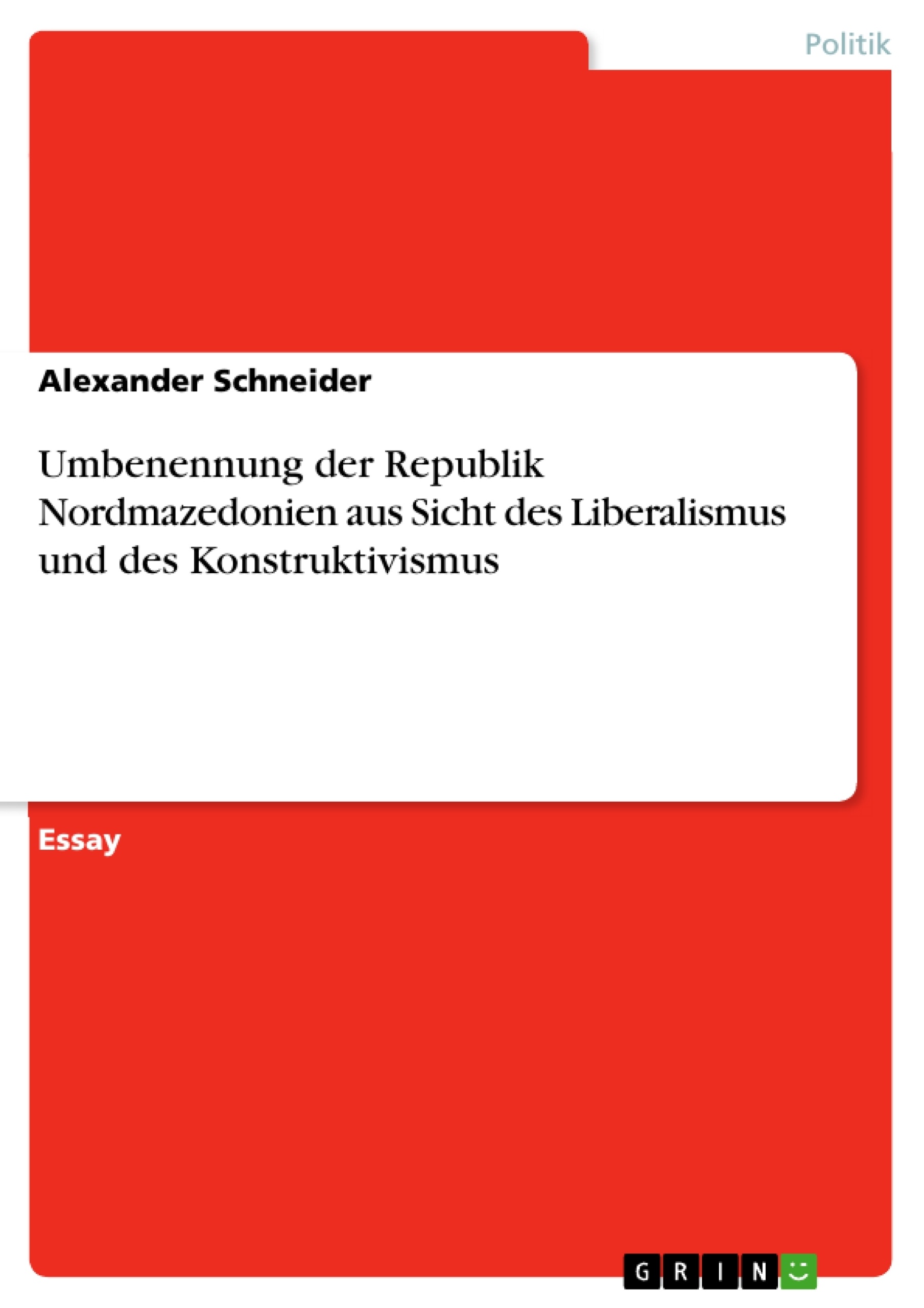Am 12. Februar 2019 konnte ein lange andauernder Konflikt im Südosten Europas nach jahrzehntelanger Uneinigkeit beigelegt werden: die Republik Mazedonien – im internationalen Verkehr auch "ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien" genannt – benannte sich endgültig in "Republik Nordmazedonien" um. Grund dafür war der seit der Unabhängigkeit des Landes 1991 bestehende Widerstand vom südlichen Nachbarn Griechenland, der den Begriff Makedonien und das zugehörige kulturelle Erbe allein für sich beanspruchte. Durch Vetos gegen eine mazedonische EU- und NATO-Mitgliedschaft versuchte Athen eine Namensänderung zu erzwingen, doch Skopje blieb hartnäckig. Das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarstaaten war stets angespannt.
Nun kam es nach knapp drei Jahrzehnten Streit also doch zu einem Kompromiss. Wie lässt sich der plötzliche Kurswechsel beider Regierungen erklären? Die politikwissenschaftlichen Theorien des Konstruktivismus und des Liberalismus versuchen, darauf Antworten zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Der Namensstreit zwischen Griechenland und Nordmazedonien
- Historischer Hintergrund
- Politische Folgen des Namensstreits
- Das Prespa-Abkommen
- Auswirkungen des Abkommens
- Theorien der Internationalen Beziehungen als Erklärungsgrundlage
- Der Liberalismus
- Grundlagen des Liberalismus
- Der Liberalismus als Erklärung für den Namensstreit
- Der Konstruktivismus
- Grundlagen des Konstruktivismus
- Der Konstruktivismus als Erklärung für den Namensstreit
- Der Konflikt und die „security communities“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den jahrelangen Namensstreit zwischen Griechenland und Nordmazedonien, der im Februar 2019 mit dem Prespa-Abkommen beigelegt wurde.
- Der historische Konflikt und seine politischen Folgen
- Die Rolle von Theorien der Internationalen Beziehungen in der Analyse des Konflikts
- Die Relevanz des Liberalismus und des Konstruktivismus für die Erklärung des Abkommens
- Das Konzept der „security communities“ im Kontext des Namensstreits
- Die Bedeutung des Prespa-Abkommens für die Zukunft der Beziehungen zwischen Griechenland und Nordmazedonien
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Textes beschreibt den historischen Hintergrund des Namensstreits, beginnend mit der Unabhängigkeit Mazedoniens von Jugoslawien im Jahr 1991. Er beleuchtet die griechischen Gebietsansprüche und die daraus resultierenden Blockaden für eine Annäherung Mazedoniens an den Rest Europas. Anschließend wird das Prespa-Abkommen und seine Auswirkungen auf die Beziehungen der beiden Länder dargestellt.
Der zweite Teil des Textes fokussiert auf die Relevanz von Theorien der Internationalen Beziehungen, speziell des Liberalismus und des Konstruktivismus, zur Analyse des Namensstreits. Der Liberalismus wird als Theorie vorgestellt, die das Handeln von Staaten auf der Grundlage des Nutzens und der Kosten rationaler Entscheidungen erklärt. Im Kontext des Prespa-Abkommens werden die Vorteile für beide Länder, wie z.B. verbesserte wirtschaftliche Beziehungen und eine verstärkte Integration in die europäische Gemeinschaft, als Hauptmotive für die Einigung herausgestellt.
Der Konstruktivismus wird als eine Theorie vorgestellt, die die Konstruktion von Identität als Grundlage für das Handeln von Staaten sieht. Der Text zeigt auf, wie die Identifikation mit dem Begriff "Mazedonien" auf beiden Seiten des Konflikts den Konflikt erst ausgelöst hat. Es wird erklärt, wie das Prespa-Abkommen im Kontext des konstruktivistischen Konzepts der "security communities" eine neue Form der Identifikation ermöglicht, welche die Zusammenarbeit und die Integration in europäische Strukturen unterstützt.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt Themen wie International Beziehungen, Liberalismus, Konstruktivismus, Namensstreit, Nationalismus, Sicherheitsgemeinschaft, Identität, Prespa-Abkommen, Griechenland, Nordmazedonien, NATO, EU, Balkan.
- Citar trabajo
- Alexander Schneider (Autor), 2019, Umbenennung der Republik Nordmazedonien aus Sicht des Liberalismus und des Konstruktivismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/901634