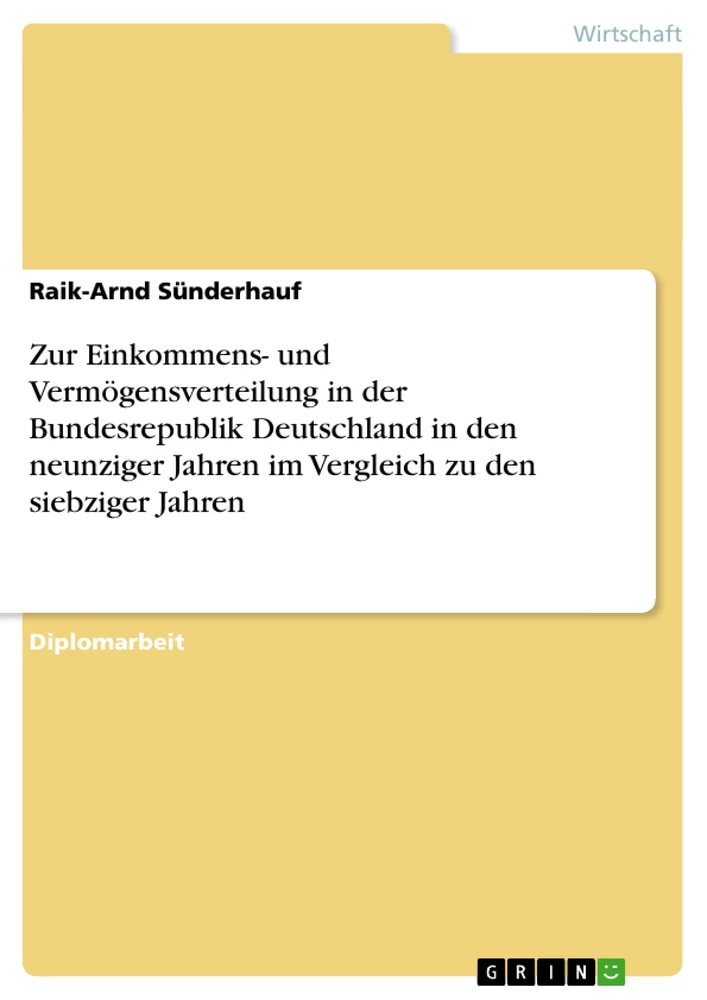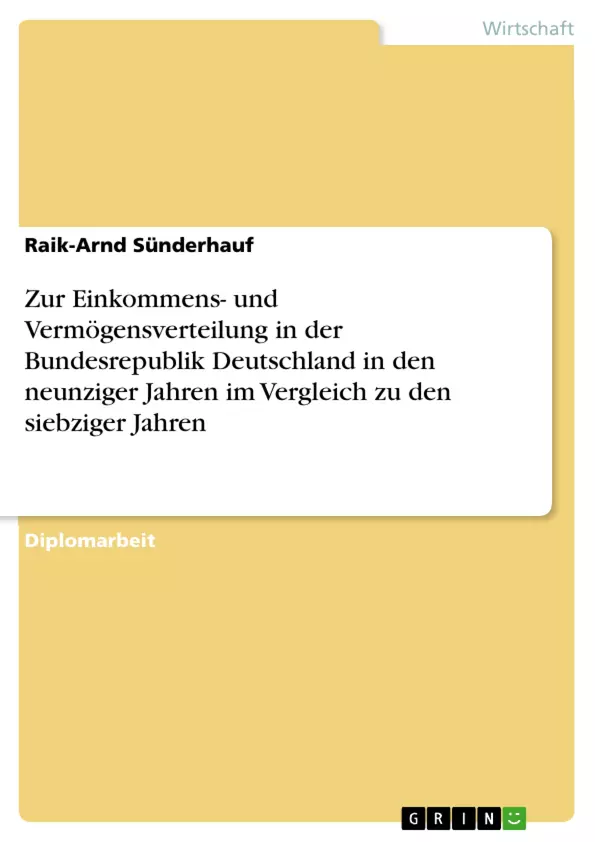Das Problem der Größenverteilung der Einkommen und Vermögen zwischen den Angehörigen
eines Staates, einer Region oder einer Wirtschaftsordnung beschäftigt die Menschen,
seit sie wirtschaften. Von Aristoteles stammt die Erkenntnis: „Armut ist die Mutter von
Gewalt und Verbrechen.“ Angestrebt wurde und wird eine möglichst gerechte Verteilung der
Güter. Was aber eine gerechte Verteilung ist und wie man sie erreichen kann, darüber
herrschen von je her unterschiedliche Auffassungen.
In der Bundesrepublik Deutschland wird besonders seit den 80-er Jahren unter Ökonomen,
Sozialpolitikern, aber auch in der Öffentlichkeit eine Diskussion geführt, wie das nach dem
zweiten Weltkrieg entwickelte Modell der sozialen Marktwirtschaft die Anforderungen der
Gegenwart und Zukunft meistern kann. Besorgt werden Veränderungen registriert.
Im Jahr 1997 schrieb der „Spiegel“ unter dem Titel „Die gespaltene Gesellschaft“: „ Die
einen sind arbeitslos, die anderen mehren an der Börse und mit Spitzengehältern ihr Vermögen:
Arm und Reich driften in Deutschland auseinander, und in der Mittelschicht wächst die
Angst vor dem Absturz – mit gefährlichen Folgen. Wie viel Ungleichheit verträgt die
Demokratie?“ (Der Spiegel, Heft 40, 29.09.1997, S. 86)
Es ist zu fragen, ob die so beschriebene Wahrnehmung der gesellschaftlichen Entwicklung
zutreffend ist, ob es nur Einzelfälle sind, die sich vielleicht empirisch belegen lassen oder ob
sich anhand vorhandener Daten mit wissenschaftlichen Methoden Veränderungen der Einkommens-
und Vermögensverteilung untersuchen und nachweisen lassen, und welchen
Einfluss der Staat darauf ausüben kann.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Geschichtlicher Überblick unter volkswirtschaftlichen und politischen Aspekten
- 1.1. Ökonomische und politische Rahmenbedingungen in den siebziger Jahren
- 1.2. Die ökonomische und politische Situation in Deutschland in den neunziger Jahren
- 2. Die Einkommensverteilung und deren Entwicklung in den neunziger Jahren im Vergleich zu den siebziger Jahren
- 2.1. Die Datenbasis und die Aussagekraft bisher vorliegender Untersuchungen
- 2.1.1. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- 2.1.2. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- 2.1.3. Das Sozio-Ökonomische Panel
- 2.1.4. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik
- 2.1.5. Der Mikrozensus
- 2.2. Die funktionelle Einkommensverteilung als Ergebnis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 2.3. Die Größenverteilung der Einkommen
- 2.3.1. Der Gini-Koeffizient als Maßzahl zur Einkommenskonzentration
- 2.3.2. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik
- 2.3.3. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- 2.3.3.1. Die Brutto- und Nettoeinkommen der Haushalte
- 2.3.3.2. Die Äquivalenzeinkommen
- 2.3.3.3. Die Anteile der Einkommensarten
- 2.4. Die relative Einkommensposition sozialer Gruppen
- 2.5. Regionale Einkommensverteilung
- 3. Die Vermögensverteilung im Vergleich
- 3.1. Datenbasis und Vermögensbegriff
- 3.2. Die Konzentration der Vermögen nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- 3.2.1. Übersicht über die Verbreitung einzelner Vermögensformen
- 3.2.2. Die Verteilung des Immobilienvermögens
- 3.2.3. Die Verteilung des Geldvermögens
- 3.2.4. Regionale Vermögensverteilung
- 3.3. Die Verteilung des Produktivvermögens
- 3.4. Das Humanvermögen
- 4. Volkswirtschaftliche Probleme, die durch die gegebene Situation der Einkommens- und Vermögensverteilung entstehen
- 4.1. Wohlfahrtsverluste durch Ungleichverteilung
- 4.2. Absolute Armut und Sozialhilfe
- 4.3. Relative Einkommensarmut
- 5. Die Verteilungswirkungen staatlicher Finanzpolitik
- 5.1. Staatliche Instrumente der Umverteilung
- 5.2. Ansatzpunkte und quantitative Bedeutung staatlicher Verteilungspolitik nach Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 5.3. Verteilungswirkung von staatlichen Aktivitäten
- 5.3.1. Die Hauptwirkungsverläufe von staatlichen Eingriffen
- 5.3.2. Die kurzfristige Inzidenz einer mengenproportionalen speziellen Verbrauchssteuer im Modell eines Konkurrenzmarktes
- 5.3.3. Die Inzidenz der ökologischen Steuerreform in einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
- 5.3.4. Die Inzidenz einer allgemeinen Verbrauchssteuer und ihrer Erhöhung
- 5.3.5. Verteilungswirkungen von direkten Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland in den 1990er Jahren im Vergleich zu den 1970er Jahren. Ziel ist es, Veränderungen der Verteilung aufzuzeigen und den Einfluss des Staates zu analysieren. Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Datenquellen und methodische Ansätze.
- Entwicklung der Einkommensverteilung über die Zeit
- Analyse der Vermögensverteilung und deren Konzentration
- Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Einkommens- und Vermögensungleichheit
- Wirkung staatlicher Finanzpolitik auf die Einkommens- und Vermögensverteilung
- Methodische Vergleichbarkeit verschiedener Datenquellen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Einkommens- und Vermögensverteilung ein und verdeutlicht die Relevanz der Thematik unter Bezugnahme auf gesellschaftliche Diskussionen und den Spiegel-Artikel von 1997. Sie benennt die Forschungsfrage, ob sich anhand von Daten Veränderungen nachweisen lassen und welchen Einfluss der Staat hat.
1. Geschichtlicher Überblick unter volkswirtschaftlichen und politischen Aspekten: Dieses Kapitel bietet einen historischen Kontext, indem es die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen der 1970er und 1990er Jahre in Deutschland vergleicht. Es legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Analysen, indem es die unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Landschaften der beiden Jahrzehnte beleuchtet.
2. Die Einkommensverteilung und deren Entwicklung in den neunziger Jahren im Vergleich zu den siebziger Jahren: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die Einkommensverteilung anhand verschiedener Datenquellen (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Sozio-ökonomisches Panel, Lohn- und Einkommensteuerstatistik, Mikrozensus), vergleicht die funktionelle und die Größenverteilung der Einkommen, untersucht die relative Einkommensposition sozialer Gruppen und regionale Unterschiede. Es wird auf den Gini-Koeffizienten als Maß für die Einkommensungleichheit eingegangen.
3. Die Vermögensverteilung im Vergleich: Dieses Kapitel widmet sich der Vermögensverteilung, beleuchtet die Datenbasis und den Vermögensbegriff. Es untersucht die Konzentration von Vermögen anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, differenziert zwischen Immobilien-, Geld- und Produktivvermögen und analysiert auch regionale Unterschiede. Das Humanvermögen wird ebenfalls betrachtet.
4. Volkswirtschaftliche Probleme, die durch die gegebene Situation der Einkommens- und Vermögensverteilung entstehen: In diesem Kapitel werden die volkswirtschaftlichen Folgen der beschriebenen Einkommens- und Vermögensverteilung beleuchtet. Es befasst sich mit Wohlfahrtsverlusten, absoluter und relativer Armut und der Rolle der Sozialhilfe.
5. Die Verteilungswirkungen staatlicher Finanzpolitik: Das Kapitel analysiert die staatlichen Instrumente der Umverteilung und deren quantitative Bedeutung, untersucht die Verteilungswirkungen verschiedener staatlicher Eingriffe (z.B. Verbrauchssteuern, ökologische Steuerreform, direkte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) und modelliert deren kurzfristige Inzidenz.
Schlüsselwörter
Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, Deutschland, 1970er Jahre, 1990er Jahre, Gini-Koeffizient, Einkommensungleichheit, Vermögenskonzentration, Sozialpolitik, staatliche Finanzpolitik, Umverteilung, Datenanalyse, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Sozio-ökonomisches Panel.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland in den 1970er und 1990er Jahren. Sie analysiert Veränderungen in der Verteilung über die Zeit und den Einfluss staatlicher Maßnahmen darauf.
Welche Datenquellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Datenquellen, darunter die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, das Sozio-ökonomische Panel, die Lohn- und Einkommensteuerstatistik und den Mikrozensus. Die methodische Vergleichbarkeit dieser Quellen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Aspekte der Einkommensverteilung werden untersucht?
Die Analyse der Einkommensverteilung umfasst die funktionelle und die Größenverteilung der Einkommen, die relative Einkommensposition sozialer Gruppen, regionale Unterschiede und den Einsatz des Gini-Koeffizienten als Maß für die Einkommensungleichheit.
Wie wird die Vermögensverteilung untersucht?
Die Vermögensverteilung wird anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe analysiert. Untersucht werden die Konzentration von Vermögen, die Verteilung verschiedener Vermögensformen (Immobilien, Geld, Produktivvermögen) und regionale Unterschiede. Das Humanvermögen wird ebenfalls betrachtet.
Welche volkswirtschaftlichen Probleme im Zusammenhang mit Einkommens- und Vermögensungleichheit werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die volkswirtschaftlichen Folgen von Einkommens- und Vermögensungleichheit, einschließlich Wohlfahrtsverluste, absolute und relative Armut und die Rolle der Sozialhilfe.
Wie wird der Einfluss der staatlichen Finanzpolitik analysiert?
Die Arbeit analysiert die staatlichen Instrumente der Umverteilung, ihre quantitative Bedeutung und die Verteilungswirkungen verschiedener staatlicher Eingriffe. Untersucht werden unter anderem Verbrauchssteuern (inkl. ökologischer Steuerreform), direkte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Die kurzfristige Inzidenz ausgewählter Maßnahmen wird modelliert.
Welche Zeiträume werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Einkommens- und Vermögensverteilung der 1970er und 1990er Jahre in Deutschland, um Veränderungen und Entwicklungen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, Deutschland, 1970er Jahre, 1990er Jahre, Gini-Koeffizient, Einkommensungleichheit, Vermögenskonzentration, Sozialpolitik, staatliche Finanzpolitik, Umverteilung, Datenanalyse, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Sozio-ökonomisches Panel.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, von der Einleitung bis zum Fazit, welche die jeweiligen Schwerpunkte und Ergebnisse zusammenfasst.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, Veränderungen der Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland über die Zeit aufzuzeigen und den Einfluss des Staates auf diese Entwicklung zu analysieren.
- Quote paper
- Raik-Arnd Sünderhauf (Author), 2002, Zur Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland in den neunziger Jahren im Vergleich zu den siebziger Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9004