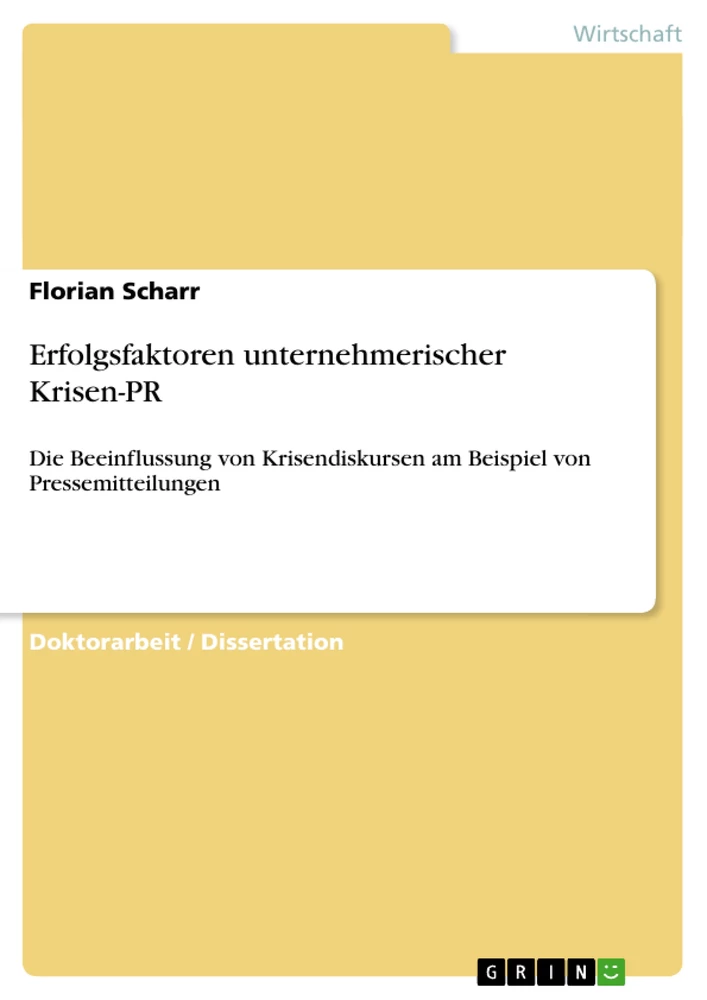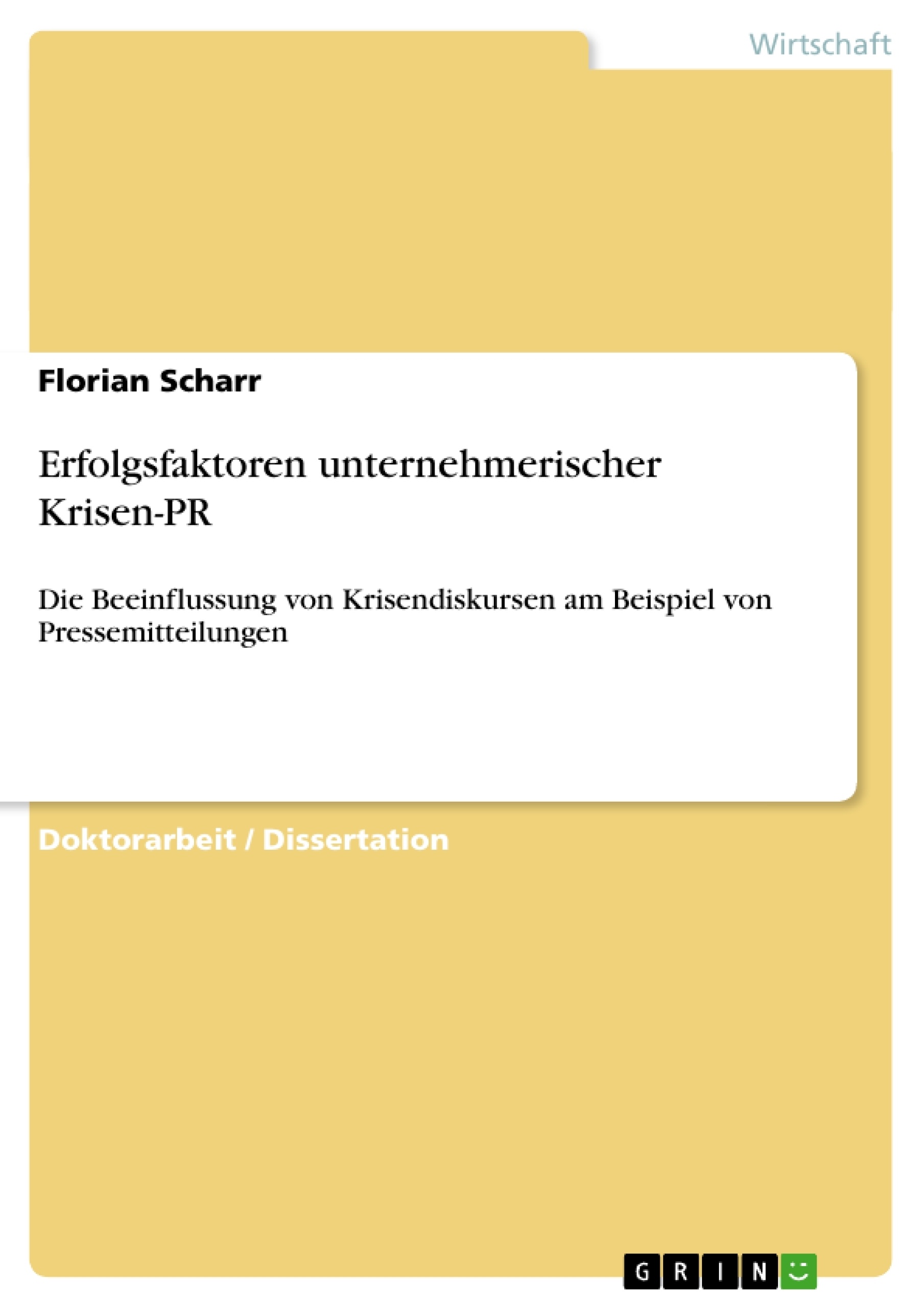Ob „Peanuts“, „Elchtest“ oder „Hoechst-Störfall“ - bei diesen bekannten Öffentlichkeitskrisen der letzten Jahre rief die mangelhafte Krisen-PR der betroffenen Unternehmen bei Medien und Bevölkerung mehr Empörung hervor als die originären Auslöser und potenzierte so den entstandenen Vertrauensverlust.
Auch die sich gerade erst entwickelnde PR-Forschung bietet noch keine konkrete Hilfestellung zur Gestaltung von Krisen-PR. Mit dem bedeutenden Diskurs- und dadurch Realitätsgestaltungsmittel Pressemitteilung beschäftigt sich gar nicht eine einzige wissenschaftliche Untersuchung!
Dies muss als unbefriedigend bezeichnet werden, lässt sich doch in Weiterentwicklung der Foucaultschen Ideen formulieren: Effiziente PR produziert Wirklichkeit. Gerade die Berichterstattung der Massenmedien, deren Darstellung und Kommentierung die öffentliche Meinung bedingt, basiert häufig auf inszenierten Meldungen und Ereignissen. Experten sehen das Eindringen in den Journalismus und die Manipulation der von der Öffentlichkeit als neutral angesehenen Vermittlungsfunktion der Medien als primäres Ziel vieler PR-Aktivitäten an.
Die vorliegende Arbeit will Denkanstöße für linguistische Forschungen auf diesem Gebiet schaffen, denn gerade die Beschäftigung dieser Disziplin mit Public Relations könnte sich als äußerst fruchtbar erweisen. Zudem entspricht es dem Daseinszweck von Wissenschaft, die Gesellschaft über Manipulationstechniken von PR-Profis aufzuklären.
Die Analyse typischer Krisenverläufe lässt mutmaßen, dass effektive Kommunikation, zu deren Ausgestaltung erste Vorgaben erarbeitet werden sollen, Vertrauenskrisen sogar vollständig abwenden kann. Bricht eine Krise dennoch aus, so zeigt diese Arbeit, wie proaktives Handeln, eine schnelle und offene Kommunikation und die geschickte Erstplatzierung strategischer Begriffe sie eindämmen können, und erarbeitet Thesen, welche Botschaften dazu beitragen können, die Öffentlichkeit zu versöhnen. Wichtig ist, Krisen prinzipiell als Chancen zur Verbesserung zu begreifen, da sie klare Hinweise auf Defizite und Schwachpunkte geben und schon oft der Anlass waren, Organisationen neu und zukunftsbezogen auszurichten. Was die Krisen-PR als wichtigen Teil der Krisenbewältigung damit so bedeutsam und gar so spannend macht, ist die strategische Chance, das Schlimme zum Guten zu wenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzungen der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1 Public Relations / PR
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Geschichtliche Entwicklung der Unternehmens-PR
- 2.1.3 Kernaufgaben und Tätigkeitsfelder
- 2.1.4 Beispiel einer PR-Kampagne - Hill and Knowlton´s „Free Kuwait“ 1990
- 2.1.5 Zentraler Analysegegenstand: Pressemitteilungen
- 2.2 Das Umfeld der PR - Medien und öffentliche Meinung
- 2.2.1 Basiskenntnisse der Medienprozesse
- 2.2.2 Nachrichtenfaktoren
- 2.2.3 „Die“ veröffentlichte Meinung
- 2.2.4 Eigenschaften der öffentlichen Meinung
- 2.2.5 Entstehung einer öffentlichen Meinung
- 2.2.6 Forschungsansätze zur Wirkung der Medien auf die öffentliche Meinung
- 2.3 Unternehmenskrisen
- 2.3.1 Sprach- und medienwissenschaftliche Betrachtung
- 2.3.2 Ursachen
- 2.3.3 Verlaufsmodelle
- 3. Empirische Analyse anhand von Fallbeispielen
- 3.1 Zwei exemplarische Falldarstellungen
- 3.1.1 Fallstudie I: Die „Tylenol-Morde“ 1982
- 3.1.1.1 Morde und Massenpanik
- 3.1.1.2 Erste Phase der Krisen-PR: Eindämmung
- 3.1.1.3 Zweite Phase der Krisen-PR: Rückkehrkampagne
- 3.1.2 Fallstudie II: Die „Cola-Kolik“ 1999
- 3.1.2.1 Die Krise beginnt - Cola schweigt oder verharmlost
- 3.1.2.2 Widersprüche und Unwahrheiten in mangelhafter Kommunikation
- 3.1.2.3 Marketingkampagnen und Systemänderungen - aber keine eigentliche Krisen-PR
- 3.1.2.4 Folgen der mangelhaften Krisen-PR
- 3.1.3 Erkenntnisse aus den beiden Krisenfällen
- 3.2 Analysegegenstand und Methoden
- 3.2.1 Textlinguistik
- 3.2.2 Kritische Diskursanalyse
- 3.2.3 Analysemethoden
- 3.2.3.1 Kontext / Krisenentwicklung
- 3.2.3.2 Textoberflächenanalyse und Zusammenfassung
- 3.2.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel
- 3.2.3.4 Bewertung der Pressemitteilung
- 3.2.3.5 Zusammenfassung: Leitfragen der Analyse
- 3.3 Analyse von Pressemitteilungen in Unternehmenskrisen
- 3.3.1 Der Störfall der Hoechst AG 1993
- 3.3.1.1 Kontext / Krisenentwicklung
- 3.3.1.2 Die Pressemitteilung der Hoechst AG vom 27. Februar 1993
- 3.3.1.3 Textoberflächenanalyse und Zusammenfassung
- 3.3.1.4 Sprachlich-rhetorische Mittel
- 3.3.1.5 Bewertung der Pressemitteilung
- 3.3.1.6 Weiterer Verlauf der Krise
- 3.3.2 Der „Peanuts“-Skandal der Deutsche Bank AG 1994
- 3.3.2.1 Kontext / Krisenentwicklung
- 3.3.2.2 Die Pressemitteilung der Deutsche Bank AG vom 18. April 1994
- 3.3.2.3 Textoberflächenanalyse und Zusammenfassung
- 3.3.2.4 Sprachlich-rhetorische Mittel
- 3.3.2.5 Bewertung der Pressemitteilung
- 3.3.2.6 Weiterer Verlauf der Krise
- 3.3.3 Der „Elchtest“ der Mercedes A-Klasse 1997/1998
- 3.3.3.1 Kontext / Krisenentwicklung
- 3.3.3.2 Die Pressemitteilung der Daimler-Benz AG vom 9. Dezember 1997
- 3.3.3.3 Textoberflächenanalyse und Zusammenfassung
- 3.3.3.4 Sprachlich-rhetorische Mittel
- 3.3.3.5 Bewertung der Pressemitteilung
- 3.3.3.6 Weiterer Verlauf der Krise
- 4. Ergebnisdarstellung
- 4.1 Zusammenfassung der Analyseergebnisse - Forderungen an die Krisen-PR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Erfolgsfaktoren unternehmerischer Krisen-PR anhand der Analyse von Pressemitteilungen. Ziel ist es, die Beeinflussung von Krisendiskursen durch gezielte PR-Strategien zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für eine effektive Krisenkommunikation abzuleiten.
- Analyse von Krisen-PR-Strategien in unterschiedlichen Unternehmen
- Wirkung von Pressemitteilungen auf die öffentliche Meinung
- Sprachliche und rhetorische Mittel in der Krisenkommunikation
- Identifizierung von Erfolgsfaktoren und -hindernissen in der Krisen-PR
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für effektive Krisenkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit einer Definition von Public Relations, erörtert deren geschichtliche Entwicklung und beschreibt die Kernaufgaben und Tätigkeitsfelder. Ein Beispiel einer erfolgreichen PR-Kampagne (Hill & Knowlton's "Free Kuwait") wird analysiert. Abschließend wird der Fokus auf Pressemitteilungen als zentralen Analysegegenstand gerichtet. Weiterhin werden das Medienumfeld, die öffentliche Meinung und ihre Entstehung sowie verschiedene Forschungsansätze dazu erläutert. Der Abschnitt zu Unternehmenskrisen beleuchtet sprach- und medienwissenschaftliche Betrachtungsweisen, Ursachen und Verlaufsmodelle von Unternehmenskrisen.
3. Empirische Analyse anhand von Fallbeispielen: Das Kapitel präsentiert eine empirische Analyse von Unternehmenskrisen anhand von Fallstudien. Zuerst werden die Fälle „Tylenol-Morde“ und „Cola-Kolik“ exemplarisch dargestellt, um die unterschiedlichen Strategien und deren Auswirkungen zu verdeutlichen. Im Folgenden werden die verwendeten Analysemethoden (Textlinguistik, kritische Diskursanalyse) detailliert beschrieben. Der Hauptteil dieses Kapitels analysiert drei Fallbeispiele (Hoechst AG, Deutsche Bank AG, Daimler-Benz AG) und deren Pressemitteilungen nach den vorgestellten Methoden: Kontextanalyse, Textoberflächenanalyse, Analyse sprachlich-rhetorischer Mittel und Bewertung der jeweiligen Pressemitteilung, gefolgt von einer Darstellung des weiteren Krisenverlaufs.
Schlüsselwörter
Krisen-PR, Pressemitteilung, öffentliche Meinung, Medien, Unternehmenskrise, Diskursanalyse, Textlinguistik, Kommunikationsstrategie, Erfolgsfaktoren, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Pressemitteilungen in Unternehmenskrisen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Erfolgsfaktoren unternehmerischer Krisen-PR anhand der Analyse von Pressemitteilungen. Ziel ist es, die Beeinflussung von Krisendiskursen durch gezielte PR-Strategien zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für eine effektive Krisenkommunikation abzuleiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse von Krisen-PR-Strategien in verschiedenen Unternehmen, die Wirkung von Pressemitteilungen auf die öffentliche Meinung, sprachliche und rhetorische Mittel in der Krisenkommunikation, Identifizierung von Erfolgsfaktoren und -hindernissen in der Krisen-PR sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für effektive Krisenkommunikation.
Welche theoretischen Grundlagen werden gelegt?
Das Kapitel „Grundlagen“ definiert Public Relations (PR), erläutert deren geschichtliche Entwicklung und Kernaufgaben. Es analysiert beispielhaft die PR-Kampagne „Free Kuwait“ von Hill & Knowlton. Der Fokus liegt auf Pressemitteilungen als Analysegegenstand. Zusätzlich werden das Medienumfeld, die öffentliche Meinung, deren Entstehung und Forschungsansätze dazu behandelt. Unternehmenskrisen werden sprach- und medienwissenschaftlich betrachtet, ihre Ursachen und Verlaufsmodelle beleuchtet.
Welche Methoden werden in der empirischen Analyse verwendet?
Die empirische Analyse verwendet Fallstudien (u.a. „Tylenol-Morde“, „Cola-Kolik“, Hoechst AG, Deutsche Bank AG, Daimler-Benz AG). Die Analysemethoden umfassen Textlinguistik, kritische Diskursanalyse, Kontextanalyse, Textoberflächenanalyse, Analyse sprachlich-rhetorischer Mittel und die Bewertung der jeweiligen Pressemitteilung. Der weitere Krisenverlauf wird ebenfalls betrachtet.
Welche Fallstudien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Fälle „Tylenol-Morde“ und „Cola-Kolik“, um unterschiedliche Strategien und deren Auswirkungen zu zeigen. Im Kern werden drei Fallbeispiele detailliert untersucht: die Krisen der Hoechst AG (1993), der Deutschen Bank AG („Peanuts“-Skandal, 1994) und der Daimler-Benz AG („Elchtest“, 1997/1998). Jeweils werden die Pressemitteilungen nach den beschriebenen Methoden analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit fasst die Analyseergebnisse zusammen und leitet daraus Forderungen an die Krisen-PR ab. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für eine effektive Krisenkommunikation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Krisen-PR, Pressemitteilung, öffentliche Meinung, Medien, Unternehmenskrise, Diskursanalyse, Textlinguistik, Kommunikationsstrategie, Erfolgsfaktoren, Fallstudie.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung (mit Zielsetzung und Aufbau), Grundlagen (PR, Medien, öffentliche Meinung, Unternehmenskrisen), empirische Analyse (Fallstudien, Methoden), Ergebnisdarstellung (Zusammenfassung, Forderungen an die Krisen-PR) und Schlussfolgerung.
- Quote paper
- Florian Scharr (Author), 2006, Erfolgsfaktoren unternehmerischer Krisen-PR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89999