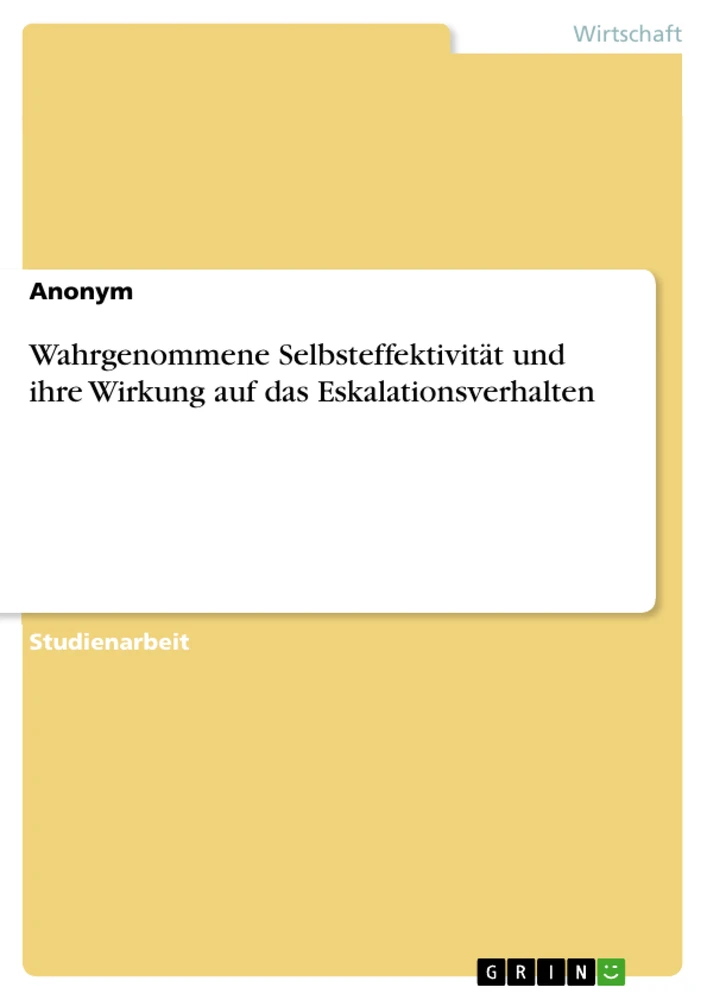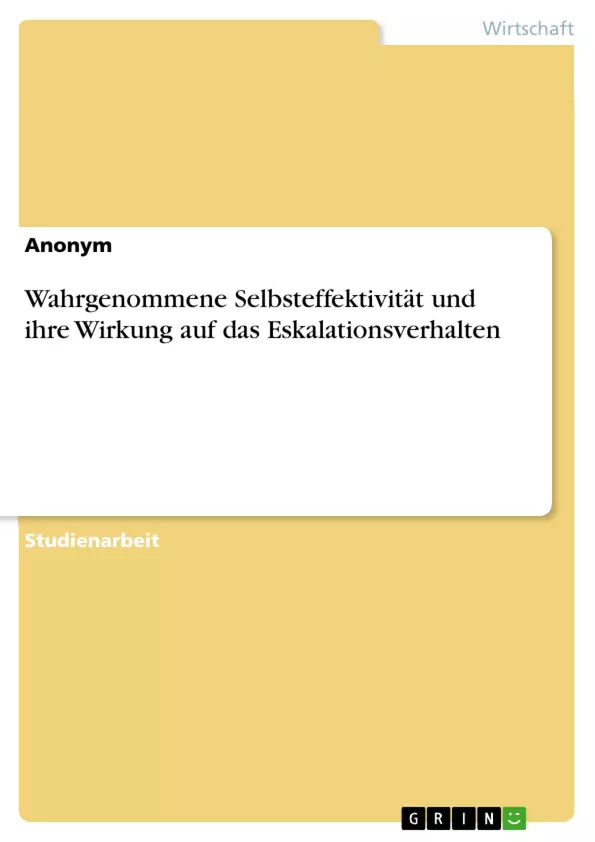Escalation of Commitment, das heißt, trotz negativer Rückmeldungen besitzen Entscheidungsträger (ET) die Tendenz ein Projekt weiterzuführen, stellt ein Phänomen dar, welches die betriebswirtschaftliche Entscheidungsforschung schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Hierbei entwickelte sich eine Vielzahl unterschiedlicher psychologischer Erklärungsansätze, die auf folgenden psychologischen Grundbegriffen beruhen: Kognition, Motivation, Volition, Emotion, Persönlichkeitseigenschaften und soziale Aspekte.
Der Self Justification Effekt von Staw (1976), bei dem die persönliche Verantwortung eines ET für die Initiierung eines Projektes eine zentrale Rolle einnimmt, ist der prominenteste psychologische Erklärungsansatz. Im Falle von negativen Rückmeldungen investiert der ET zum Schutz seines Selbstwertgefühls zusätzliche Ressourcen, um wiederum seine ursprüngliche Entscheidung zu rechtfertigen und deren Richtigkeit zu bestätigen.
Es erfolgt somit eine Weiterführung des Projektes. Im Gegensatz zu diesem Erklärungsansatz basiert der Beitrag von Whyte & Saks (2007) nicht auf der kognitiven, sondern auf der motivationalen Komponente. Konkret wird hier die Forschungsfrage untersucht, auf welche Art und Weise die wahrgenommene Selbsteffektivität (WS) das Eskalationsverhalten beeinflusst. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun auch, diese Fragestellung zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Wahrgenommene Selbsteffektivität und ihr möglicher Einfluss auf das Eskalationsverhalten
- Darstellung des ersten Experiments
- Methodische Vorgehensweise
- Ergebnisse
- Darstellung des zweiten Experiments
- Methodische Vorgehensweise
- Ergebnisse
- Einordnung und kritische Würdigung der Ergebnisse vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der wahrgenommenen Selbsteffektivität auf das Eskalationsverhalten von Entscheidungsträgern. Ziel ist es, die Forschungsfrage zu klären, in welcher Art und Weise die wahrgenommene Selbsteffektivität das Eskalationsverhalten beeinflusst.
- Wahrgenommene Selbsteffektivität als Einflussfaktor auf das Eskalationsverhalten
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen wahrgenommener Selbsteffektivität und der Bereitschaft, in ein Projekt weiter zu investieren, trotz negativer Rückmeldungen
- Empirische Analyse des Eskalationsverhaltens anhand zweier Experimente
- Einordnung der Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur
- Diskussion der Implikationen für die Entscheidungsforschung und Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit dar. Zudem wird der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Wahrgenommene Selbsteffektivität und ihr möglicher Einfluss auf das Eskalationsverhalten: In diesem Kapitel werden die möglichen Arten der Einflussnahme der wahrgenommenen Selbsteffektivität auf das Eskalationsverhalten erläutert.
- Darstellung des ersten Experiments: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse des ersten Experiments, das von Whyte & Saks (2007) durchgeführt wurde, um den Einfluss der wahrgenommenen Selbsteffektivität auf das Eskalationsverhalten zu untersuchen.
- Darstellung des zweiten Experiments: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse des zweiten Experiments, das von Whyte & Saks (2007) durchgeführt wurde, um den Einfluss der wahrgenommenen Selbsteffektivität auf das Eskalationsverhalten zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Eskalationsverhalten, wahrgenommene Selbsteffektivität, Entscheidungsforschung, experimentelle Methoden, psychologische Erklärungsansätze und betriebswirtschaftliche Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Phänomen "Escalation of Commitment"?
Escalation of Commitment beschreibt die Tendenz von Entscheidungsträgern, ein Projekt trotz negativer Rückmeldungen weiterzuführen und zusätzliche Ressourcen zu investieren, anstatt es abzubrechen.
Wie beeinflusst die wahrgenommene Selbsteffektivität das Eskalationsverhalten?
Die wahrgenommene Selbsteffektivität wirkt als motivationaler Faktor. Die Forschung untersucht, inwiefern die Überzeugung von der eigenen Fähigkeit, Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, die Bereitschaft erhöht, an verlustreichen Projekten festzuhalten.
Was ist der Self Justification Effekt nach Staw?
Nach Staw investieren Entscheidungsträger zum Schutz ihres Selbstwertgefühls zusätzliche Ressourcen, um ihre ursprüngliche Entscheidung zu rechtfertigen und deren Richtigkeit nachträglich zu bestätigen.
Welche psychologischen Erklärungsansätze gibt es für Eskalationsverhalten?
Die Ansätze basieren auf Kognition, Motivation, Volition, Emotion, Persönlichkeitseigenschaften sowie sozialen Aspekten.
Was war der Fokus der Experimente von Whyte & Saks?
Whyte & Saks untersuchten im Gegensatz zu kognitiven Ansätzen die motivationale Komponente, insbesondere wie die wahrgenommene Selbsteffektivität die Investitionsbereitschaft bei negativen Rückmeldungen steuert.
Warum ist dieses Thema für die betriebswirtschaftliche Entscheidungsforschung relevant?
Es hilft zu verstehen, warum Unternehmen oft Ressourcen in gescheiterte Projekte leiten und wie psychologische Faktoren rationale wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Wahrgenommene Selbsteffektivität und ihre Wirkung auf das Eskalationsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899685