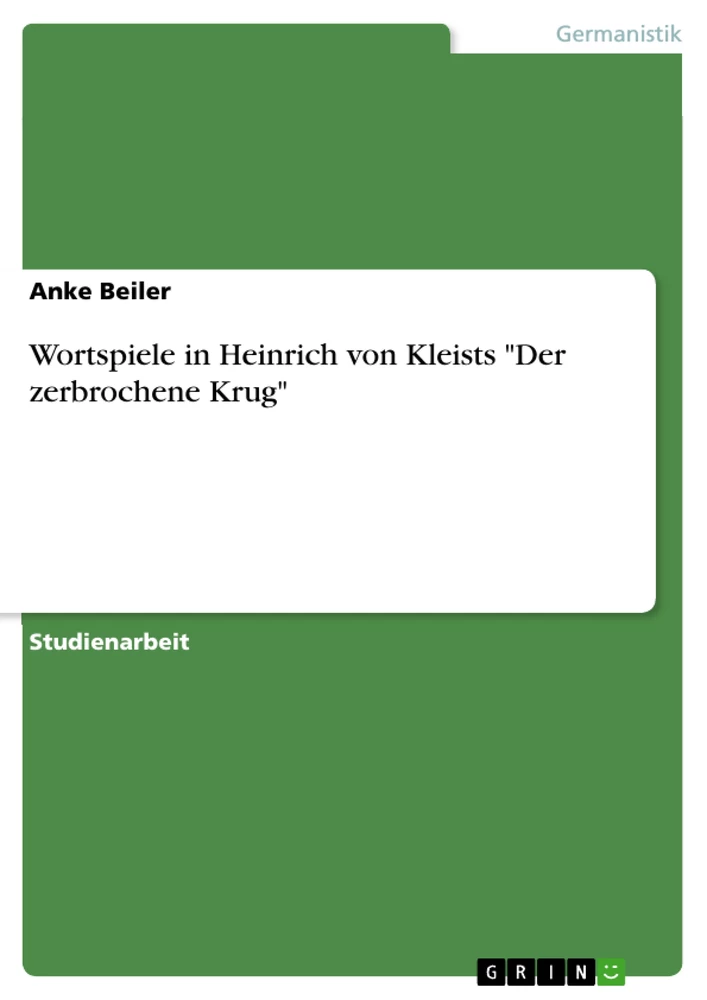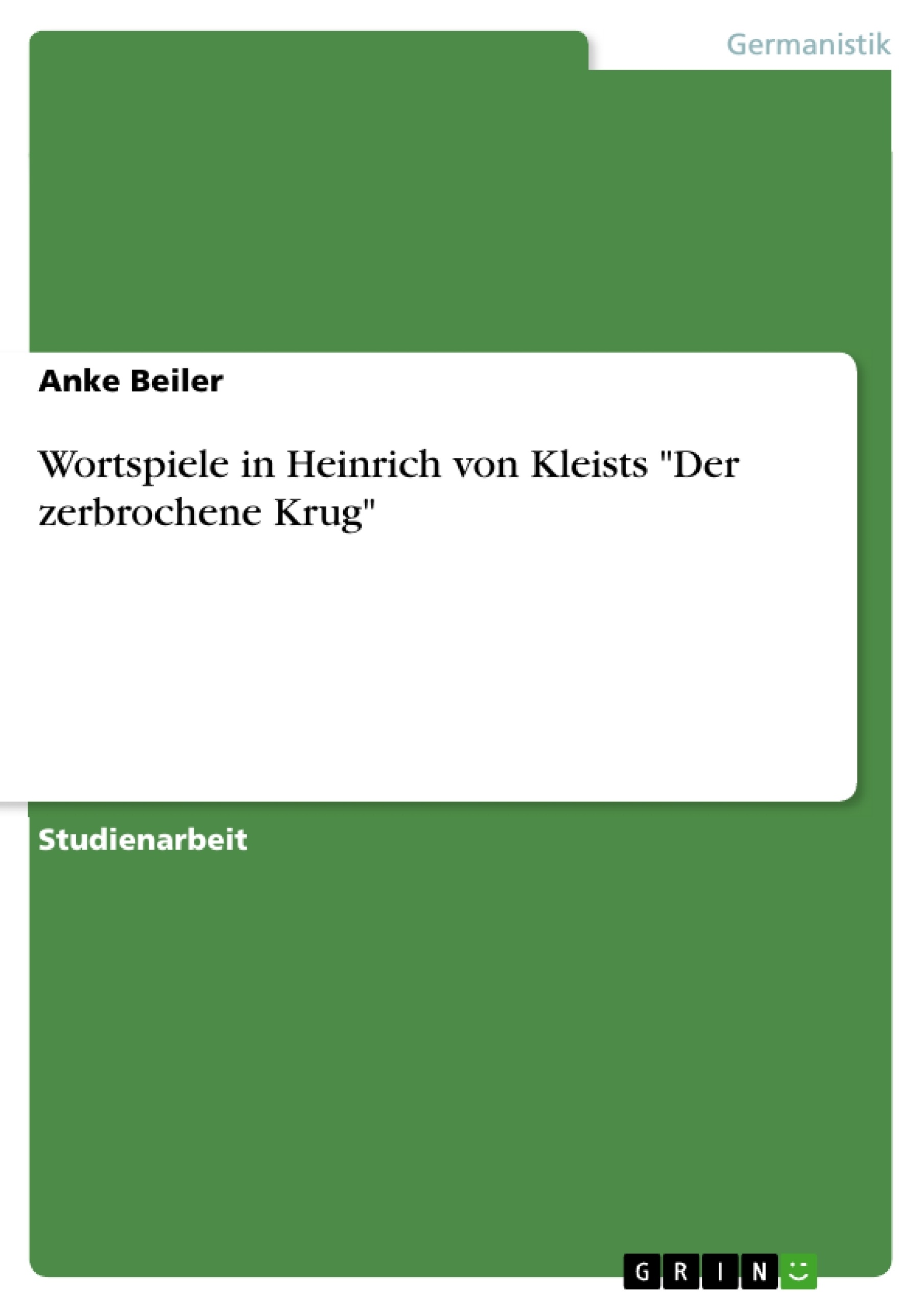Wortspiele sind – wie der Name schon sagt – Spiele mit Worten, deren Bedeutungen und ihrem Klang. Sie dienen immer zur Aufdeckung der Doppelbödigkeit und sind daher in der Regel nicht in andere Sprachen übersetzbar.
Auch Heinrich von Kleist hat in seinem Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ mit den Worten gespielt. „Kleists Lustspiel bringt einen Prozeß auf die Bühne, der nicht nur ‚mit’ Wörtern, sondern zugleich ‚um’ Wörter […] geführt wird.“. Doch was sind das für Wortspiele, und was bedeuten sie im Einzelnen? Diese Fragen zu klären ist das Ziel meiner Arbeit.
Dabei werde ich zuerst auf die Namen der Protagonisten eingehen und deren Bedeutung darlegen. Im Anschluss untersuche ich die rhetorischen Figuren, im Besonderen die Doppeldeutigkeiten, Wortumbildungen, Wortwiederholungen und Vergleiche. Zum Schluss erläutere ich noch den Einfluss der Sprichwörter.
Nicht behandeln werde ich die Symbole, die Bedeutung der Körpersprache und Kleists Einstellung zur Sprache im Allgemeinen.
Den Variant werde ich – wo es nötig ist – mit einbeziehen, da er zum vollen Verständnis des Stückes beiträgt. Heinrich von Kleist hat seinen Protagonisten im „Zerbrochenen Krug“ keine willkürlichen Namen gegeben, sondern die Namensgebung hat eine charakterisierende Funktion. Diese Funktion „dient der näheren Kennzeichnung von Aussehen und Wesen des Namensträgers“. Wenn man die Namen Adam und Eve liest, denkt man sofort an Adam, den „biblischen Stammvater der Menschheit“ und an Eva. So erinnert auch Adams Fall aus dem Bett an den biblischen Sündenfall mit der Vertreibung aus dem Paradies, und der Schreiber Licht macht aus dem „Sündenfall“ ein „Adamsfall“. Noch dazu vergleicht er Adam mit dem Ältervater.
Aber warum spielt Kleist mit diesen Namen auf den Sündenfall an? Verführt der Dorfrichter Adam Eve, oder Eve den Adam? Und wer ist die Schlange, und wer die verbotene Frucht?
Dirk Grathoff ist der Meinung, dass der „nächtliche Vorfall“ für Eve ein Fall „in den Stand der Erkenntnis“ war. Dem kann ich jedoch nicht zustimmen. Aus dem Text geht eindeutig hervor, dass Eve – deren Name zugleich ein Palindrom ist – nach dieser Nacht noch nicht die Erkenntnis erlangt hat, dass sie von Adam belogen wurde. Sonst würde sie diesen während der Verhandlung nicht decken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprechende Namen
- 2.1 Adam und Eve
- 2.2 Licht
- 2.3 Walter
- 2.4 Ruprecht Tümpel
- 2.5 Weitere Namen
- 3. Rhetorische Figuren
- 3.1 Doppelbedeutungen
- 3.1.1 Wechsel zwischen eigentlicher und metaphorischer Bedeutung
- 3.1.2 Der „Schein“
- 3.1.3 Der „Turm zu Babylon und Pfingsten“
- 3.2 Wortumbildungen
- 3.3 Wortwiederholungen
- 3.4 Vergleiche
- 4. Sprichwörter
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wortspiele in Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ und deren Bedeutung für das Verständnis des Stückes. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung und die Funktion der verwendeten rhetorischen Mittel.
- Analyse der sprechenden Namen der Protagonisten und ihrer symbolischen Bedeutung.
- Untersuchung verschiedener rhetorischer Figuren wie Doppeldeutigkeiten, Wortumbildungen und Wortwiederholungen.
- Erörterung des Einflusses von Sprichwörtern auf die Handlung und die Charaktere.
- Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und der Darstellung von Moral und Gerechtigkeit.
- Bedeutung des Variantentextes für das Verständnis der Wortspiele.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert das Thema der Arbeit: die Analyse der Wortspiele in Kleists „Der zerbrochene Krug“. Sie definiert den Begriff des Wortspiels und betont dessen Unübersetzbarkeit. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung sprechender Namen, rhetorischer Figuren und Sprichwörter umfasst. Symbole, Körpersprache und Kleists allgemeine Einstellung zur Sprache werden explizit ausgeschlossen. Der Variant wird als wichtiges Element für das Verständnis des Stückes angekündigt.
2. Sprechende Namen: Dieses Kapitel analysiert die Namen der Hauptfiguren als nicht zufällig gewählte, sondern charakterisierende Elemente. Es untersucht im Detail die Namen Adam und Eve im Kontext des biblischen Sündenfalls, wobei die Frage nach Verführer und Verführtem im Mittelpunkt steht. Die Analyse beleuchtet die moralische Dimension des "Falls" Adams, der durch die Ausnutzung seiner Machtposition gekennzeichnet ist. Der Name "Licht" wird im Hinblick auf seine mehrschichtigen Bedeutungen (Erleuchtung, Zwielicht etc.) interpretiert und in Beziehung zu den anderen Figuren gesetzt. Das Kapitel argumentiert, dass die Namensgebung maßgeblich zur Charakterisierung und zum Verständnis der Handlung beiträgt.
Schlüsselwörter
Wortspiele, Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug, Sprechende Namen, Rhetorische Figuren, Doppeldeutigkeit, Wortumbildung, Wortwiederholung, Sprichwörter, Symbol, Moral, Gerechtigkeit, Variant.
Häufig gestellte Fragen zu „Der zerbrochene Krug“: Eine Analyse der Wortspiele
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Wortspiele in Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ und deren Bedeutung für das Verständnis des Stücks. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Gestaltung und der Funktion der verwendeten rhetorischen Mittel.
Welche Aspekte der Wortspiele werden untersucht?
Die Analyse umfasst sprechende Namen der Protagonisten und deren symbolische Bedeutung, verschiedene rhetorische Figuren wie Doppeldeutigkeiten, Wortumbildungen und Wortwiederholungen, sowie den Einfluss von Sprichwörtern auf Handlung und Charaktere. Der Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und der Darstellung von Moral und Gerechtigkeit wird ebenfalls beleuchtet. Die Bedeutung des Variantentextes für das Verständnis der Wortspiele wird berücksichtigt.
Welche konkreten Beispiele für sprechende Namen werden analysiert?
Die Arbeit untersucht detailliert die Namen Adam und Eva im Kontext des biblischen Sündenfalls, den Namen „Licht“ mit seinen vielschichtigen Bedeutungen und den Namen Ruprecht Tümpel. Die Analyse beleuchtet, wie die Namensgebung zur Charakterisierung der Figuren und zum Verständnis der Handlung beiträgt.
Welche rhetorischen Figuren werden behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf Doppeldeutigkeiten (mit Unterpunkten zu Bedeutungswandel, „Schein“ und „Turm zu Babylon und Pfingsten“), Wortumbildungen, Wortwiederholungen und Vergleiche.
Welche Rolle spielen Sprichwörter im Stück?
Die Arbeit untersucht, wie Sprichwörter die Handlung und die Charaktere beeinflussen.
Wie wird der Variantentext berücksichtigt?
Der Variantentext wird als wichtiges Element für das Verständnis der Wortspiele im Stück angesehen und in der Analyse berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu sprechenden Namen, ein Kapitel zu rhetorischen Figuren, ein Kapitel zu Sprichwörtern und ein Fazit. Das Kapitel zu sprechenden Namen beinhaltet detaillierte Analysen der Namen Adam und Eva, Licht und Ruprecht Tümpel, sowie weitere Namen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit untersucht sprechende Namen, rhetorische Figuren und Sprichwörter. Symbole und Körpersprache werden explizit ausgeschlossen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wortspiele, Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug, Sprechende Namen, Rhetorische Figuren, Doppeldeutigkeit, Wortumbildung, Wortwiederholung, Sprichwörter, Symbol, Moral, Gerechtigkeit, Variant.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wortspiele in Kleists „Der zerbrochene Krug“ zu analysieren und deren Bedeutung für das Verständnis des Stücks aufzuzeigen. Sie untersucht die sprachliche Gestaltung und die Funktion der verwendeten rhetorischen Mittel.
- Quote paper
- Anke Beiler (Author), 2005, Wortspiele in Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89949