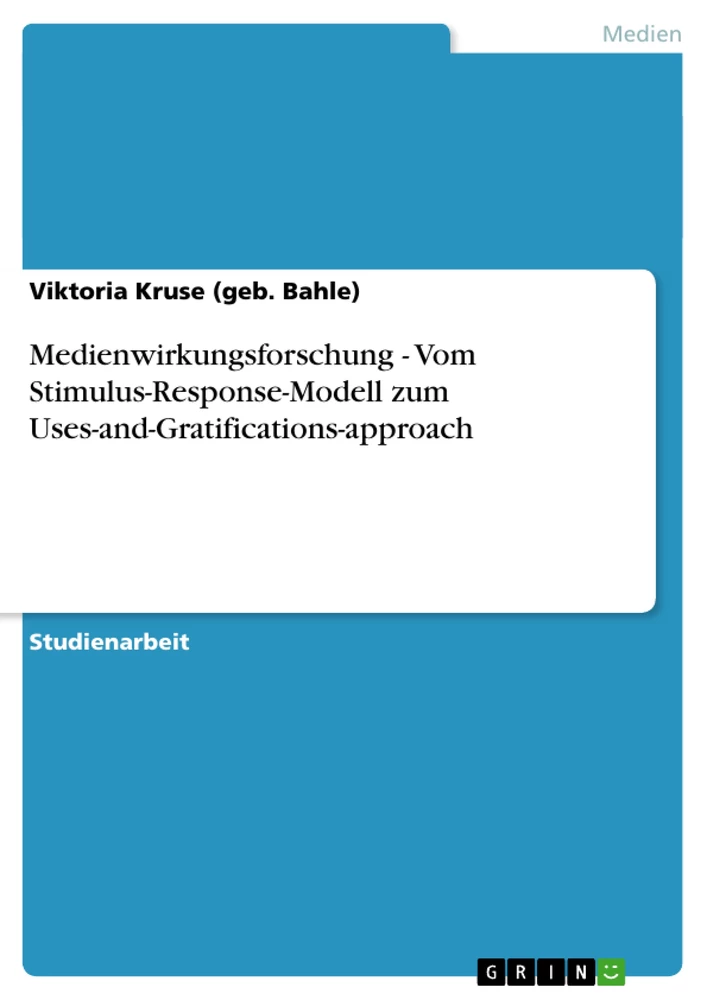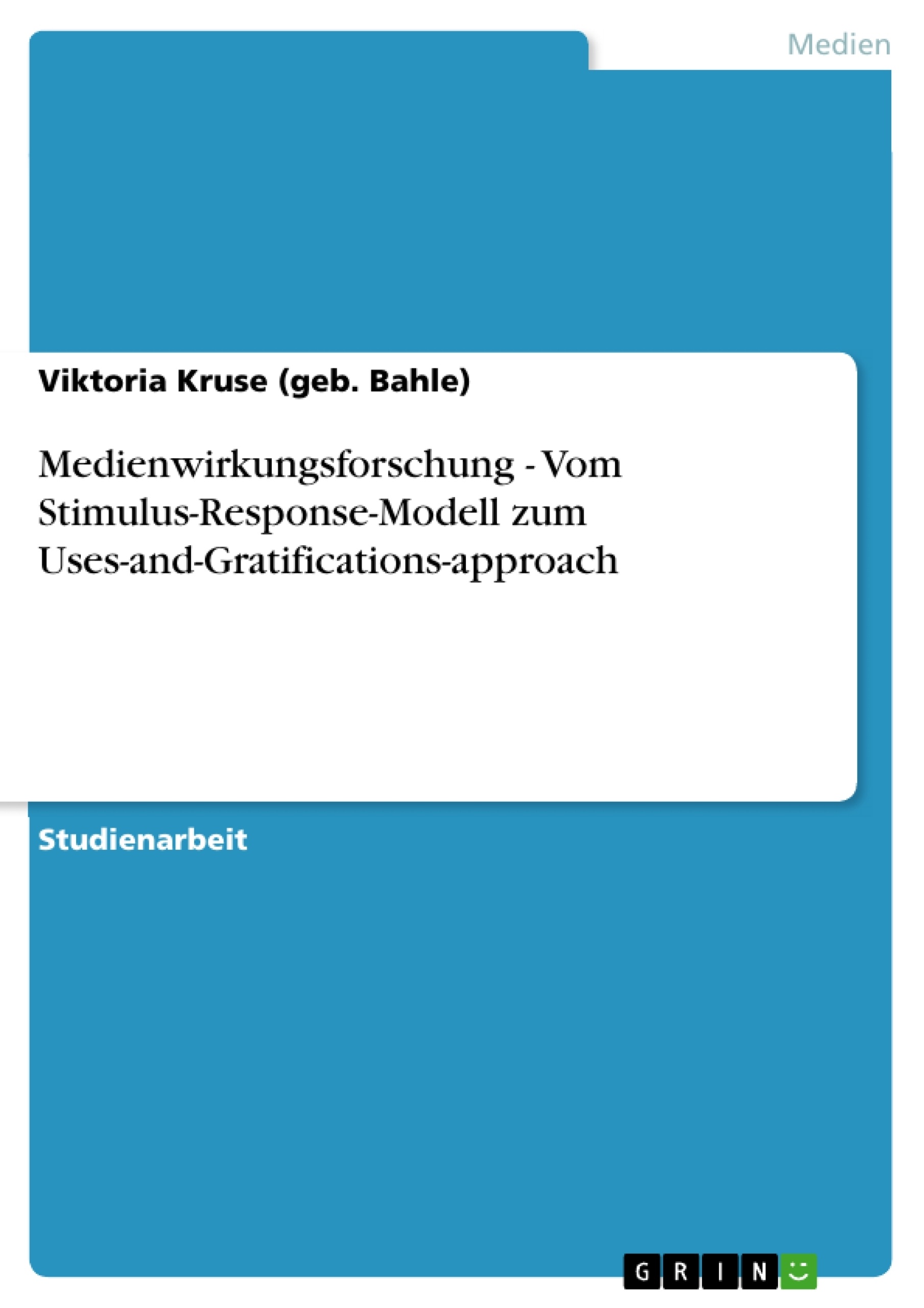„Was macht der Mensch mit den Medien?“ Diese Frage der Wirkungsforschung der Kommunikationswissenschaft verdrängte die zuvor geltende zentrale Frage „was machen die Medien mit den Menschen?“ im Zuge des Comeback der Handlungstheorie in den 70er Jahren.
Die behaviouristische Lerntheorie bzw. das Stimulus-Response-Modell, welches als Ursprung der Wirkungsforschung gilt und bis dato den Grundsatz dieser gebildet hatte, wurde als veraltet und überholt angesehen: Es war kommunikatorzentriert, die Rezipienten wurden aus der Betrachtung gänzlich außen vor gelassen, die Wirkung wurde als linear und einseitig gesehen und intervenierende Variablen aus Soziologie und Psychologie blieben unbeachtet. Jetzt wurde eine neue Theorie benötigt. Es gab viele Versuche zu neuen Ansätzen und Theorien, wobei einer von diesen der Uses-and-Gratifications-approach war. Dieser Ansatz entstand durch das Aufblühen der Gratifikationsforschung zusammen mit der Renaissance der Handlungstheorie durch seine Vertreter Blumler und Katz. Der Uses-and- Gratifications-approach stand als nur einer von vielen Ansätzen heftig in der Kritik der Forscher. Sein Schwerpunkt liegt in der Gratifikation der individuellen Bedürfnisse und weitere soziologische und psychologische Variablen bleiben noch immer außen vor. Nichtsdestotrotz war dieser Ansatz einer der ersten großen Schritte in eine neue Forschungsrichtung.
Was ist überhaupt Wirkung? Will man über Ansätze und Entwicklungen der Medienwirkungsforschung sprechen, so ist hier eine begriffliche Klärung nötig. Somit soll in der vorliegenden Arbeit zunächst dieser Frage nachgegangen und der Versuch einer begrifflichen Definition und Abgrenzung vollzogen werden. Im Folgenden werden die Annahmen und Kritiken des Stimulus-Response-Modells dargestellt, damit dann im weiteren der Schritt zum aktiven Publikum und zur Handlungstheorie getan werden kann. Zum Abschluß wird der Uses-and-Gratifications-approach samt seiner Kritik vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienwirkungen
- Der Begriff der Wirkung
- Abgrenzung zu anderen Begriffen
- Das Kausalitätskonzept
- Die Anfänge der Medienwirkungsforschung – das Stimulus-Response-Modell
- Annahmen
- Kritik
- Der Übergang zum aktiven Publikum – das handlungstheoretische Konzept
- Der Uses-and-Gratifications-approach
- Das Eskapismus-Konzept
- Annahmen
- Kritik
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Medienwirkungsforschung von einem kommunikationszentrierten Stimulus-Response-Modell hin zu einem rezipientenorientierten Uses-and-Gratifications-Ansatz nachzuzeichnen. Sie beleuchtet die kritischen Aspekte des älteren Modells und analysiert den Wandel im Verständnis der Medienrezeption.
- Entwicklung des Wirkungsbegriffs in der Kommunikationswissenschaft
- Kritik am Stimulus-Response-Modell
- Der Übergang zum aktiven Publikum und die Handlungstheorie
- Der Uses-and-Gratifications-Ansatz und seine Annahmen
- Grenzen und Kritik des Uses-and-Gratifications-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen Medien und Rezipienten in den Mittelpunkt. Sie beschreibt den Wandel von der Frage „Was machen die Medien mit den Menschen?“ hin zu „Was macht der Mensch mit den Medien?“, der mit dem Aufkommen der Handlungstheorie in den 1970er Jahren einherging. Das veraltete Stimulus-Response-Modell wird als kommunikationszentriert und linear kritisiert, während der Uses-and-Gratifications-Ansatz als ein vielversprechender, wenn auch nicht perfekter, neuer Ansatz vorgestellt wird. Die Arbeit kündigt die begriffliche Klärung des Wirkungsbegriffs und die Darstellung des Stimulus-Response-Modells sowie des Uses-and-Gratifications-Ansatzes an.
Medienwirkungen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der „Wirkung“ in der Kommunikationswissenschaft. Es zeigt die Schwierigkeiten auf, eine allgemein akzeptierte Definition zu finden und vergleicht verschiedene Ansätze. Es wird der Unterschied zwischen Wirkungen, die durch Medieninhalte und Wirkungen, die durch die bloße Existenz von Medien entstehen, hervorgehoben. Die Bedeutung des hohen Grades der Mitbestimmung der Medien über den Alltag der Menschen wird betont. Das Kapitel schließt mit einer wissenschaftlich anspruchsvolleren Definition von Medienwirkungen, die intersubjektiv feststellbare Veränderungen individuellen Verhaltens und sozialer Systeme im gesellschaftlichen Kontext berücksichtigt.
Die Anfänge der Medienwirkungsforschung – das Stimulus-Response-Modell: Dieses Kapitel behandelt das Stimulus-Response-Modell, welches als Ursprung der Medienwirkungsforschung gilt. Es beschreibt die Annahmen dieses Modells, das von einer linearen und einseitigen Wirkung ausgeht und die Rezipienten als passive Empfänger betrachtet. Kritische Punkte dieses Modells werden aufgezeigt, die seine Grenzen und Unzulänglichkeiten aufzeigen und den Weg für neue Ansätze ebnen. Die Vernachlässigung intervenierender soziologischer und psychologischer Variablen wird als ein wesentlicher Kritikpunkt hervorgehoben.
Der Übergang zum aktiven Publikum – das handlungstheoretische Konzept: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von einem passiven zu einem aktiven Publikum in der Medienwirkungsforschung. Es legt dar, wie die handlungstheoretische Perspektive die Bedeutung der individuellen Bedürfnisse und Motivationen der Rezipienten in den Mittelpunkt stellt und somit eine Abkehr vom rein kommunikationszentrierten Stimulus-Response-Modell darstellt. Das Kapitel beleuchtet den Paradigmenwechsel hin zu einer interaktiven Betrachtungsweise, in der die Rezipienten aktiv an der Konstruktion der Medienwirkung beteiligt sind.
Der Uses-and-Gratifications-approach: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Uses-and-Gratifications-Ansatz, der die Bedürfnisse und Motive der Mediennutzer als zentralen Punkt der Wirkungsforschung betrachtet. Das Eskapismus-Konzept als ein Teilaspekt dieses Ansatzes wird erläutert. Die Annahmen des Ansatzes werden detailliert dargestellt und anschließend kritisch hinterfragt. Die Kritikpunkte umfassen die oft fehlende Berücksichtigung soziologischer und psychologischer Faktoren sowie die Schwierigkeit, die individuellen Bedürfnisse der Rezipienten umfassend zu erfassen. Trotz der Kritik wird der Ansatz als bedeutender Schritt in der Entwicklung der Medienwirkungsforschung gewürdigt.
Schlüsselwörter
Medienwirkungsforschung, Stimulus-Response-Modell, Uses-and-Gratifications-approach, Handlungstheorie, Rezipientenaktivität, Medienrezeption, Wirkungsbegriff, Kausalität, Gratifikationsforschung, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Entwicklung der Medienwirkungsforschung
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Textes?
Der Text beschreibt die Entwicklung der Medienwirkungsforschung, vom kommunikationszentrierten Stimulus-Response-Modell hin zu einem rezipientenorientierten Uses-and-Gratifications-Ansatz. Er analysiert den Wandel im Verständnis der Medienrezeption und die Kritik an älteren Modellen.
Welche Modelle der Medienwirkungsforschung werden behandelt?
Der Text behandelt hauptsächlich zwei Modelle: das Stimulus-Response-Modell und den Uses-and-Gratifications-Ansatz. Das Stimulus-Response-Modell wird als veraltetes, lineares Modell kritisiert, während der Uses-and-Gratifications-Ansatz als ein rezipientenorientierter Ansatz dargestellt wird, der die Bedürfnisse und Motive der Mediennutzer in den Mittelpunkt stellt, obwohl auch dieser Ansatz kritisch beleuchtet wird.
Was ist das Stimulus-Response-Modell und welche Kritikpunkte werden genannt?
Das Stimulus-Response-Modell ist ein frühes Modell der Medienwirkungsforschung, das von einer linearen und einseitigen Wirkung ausgeht und die Rezipienten als passive Empfänger betrachtet. Die Kritikpunkte beinhalten die Vernachlässigung intervenierender soziologischer und psychologischer Variablen und die unzureichende Berücksichtigung der aktiven Rolle des Rezipienten.
Was ist der Uses-and-Gratifications-Ansatz und welche Kritikpunkte werden genannt?
Der Uses-and-Gratifications-Ansatz betrachtet die Bedürfnisse und Motive der Mediennutzer als zentralen Punkt der Wirkungsforschung. Er betont die aktive Rolle des Rezipienten. Die Kritikpunkte umfassen die oft fehlende Berücksichtigung soziologischer und psychologischer Faktoren sowie die Schwierigkeit, die individuellen Bedürfnisse der Rezipienten umfassend zu erfassen.
Wie wird der Begriff "Wirkung" im Text definiert?
Der Text zeigt die Schwierigkeiten auf, eine allgemein akzeptierte Definition von "Wirkung" zu finden. Es wird der Unterschied zwischen Wirkungen durch Medieninhalte und Wirkungen durch die bloße Existenz von Medien hervorgehoben. Eine wissenschaftlich anspruchsvollere Definition berücksichtigt intersubjektiv feststellbare Veränderungen individuellen Verhaltens und sozialer Systeme im gesellschaftlichen Kontext.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Medienwirkungsforschung, Stimulus-Response-Modell, Uses-and-Gratifications-approach, Handlungstheorie, Rezipientenaktivität, Medienrezeption, Wirkungsbegriff, Kausalität, Gratifikationsforschung und Kritik.
Was ist der zentrale Wandel, der im Text beschrieben wird?
Der Text beschreibt den Paradigmenwechsel von einem passiven zu einem aktiven Publikum in der Medienwirkungsforschung. Es wird der Wandel von der Frage „Was machen die Medien mit den Menschen?“ hin zu „Was macht der Mensch mit den Medien?“ dargestellt.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Medienwirkungen, eines zum Stimulus-Response-Modell, eines zum Übergang zum aktiven Publikum, eines zum Uses-and-Gratifications-Ansatz und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
- Citar trabajo
- Viktoria Kruse (geb. Bahle) (Autor), 1998, Medienwirkungsforschung - Vom Stimulus-Response-Modell zum Uses-and-Gratifications-approach, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8991