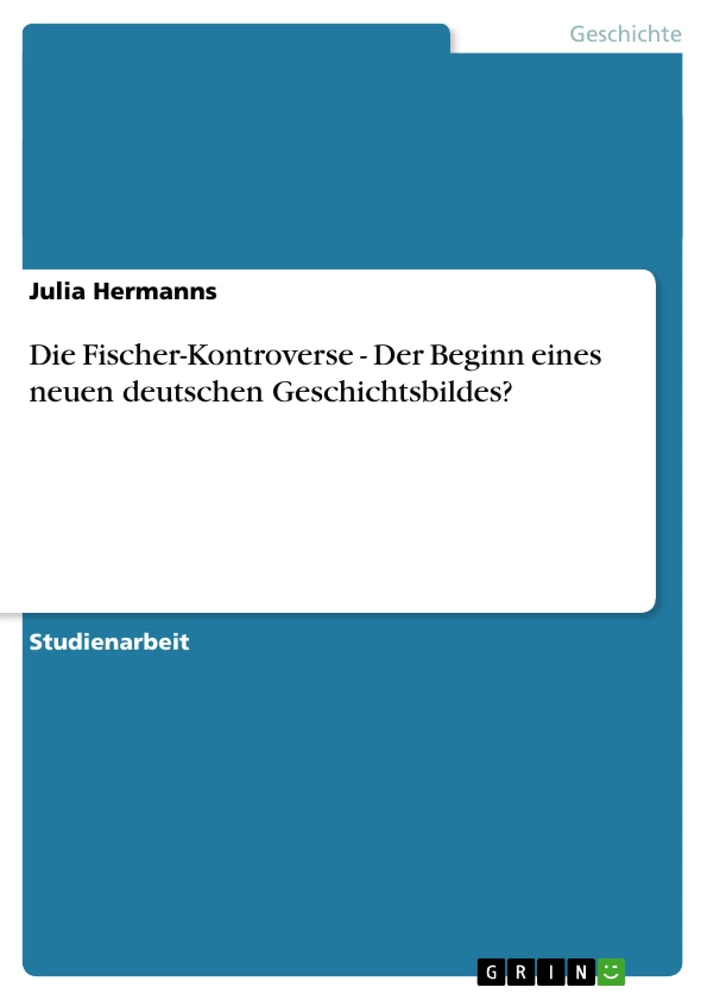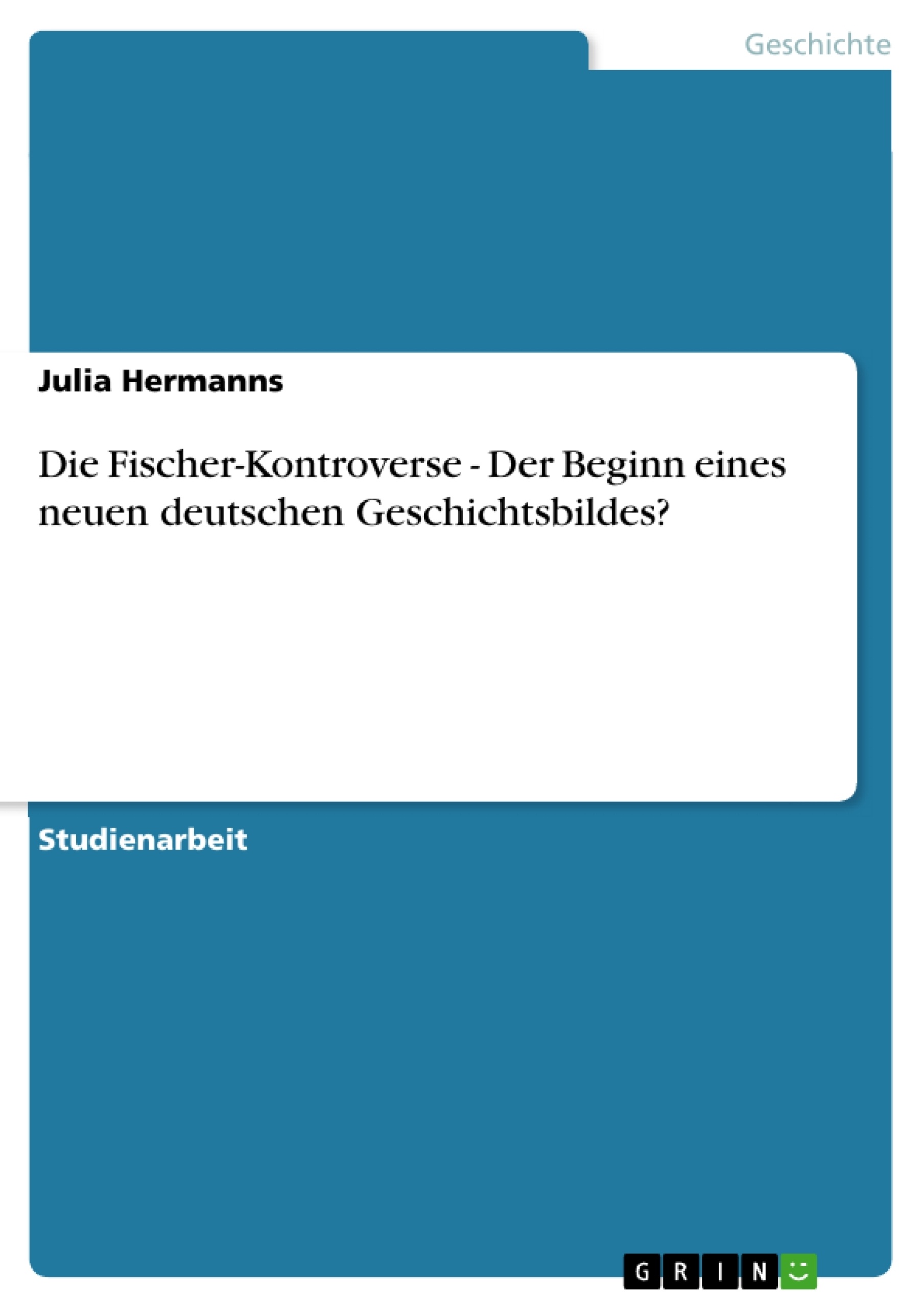Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei wesentliche Teile. Im ersten Teil wird die Ausgangsposition der Kontroverse dargestellt. Wie sah das Geschichtsbild der Nachkriegszeit aus und wie hatte es sich seit dem späten Kaiserreich entwickelt? Wie konnte es zu dem öffentlichen Geschichtsverlust kommen? Warum hatte vor allem die junge Generation keinen Bezug mehr zu Staat und Nation? Der zweite Teil handelt von den zentralen Hauptthesen Fischers. Aus welcher Perspektive betrachtete Fischer die deutsche Geschichte? Welches Quellenmaterial benutze er? Der dritte Teil beschäftigt sich mit den darauffolgenden Reaktionen und Kritikpunkten der Historikerzunft, der Politik und der Öffentlichkeit.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich auch mit der Frage, was von der Fischer-Kontroverse übrig geblieben ist. Es soll geklärt werden, ob Fischer nicht nur die Methoden der Geschichtswissenschaft revolutioniert hat, sondern ob er auch das gesellschaftliche Geschichtsbewußtsein tiefgreifend verändert hat. Auch auf die Aktualität der Fischer-Kontroverse im Prozess der deutschen Vergangenheitsbewältigung soll eingegangen werden.
Das Ziel dieser Arbeit besteht in einer intensiven Auseinandersetzung mit der bundesdeutschen Vergangenheitsbewältigung der 60er Jahre im Focus der Fischer-Kontroverse, um die Frage zu klären, "ob ihm das gelungen ist, ob also sein Buch zum besseren Verständnis deutscher Vergangenheit beiträgt oder ob es sie mißversteht und also entstellt."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die historische Urkontroverse der Bundesrepublik?
- 2. Das Deutsche Geschichtsbild 1914 bis 1960
- 3. Hauptthesen Fischers
- 3.1 Kontinuität in der deutschen Geschichte 1871 bis 1945
- 4. Fischer und seine Kritiker
- 4.1 Gerhard Ritter
- 4.2 Egmont Zechlin
- 4.3 Karl-Dietrich Erdmann
- 5. Schlußbetrachtung: Mehr als eine Kontroverse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fischer-Kontroverse der 1960er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Debatte für die bundesdeutsche Vergangenheitsbewältigung und die Veränderung des deutschen Geschichtsbildes zu analysieren. Es wird untersucht, inwieweit Fritz Fischers Thesen das gesellschaftliche Geschichtsbewusstsein beeinflusst haben und ob seine Methoden die Geschichtswissenschaft revolutioniert haben.
- Die Entwicklung des deutschen Geschichtsbildes von 1914 bis 1960
- Fritz Fischers Hauptthesen zur Kontinuität in der deutschen Geschichte und den Kriegszielen des Ersten Weltkriegs
- Die Reaktionen und Kritikpunkte von Fischers Gegnern (Ritter, Zechlin, Erdmann)
- Der Einfluss der Kontroverse auf die deutsche Öffentlichkeit und das gesellschaftliche Klima
- Das bleibende Erbe der Fischer-Kontroverse für die deutsche Geschichtswissenschaft und Vergangenheitsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die historische Urkontroverse der Bundesrepublik?: Die Einleitung stellt die Fischer-Kontroverse als Schlüsseldebatte der 1960er Jahre vor, die durch Fritz Fischers empirisch fundierte Arbeiten zur Schuldfrage und den Kriegszielen des Ersten Weltkriegs ausgelöst wurde. Sie wirft die Frage auf, ob die Kontroverse eine grundlegende Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit initiierte und das gesellschaftliche Klima nachhaltig veränderte, und ob sie zur Identitätsfindung Deutschlands beitrug. Die Einleitung beschreibt die breite öffentliche Resonanz und die Beteiligung verschiedener Akteure, von Historikern bis zu Journalisten, an der Debatte, die in Publikationen wie der Historischen Zeitung stattfand. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der vorliegenden Arbeit, welcher die Ausgangslage, Fischers Thesen und die darauf folgenden Reaktionen umfasst.
2. Das Deutsche Geschichtsbild 1914 bis 1960: Dieses Kapitel analysiert das vorherrschende deutsche Geschichtsbild in der Zeit von 1914 bis 1960. Es beleuchtet die Entwicklung des Geschichtsverständnisses von der Zeit des Kaiserreichs bis zur Nachkriegszeit und untersucht die Gründe für einen möglichen öffentlichen Geschichtsverlust und den Mangel an Bezug der jungen Generation zu Staat und Nation in der Nachkriegszeit. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die das Geschichtsverständnis prägten und den Weg für Fischers provokative Thesen ebneten. Es wird untersucht, wie die historische Aufarbeitung der Vergangenheit vor Fischer gestaltet wurde und welche Lücken oder Verzerrungen existierten, welche Fischers Arbeit thematisierte und konterkarierte.
3. Hauptthesen Fischers: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die zentralen Argumente von Fritz Fischer, insbesondere seine These der Kontinuität in der deutschen Geschichte von 1871 bis 1945. Es untersucht die von Fischer verwendeten Quellen und seine methodischen Ansätze. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Darstellung von Fischers Argumentation und der Erklärung seiner Interpretation der historischen Ereignisse. Es wird analysiert, wie Fischer seine These der deutschen Kriegsziele im Ersten Weltkrieg untermauerte und welche Schlussfolgerungen er daraus zog. Die Analyse berücksichtigt auch den Kontext der Nachkriegszeit und die Bedeutung von Fischers Arbeiten für das Verständnis der deutschen Geschichte.
4. Fischer und seine Kritiker: Dieser Abschnitt analysiert die Reaktionen auf Fischers Thesen von prominenten Historikern wie Gerhard Ritter, Egmont Zechlin und Karl-Dietrich Erdmann. Es werden deren Kritikpunkte im Detail dargestellt und die unterschiedlichen Perspektiven und Argumentationslinien beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der unterschiedlichen Interpretationen der historischen Ereignisse und der Methoden der Geschichtswissenschaft, die in der Debatte zum Tragen kamen. Die Analyse beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs und die politischen Implikationen der Kontroverse.
Schlüsselwörter
Fischer-Kontroverse, Deutsches Geschichtsbild, Erster Weltkrieg, Kriegsziele, Vergangenheitsbewältigung, Kontinuitätsthese, Gerhard Ritter, Egmont Zechlin, Karl-Dietrich Erdmann, Geschichtswissenschaft, öffentliches Geschichtsbewusstsein, Bundesrepublik Deutschland, Identitätsfindung.
Häufig gestellte Fragen zur Fischer-Kontroverse
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Fischer-Kontroverse der 1960er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Bedeutung dieser Debatte für die bundesdeutsche Vergangenheitsbewältigung und die Veränderung des deutschen Geschichtsbildes. Ein Fokus liegt auf dem Einfluss von Fritz Fischers Thesen auf das gesellschaftliche Geschichtsbewusstsein und die Frage, ob seine Methoden die Geschichtswissenschaft revolutioniert haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die die Fischer-Kontroverse einführt; ein Kapitel zum deutschen Geschichtsbild von 1914 bis 1960; ein Kapitel zu Fischers Hauptthesen; ein Kapitel zu Fischers Kritikern (Ritter, Zechlin, Erdmann); und eine Schlussbetrachtung.
Welche Hauptthesen vertritt Fritz Fischer?
Fritz Fischers zentrale These ist die Kontinuität in der deutschen Geschichte von 1871 bis 1945. Er argumentiert, dass die Kriegsziele Deutschlands im Ersten Weltkrieg auf aggressivem Expansionismus beruhten und somit eine direkte Linie zum Zweiten Weltkrieg besteht. Die Arbeit untersucht detailliert seine Argumentation und die von ihm verwendeten Quellen.
Wer waren die wichtigsten Kritiker von Fritz Fischer?
Zu den wichtigsten Kritikern von Fritz Fischer zählten die Historiker Gerhard Ritter, Egmont Zechlin und Karl-Dietrich Erdmann. Die Arbeit analysiert deren Kritikpunkte, die unterschiedlichen Perspektiven und die methodischen Auseinandersetzungen im Detail.
Wie wird das deutsche Geschichtsbild vor 1960 dargestellt?
Das Kapitel zum deutschen Geschichtsbild von 1914 bis 1960 beleuchtet die Entwicklung des Geschichtsverständnisses in dieser Zeit. Es untersucht die gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die das Geschichtsverständnis prägten und den Weg für Fischers Thesen ebneten. Es wird auch auf einen möglichen öffentlichen Geschichtsverlust und den Mangel an Bezug der jungen Generation zu Staat und Nation in der Nachkriegszeit eingegangen.
Welchen Einfluss hatte die Fischer-Kontroverse?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Kontroverse auf die deutsche Öffentlichkeit und das gesellschaftliche Klima. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, inwieweit die Debatte zur Vergangenheitsbewältigung und zur Identitätsfindung Deutschlands beitrug. Die Arbeit analysiert das bleibende Erbe der Fischer-Kontroverse für die deutsche Geschichtswissenschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fischer-Kontroverse, Deutsches Geschichtsbild, Erster Weltkrieg, Kriegsziele, Vergangenheitsbewältigung, Kontinuitätsthese, Gerhard Ritter, Egmont Zechlin, Karl-Dietrich Erdmann, Geschichtswissenschaft, öffentliches Geschichtsbewusstsein, Bundesrepublik Deutschland, Identitätsfindung.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit nennt zwar nicht explizit die verwendeten Quellen, aber es wird deutlich, dass die Analyse auf den Werken von Fritz Fischer und seinen Kritikern sowie auf zeitgenössischen Publikationen und dem öffentlichen Diskurs basiert.
- Arbeit zitieren
- Julia Hermanns (Autor:in), 2002, Die Fischer-Kontroverse - Der Beginn eines neuen deutschen Geschichtsbildes?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8970