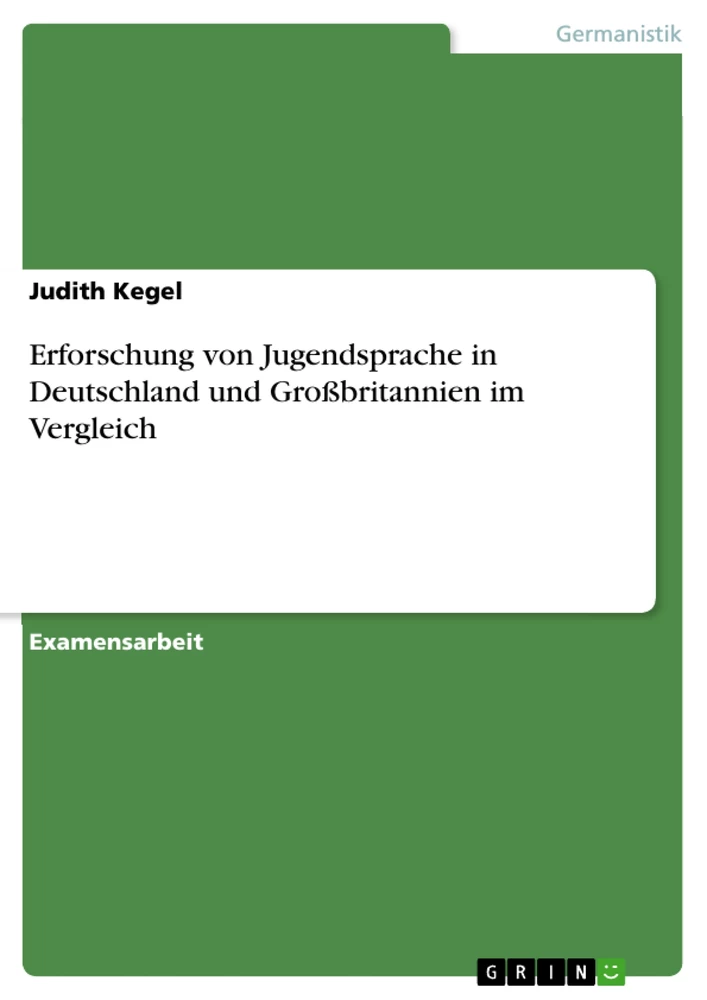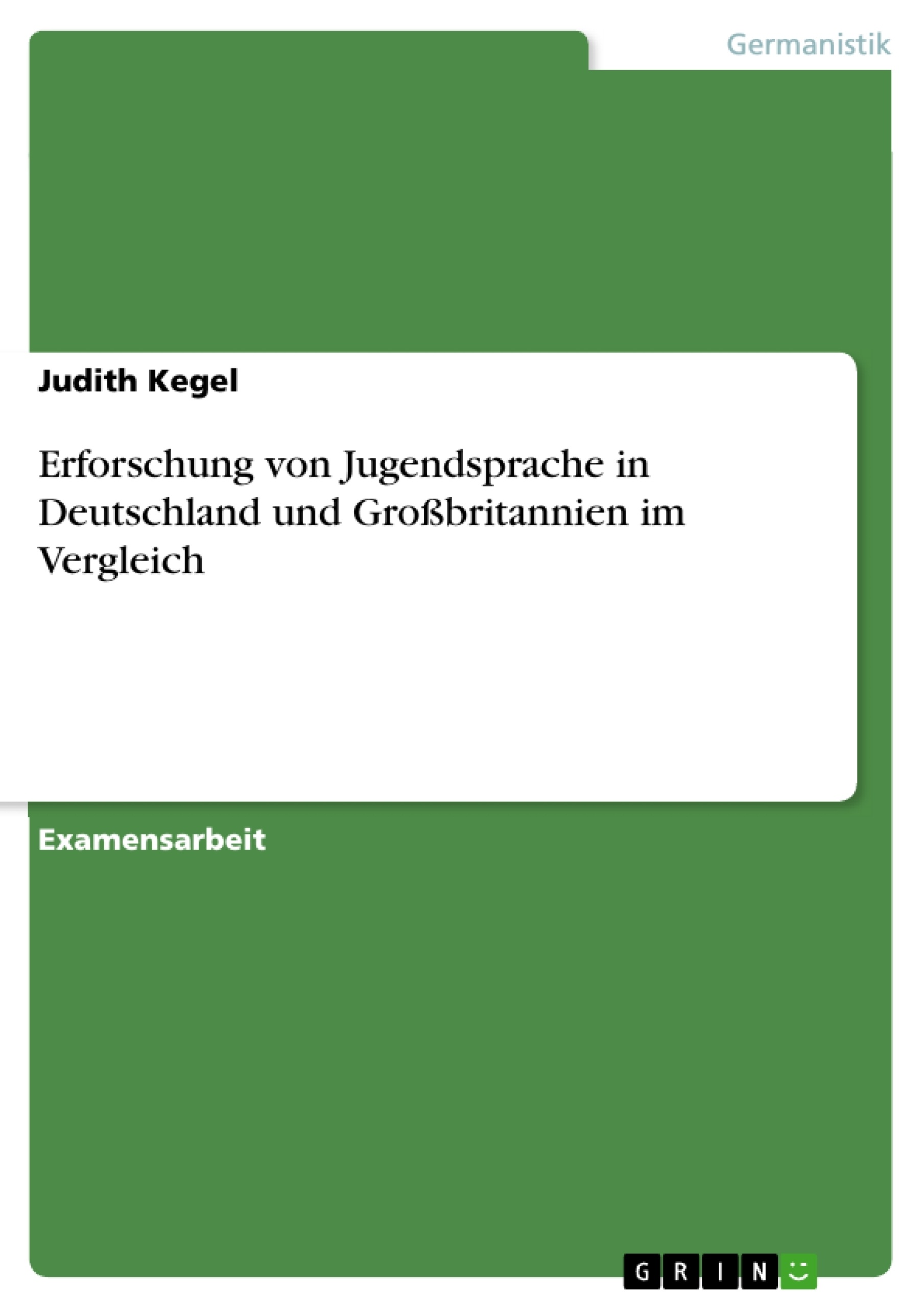„Sprache ist kein Produkt, kein fixierbares System, sondern ein Prozess: die geistige Tätigkeit von Menschen in einer Sprachgemeinschaft.“ (Weisgerber 1998: 68).
Sprache ändert sich also, ist Wandlungen unterworfen und kommt in verschiedenen Variationen vor, so gibt es unter anderem die große Gruppe der Dialekte.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich aber mit der Erforschung einer anderen Sprachvarietät auseinandersetzen, der Sprache Jugendlicher.
Jugendliche sind das Objekt vieler Forschungsbereiche (u.a. auch der Pädagogik), aber „ihre“ Sprache ist dabei von besonderem Interesse, da sie als ein markantes Merkmal ihrer Sprecher hervortritt.
Ich möchte in meiner Arbeit unter anderem dieser Frage nachgehen, was genau ist „Jugendsprache“? Ist es überhaupt eine eigenständige Sprache oder vielmehr ein Ensemble verschiedener Sprechstile? Spricht nicht jeder Jugendliche eine andere Sprache bzw. spricht jeder Jugendliche auch gleichzeitig Jugendsprache?
Von besonderem Interesse war für mich dabei die Frage nach der Erforschung von Jugendsprache, d.h. seit wann wird überhaupt auf diesem Gebiet geforscht, welche Forschungsinteressen verbinden die Linguisten mit diesem Gebiet?
Doch werden die Antworten auf diese Fragen noch bedeutsamer in einem direkten Vergleich mit einem anderen europäischen Land, nämlich Großbritannien (bzw. hier vor allem England). So hat in Birmingham das Centre for Contemporary Cultural Studies seinen Sitz, das sich bereits Ende der 70er Jahre mit dem Jugendphänomen auseinander gesetzt hat, so erschien es mir sehr interessant zu erfahren, in wieweit sich das Forschungsinteresse auch auf die jugendlichen Sprechweisen ausweitet.
In der folgenden Arbeit zeige ich also die Forschungslage in der Jugendspracheforschung in Deutschland und Großbritannien ebenso wie grundsätzliche didaktische Überlegungen bei der Behandlung des Themas im Unterricht, bevor ich zwei Sprachbücher und das in ihnen präsentierte Material zum Thema „Jugendsprache“ analysiere und abschließend eigene Unterrichtsvorschläge präsentiere.
Die Kapitel 3 und 4 befassen sich jeweils mit der Erforschung von Jugendsprache in Deutschland. Doch hier tritt bereits das erste Problem auf: Was ist genau ist eigentlich „Jugendsprache“? So konstatiert Androutsopoulos: „Eine gewisse Uneinheitlichkeit herrscht über den terminologischen wie auch den begrifflichen Status des Forschungsgegenstandes.“ (Androutsopoulos 1998: 32).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Verortung der Jugendsprache im Bereich der Linguistik
- 2.1 Jugend in soziologischer Perspektive
- 2.1.1 Jugendliche Subkulturen
- 2.2 Soziolinguistik und Sprachvarietäten
- 2.2.1 Varietätenlinguistik
- 2.2.1.1 Varietätenanalyse
- 2.2.1.2 Jugendsprache und Standardsprache
- 3 Jugendspracheforschung in Deutschland bis etwa 1993
- 3.1 Historischer Überblick
- 3.2 Methodik der Erforschung von Jugendsprache
- 3.2.1 Der lexikalische Ansatz
- 3.2.2 Der ethnografische Ansatz
- 4 Jugendspracheforschung in Deutschland heute
- 4.1 Aktueller Forschungsstand
- 4.2 Interessengebiete
- 4.2.1 Strukturen der deutschen Jugendsprache
- 4.2.1.1 Peer-group-Kommunikation
- 4.2.1.2 Systemlinguistische Untersuchungen
- 4.2.1.2.1 Jugendtypische Wortbildung
- 4.2.1.2.2 Jugendtypische Syntax
- 4.2.1.2.3 Jugendtypischer Wortschatz
- 4.2.1.2.4 Entlehnungen
- 4.2.2 Funktionen von Jugendsprache
- 4.2.2.1 Die Abgrenzungsfunktion
- 4.2.2.2 Die Identifikationsfunktion
- 5 Jugendspracheforschung in Großbritannien
- 5.1 Der Begriff des „slang“
- 5.2 Ausgewählte Forschungsprojekte
- 5.3 Ursprünge des alternativen Vokabulars britischer Jugendlicher
- 6 Vergleich zwischen Deutschland und Großbritannien
- 7 Grundlegende didaktische Überlegungen
- 7.1 Unterschiede zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 7.2 Einordnung des Themas „Jugendsprache“ in Lernbereiche innerhalb des Deutschunterrichts
- 7.2.1 Analyse des Bildungsplans für die Hauptschule des Landes Baden-Württemberg
- 7.3 Kompetenzbereiche
- 7.4 Perspektivenvielfalt der Thematik
- 8 Analyse von Sprachbuchmaterial zum Thema „Jugendsprache“
- 8.1 Das Thema „Jugendsprache“ im Schulbuch
- 8.2 Zu Grunde liegende grammatikdidaktische Positionen
- 8.3 Umsetzung in zwei Sprachbüchern für die Hauptschule
- 8.3.1 „Sprachbuch Deutsch 9“
- 8.3.2 „Mit eigenen Worten 2“
- 8.3.3 Resumée
- 9 Eigene Vorschläge zur didaktischen Umsetzung
- 9.1 Modalpartikeln (Partikeln der Abtönung)
- 9.1.1 Die Partikel „ey“
- 9.2 Unterrichtskonzeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Jugendsprache in Deutschland und Großbritannien im Vergleich und erörtert Möglichkeiten ihrer didaktischen Umsetzung im Deutschunterricht der Hauptschule. Ziel ist es, den Forschungsstand in beiden Ländern zu beleuchten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und daraus didaktische Konsequenzen für den Unterricht abzuleiten.
- Vergleichende Analyse der Jugendspracheforschung in Deutschland und Großbritannien
- Untersuchung der Strukturen und Funktionen von Jugendsprache
- Didaktische Überlegungen zur Einbindung von Jugendsprache in den Deutschunterricht
- Analyse von existierenden Sprachbuchmaterialien
- Entwicklung eigener Unterrichtsvorschläge
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugendsprache ein und erläutert die Forschungsfrage. Sie thematisiert die kontroverse Wahrnehmung von Jugendsprache als Sprachverfall und stellt die zentrale Frage nach der Definition und Eigenständigkeit von Jugendsprache. Der Vergleich mit Großbritannien wird als wichtiger Aspekt der Arbeit herausgestellt, wobei die eingeschränkte Verfügbarkeit britischer Forschungsliteratur erwähnt wird. Die Arbeit gliedert sich in die einzelnen Kapitel und skizziert den methodischen Ansatz.
2 Verortung der Jugendsprache im Bereich der Linguistik: Dieses Kapitel verortet Jugendsprache im Kontext der Linguistik, beginnend mit einer soziologischen Betrachtung von Jugend und Jugendkulturen. Es führt in die Varietätenlinguistik ein und differenziert zwischen Jugendsprache und Standardsprache. Die soziolinguistische Perspektive betont den sozialen Kontext und die Funktion von Sprachvarietäten, einschließlich Jugendsprache, innerhalb der Gesellschaft.
3 Jugendspracheforschung in Deutschland bis etwa 1993: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die deutsche Jugendspracheforschung bis 1993. Es analysiert die verwendeten Forschungsmethoden, insbesondere den lexikalischen und den ethnographischen Ansatz. Die Entwicklung der Forschungsperspektiven wird dargestellt und die Bedeutung des Buches "Jugendsprache: Fiktion und Wirklichkeit" von Schlobinski et al. als Wendepunkt hervorgehoben.
4 Jugendspracheforschung in Deutschland heute: Das Kapitel behandelt den aktuellen Forschungsstand zur deutschen Jugendsprache. Es beleuchtet verschiedene Forschungsgebiete, darunter die Strukturen (Wortbildung, Syntax, Wortschatz, Entlehnungen) und Funktionen (Abgrenzung, Identifikation) der Jugendsprache. Der Fokus liegt auf der systemlinguistischen Analyse der sprachlichen Besonderheiten und ihrer Bedeutung für die Jugendlichen.
5 Jugendspracheforschung in Großbritannien: Dieses Kapitel widmet sich der Jugendspracheforschung in Großbritannien. Es definiert den Begriff "slang" im britischen Kontext und präsentiert ausgewählte Forschungsprojekte. Es untersucht die Ursprünge des alternativen Vokabulars britischer Jugendlicher und beleuchtet die kulturellen und sozialen Faktoren, die die Entwicklung der Jugendsprache beeinflussen.
6 Vergleich zwischen Deutschland und Großbritannien: Dieser Abschnitt vergleicht die Jugendspracheforschung und die sprachlichen Phänomene in Deutschland und Großbritannien, wobei er auf die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Forschungsansätze und Ergebnisse eingeht. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung und Verwendung von Jugendsprache werden analysiert.
7 Grundlegende didaktische Überlegungen: Dieses Kapitel befasst sich mit didaktischen Überlegungen zur Behandlung von Jugendsprache im Deutschunterricht. Es werden die Unterschiede zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die Einordnung des Themas in den Bildungsplan und relevante Kompetenzbereiche diskutiert. Der Fokus liegt auf der Perspektivenvielfalt der Thematik und der Bedeutung für den Sprachunterricht.
8 Analyse von Sprachbuchmaterial zum Thema „Jugendsprache“: Das Kapitel analysiert vorhandenes Sprachbuchmaterial zum Thema Jugendsprache. Es untersucht die zugrundeliegenden grammatikdidaktischen Positionen und die Umsetzung in zwei ausgewählten Sprachbüchern für die Hauptschule ("Sprachbuch Deutsch 9" und "Mit eigenen Worten 2"). Schließlich fasst es die Ergebnisse zusammen und bewertet das präsentierte Material.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Soziolinguistik, Varietätenlinguistik, Sprachwandel, Deutschland, Großbritannien, Slang, Didaktik, Deutschunterricht, Hauptschule, Sprachbuch, Forschungsmethoden, Peer-group-Kommunikation, Identifikation, Abgrenzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Jugendsprache in Deutschland und Großbritannien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht vergleichend die Jugendsprache in Deutschland und Großbritannien und erörtert deren didaktische Umsetzung im Deutschunterricht der Hauptschule. Sie beleuchtet den Forschungsstand in beiden Ländern, zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf und leitet daraus didaktische Konsequenzen ab.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine vergleichende Analyse der Jugendspracheforschung in Deutschland und Großbritannien, die Untersuchung der Strukturen und Funktionen von Jugendsprache, didaktische Überlegungen zur Einbindung von Jugendsprache in den Deutschunterricht, die Analyse existierender Sprachbuchmaterialien und die Entwicklung eigener Unterrichtsvorschläge.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Verortung der Jugendsprache in der Linguistik, Jugendspracheforschung in Deutschland bis 1993, Jugendspracheforschung in Deutschland heute, Jugendspracheforschung in Großbritannien, Vergleich Deutschland/Großbritannien, Didaktische Überlegungen, Analyse von Sprachbuchmaterial und eigene didaktische Vorschläge. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Forschungsmethoden werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Forschungsmethoden, insbesondere den lexikalischen und ethnographischen Ansatz in der deutschen Jugendspracheforschung. Der Fokus liegt auf der systemlinguistischen Analyse der sprachlichen Besonderheiten.
Welche Aspekte der Jugendsprache werden untersucht?
Untersucht werden die Strukturen der Jugendsprache (Wortbildung, Syntax, Wortschatz, Entlehnungen) und ihre Funktionen (Abgrenzung, Identifikation). Der Vergleich zwischen der deutschen und britischen Jugendsprache (inkl. dem Begriff "Slang") spielt eine zentrale Rolle.
Wie wird die Jugendsprache im Kontext des Deutschunterrichts betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Einordnung des Themas "Jugendsprache" in den Bildungsplan, relevante Kompetenzbereiche und die Unterschiede zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Sie analysiert existierendes Sprachbuchmaterial und entwickelt eigene Unterrichtsvorschläge, z.B. zur Behandlung von Modalpartikeln.
Welche Sprachbücher werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das Sprachbuchmaterial von "Sprachbuch Deutsch 9" und "Mit eigenen Worten 2" und bewertet deren Umsetzung des Themas "Jugendsprache".
Welche konkreten didaktischen Vorschläge werden gemacht?
Die Arbeit enthält konkrete didaktische Vorschläge, beispielsweise zur Behandlung von Modalpartikeln wie "ey" und eine umfassende Unterrichtskonzeption.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Soziolinguistik, Varietätenlinguistik, Sprachwandel, Deutschland, Großbritannien, Slang, Didaktik, Deutschunterricht, Hauptschule, Sprachbuch, Forschungsmethoden, Peer-group-Kommunikation, Identifikation, Abgrenzung.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit trägt dazu bei, den Forschungsstand zur Jugendsprache in Deutschland und Großbritannien zu vergleichen und daraus praxisrelevante didaktische Konsequenzen für den Deutschunterricht abzuleiten. Sie schließt somit eine Lücke zwischen Forschung und unterrichtlicher Praxis.
- Quote paper
- Judith Kegel (Author), 2006, Erforschung von Jugendsprache in Deutschland und Großbritannien im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89648