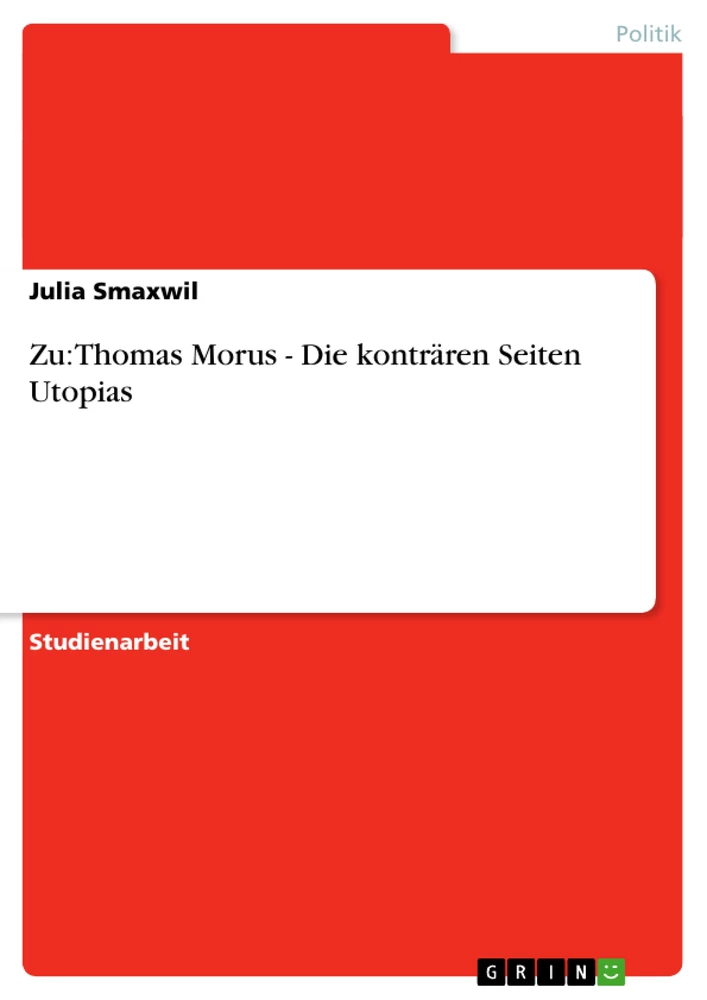Im Jahre 1516 wurde ein Werk veröffentlicht, dass eine neue Gattung einleiten sollte.
Mit dem Werk „Utopia“, oder, wie es im Original heißt „De optimo rei publicae statu
deque nova insula Utopia“ schuf Sir Thomas Morus (1478-1535) eine Schrift, deren
Typus viele Arbeiten nachfolgender Schriftsteller prägte. In dieser Staatsschrift
kreierte Morus in Tradition antiker Staatstheorie, deren Bezugnahme sich bei Morus
„Utopia“ auch bei schriftlichen Auseinandersetzungen mit Platon finden lassen, ein
Gemeinwesen, das sich dadurch hervorhebt, dass es im spiegelbildlichen Gegensatz
zu den real existierenden Missständen seiner Zeit steht. Die Gesellschaft ist
angesiedelt auf einer fernen Insel und wird von einem Weltreisenden namens
Raphael Hythlodeus1 beschrieben, der diese besucht haben soll. Die Gemeinschaft
ist unter anderem besonders gekennzeichnet durch Eigentumslosigkeit, religiöse
Toleranz und Selbstverwirklichung durch Bildung.
„Utopia“ gilt als Entwurf einer idealen menschlichen Gesellschaft.2 Formal ist das
Werk in zwei Bücher aufgeteilt. Das erste gibt einen Dialog zwischen Morus und dem
schon erwähnten imaginären Reisenden Hythlodäus wieder, in dem die
zeitgenössische englische Gesellschaft scharf kritisiert wird, das Zweite ist die
romanhafte Beschreibung des „Nirgendortes“ Utopia und dessen sozialen,
ökonomischen, politischen und religiösen Gegebenheiten.
Das Bild des idealen Staates wird jedoch getrübt. Utopia ist kein romantisches
Paradies ohne Konflikte mit der Außenwelt, sondern ein Staat, von dem solche
Konflikte ausgehen.
In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, zu erklären, wie es sich
vereinbaren lässt, dass dieser innerlich friedfertige, von humanistischen Gedanken
geprägte imaginäre Staat nach außen als imperiale Hegemonialmacht auftritt.
Hierzu soll zunächst anhand des Werkes die Situation dargestellt werden, bevor der
Widerspruch aufgezeigt wird. Der Begriff der Utopie ist ein Begriff der Neuzeit.
Thomas Morus benutzt als erster Autor den Begriff in seinem hier besprochenen
Staatsroman.
Utopie[griech.] ist ein dem Kunstwort „Utopia“ („Nirgendort“, „Nicht-Platz“)
nachgebildetes Substantiv aus der Negation „ou“ [griech.: nicht] und dem Substantiv
„topos“ [griech.: Platz].
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER BEGRIFF DER UTOPIE
- WERKIMMANENTE BETRACHTUNG
- MORES IDEALSTAAT
- MORUS KRITIK AN DER ZEITGENÖSSISCHEN AUBENPOLITIK.
- DIE KONTRÄREN SEITEN UTOPIAS.....
- KRITISCHE BETRACHTUNG DER AUBENBEZIEHUNGEN UND DES KRIEGES
- FAZIT.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Thomas Morus - Die konträren Seiten Utopias“ befasst sich mit der Analyse des berühmten Werkes „Utopia“ von Thomas Morus. Ziel ist es, die scheinbaren Widersprüche zwischen dem idealen Gesellschaftsentwurf Utopias und seiner Darstellung als imperiale Macht im Verhältnis zur Außenwelt zu erklären.
- Der Begriff der Utopie und seine Bedeutung in der Neuzeit
- Morus' idealer Staat und seine revolutionären Elemente wie Freiheit, Bildung und religiöse Toleranz
- Kritik an der Außenpolitik der damaligen Zeit
- Die konträren Seiten Utopias: Der Widerspruch zwischen friedlicher Innenpolitik und imperialer Außenpolitik
- Die Rolle von Krieg und Gewalt im utopischen Ideal
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt das Werk „Utopia“ von Thomas Morus als eine prägende Schrift der Literaturgeschichte vor. Dabei werden die zentralen Merkmale Utopias, wie Eigentumslosigkeit, religiöse Toleranz und Bildung, hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Utopie und seiner Entwicklung in der Neuzeit. Morus wird als erster Autor erwähnt, der diesen Begriff in seinem Staatsroman „Utopia“ einführte. Das Kapitel beleuchtet auch die literarische Tradition der Utopie, beginnend mit Platon, und ihre unterschiedlichen Ausprägungen im Laufe der Zeit.
Kapitel drei widmet sich der Analyse von Morus' Idealstaat in „Utopia“. Die Autorin beschreibt den utopischen Entwurf als revolutionär und humanistisch, geprägt von Vernunft, Zusammenarbeit und Frieden. Die revolutionären Aspekte des Idealstaats werden beleuchtet, darunter die (eingeschränkte) Demokratie, Freiheit der Arbeit, allgemeine Bildung und die Abwesenheit von Privateigentum und Klassenunterschieden. Die religiöse Toleranz der Utopier und die damit verbundenen Einschränkungen für Nicht-Gläubige werden ebenfalls behandelt.
Im vierten Kapitel analysiert die Autorin die Kritik, die Morus im ersten Buch von „Utopia“ an der zeitgenössischen Außen- und Kriegspolitik übt. Hythlodäus, der imaginäre Reisende, kritisiert die bestehende politische Ordnung und ihre militärischen Praktiken.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Hausarbeit sind: Thomas Morus, Utopie, Idealstaat, Gesellschaftsentwurf, Außenpolitik, Krieg, Imperialismus, Humanismus, Vernunft, Bildung, Toleranz, Frieden, Kritik, Revolution, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Utopia"?
Der Begriff wurde von Thomas Morus geprägt und leitet sich vom Griechischen für „Nirgendort“ oder „Nicht-Platz“ ab.
Was sind die zentralen Merkmale der Gesellschaft in Morus' Utopia?
Die utopische Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Eigentumslosigkeit, religiöse Toleranz, allgemeine Bildung und eine (eingeschränkte) demokratische Struktur.
Welchen Widerspruch analysiert die Arbeit in Bezug auf Utopia?
Die Arbeit untersucht, wie der innerlich friedfertige und humanistische Staat Utopia nach außen hin als imperiale Hegemonialmacht auftreten kann, die Konflikte sucht.
Wer ist Raphael Hythlodäus?
Er ist ein fiktiver Weltreisender, der im Buch die Insel Utopia beschreibt und gleichzeitig scharfe Kritik an der zeitgenössischen englischen Gesellschaft übt.
Wie steht Utopia zum Thema Krieg?
Obwohl Utopia im Inneren auf Frieden setzt, wird das Bild durch eine aggressive Außenpolitik getrübt, was die „konträren Seiten“ des Werkes offenbart.
- Quote paper
- Julia Smaxwil (Author), 2004, Zu: Thomas Morus - Die konträren Seiten Utopias, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89625