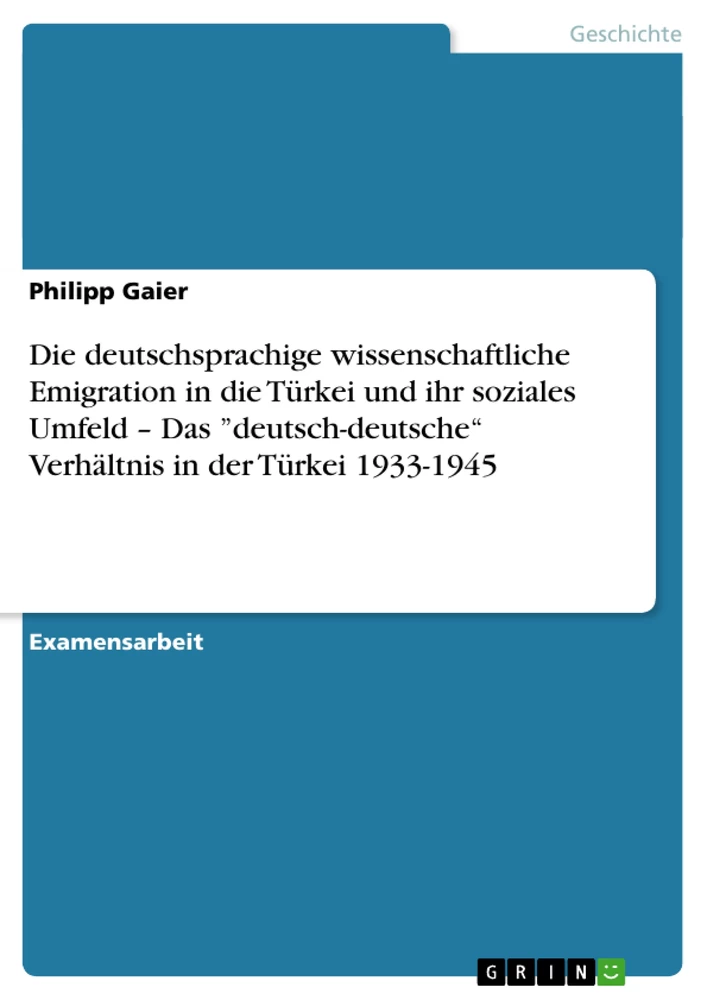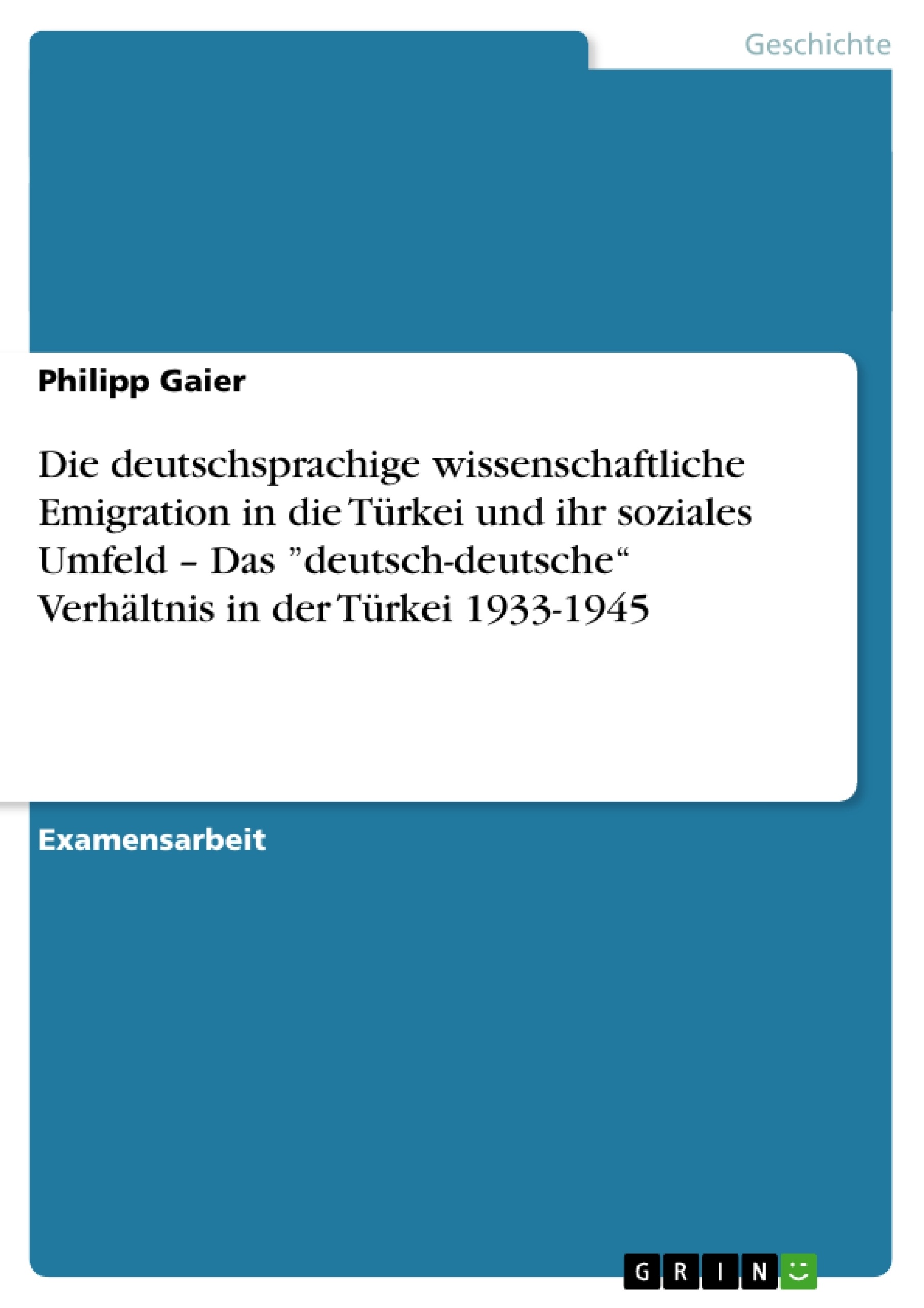Die Aufmerksamkeit, die der Türkei als Emigrationsland 1933-1945 entgegengebracht wurde, ist bis in die jüngste Zeit sehr gering geblieben. Dies dürfte vor allem zwei Gründe gehabt haben. Zum einen beschränkte sich die emigrierte Personengruppe auf eine kleine Anzahl von Wissenschaftlern und Künstlern und erreichte daher niemals die quantitativen Ausmaße der Flucht in Länder wie z. B. die USA oder Großbritannien. Zum anderen findet man auf der Liste der Türkei-Emigranten, sieht man einmal von Ernst Reuter, dem ersten regierenden Bürgermeister Westberlins nach 1945 ab, kaum populäre Namen, die das Interesse der Forschung und der Allgemeinheit geweckt hätten. Im Gegensatz dazu stehen wiederum etwa die USA, die prominentere Namen vorzuweisen hatten, wie z. B. Thomas Mann, Berthold Brecht oder Albert Einstein, um nur einige wenige zu nennen.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 gingen Repressionen gegen Juden und politische Gegner wie Sozialdemokraten oder Kommunisten einher, die einen Exodus meist jüdischer Wissenschaftler verursachten. Aufgrund der Gesetzesverordnung zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 1933 wurden an deutschen, nach 1938 auch an den österreichischen Universitäten tausende Hochschullehrer und Assistenten entlassen und sahen sich aufgrund fehlender Perspektiven oder rücksichtsloser Hetze gezwungen, Deutschland zu verlassen.
Auf Einladung der jungen „Türkischen Republik“ gelangten noch im selben Jahr die ersten aus Deutschland geflohenen Akademiker in die Türkei, wo sie im Dienste der türkischen Regierung an den Hochschulen in Istanbul oder Ankara, bzw. als Berater an regierungsnahen Institutionen tätig waren. Was sich für das geistige Leben in Deutschland als enormer und nicht wieder auszugleichender Verlust erwies, wobei die Universitäten in Berlin, Heidelberg und Frankfurt den größten Abgang von Professoren zu verkraften hatten1, stellte für die junge kemalistische Türkei eine einmalige Gelegenheit dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Forschungsstand und literarische Rezension
- Von der Militärhilfe bis zur Kriegserklärung: Die deutsch-türkischen Beziehungen bis 1945
- Das deutsch-türkische Verhältnis bis zum Ersten Weltkrieg: Die deutsche Militärmission in der Türkei
- Deutschland und die Türkei nach dem Ersten Weltkrieg: die 1920er Jahre
- Die deutsch-türkischen Beziehungen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
- Die deutsch-türkischen Beziehungen nach Kriegsbeginn
- Das Dreimächtebündnis 1939
- Von der Dreimächteallianz zum Freundschaftsvertrag mit Deutschland 1941
- Die Entwicklung bis zur Kriegserklärung 1945
- Atatürks moderner Staat: ein neues Betätigungsfeld für die Deutschen in der Türkei
- Die kemalistischen Reformen
- Die Bildungsreform
- Die Hochschulbildung
- „Offizielle“ deutsche Hilfe in der Türkei
- Die „Deutsche Kolonie“
- Deutsche emigrierte Wissenschaftler im Dienste der Türkei: 1933-1945
- Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 1933
- Die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland
- Die Ankunft in der Türkei
- Anfangsschwierigkeiten im Alltags- und Hochschulleben
- Die Emigranten als isolierte Minderheit gegenüber den Reichsdeutschen und den Türken
- Die Emigranten untereinander
- Wissenschaftliche Gruppierungen
- Politische Gruppierungen
- Die Emigranten und das Verhältnis zu den offiziellen Vertretern des „Dritten Reiches“ unter Berücksichtigung der deutsch-türkischen Beziehungen
- Die Nazifizierung der „Deutschen Kolonie“
- Das Verhältnis zur Botschaft
- Die Instrumentalisierung von Emigranten durch die Reichsbehörden
- Das Verhältnis zur „Deutschen Kolonie“
- Der Scurla Bericht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutschsprachige wissenschaftliche Emigration in die Türkei zwischen 1933 und 1945 und deren soziales Umfeld, mit besonderem Fokus auf das Verhältnis zwischen den Emigranten und den bereits in der Türkei lebenden Deutschen sowie den türkischen Behörden. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen der nationalsozialistischen Regierung, den Emigranten und der türkischen Regierung in diesem Zeitraum.
- Die deutsch-türkischen Beziehungen im Kontext der politischen und militärischen Entwicklungen zwischen 1933 und 1945.
- Die Rolle der Emigranten in der Modernisierung der Türkei und ihr Beitrag zur türkischen Wissenschaft.
- Die sozialen und politischen Herausforderungen der Emigranten in der Türkei.
- Das Verhältnis der Emigranten zu den in der Türkei ansässigen Deutschen ("Deutsche Kolonie").
- Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der Emigranten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die bis dato geringe Forschungsaufmerksamkeit bezüglich der deutschsprachigen Emigration in die Türkei zwischen 1933 und 1945, begründet durch die geringe Anzahl an Emigranten und das Fehlen prominenter Namen im Gegensatz zu anderen Emigrationsländern. Sie führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Emigration aufgrund nationalsozialistischer Repressionen und des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums". Die einmalige Gelegenheit für die junge türkische Republik, den Wissensrückstand durch die Aufnahme der Emigranten zu verringern, wird hervorgehoben.
Von der Militärhilfe bis zur Kriegserklärung: Die deutsch-türkischen Beziehungen bis 1945: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen von der Militärhilfe bis zur Kriegserklärung 1945. Es analysiert die Beziehungen im Ersten Weltkrieg, in den 1920er Jahren, und die Verschlechterung nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Dreimächtebündnis und dem Freundschaftsvertrag von 1941, unterstreicht die komplexen politischen und strategischen Erwägungen und zeigt die Entwicklung bis zum Kriegseintritt der Türkei.
Atatürks moderner Staat: ein neues Betätigungsfeld für die Deutschen in der Türkei: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der deutschen Emigranten in der Modernisierung der Türkei unter Atatürk. Es beleuchtet die kemalistischen Reformen und die damit verbundene Bildungsreform, insbesondere die Hochschulbildung. Die „offizielle“ deutsche Hilfe, die „Deutsche Kolonie“ und die spezifischen Beiträge der emigrierten Wissenschaftler werden detailliert analysiert. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der deutschen Expertise für den Aufbau eines modernen türkischen Staates.
Die Emigranten als isolierte Minderheit gegenüber den Reichsdeutschen und den Türken: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die soziale Situation der Emigranten in der Türkei. Es behandelt die Beziehungen der Emigranten untereinander, die Bildung wissenschaftlicher und politischer Gruppierungen und analysiert das schwierige Verhältnis zu den Reichsdeutschen der "Deutschen Kolonie" und den offiziellen Vertretern des Dritten Reiches in der Türkei. Die Kapitel beleuchten die Instrumentalisierungsversuche der Reichsbehörden und den Scurla-Bericht.
Schlüsselwörter
Deutschsprachige Emigration, Türkei, 1933-1945, Nationalsozialismus, Atatürk, Kemalismus, Modernisierung, Wissenschaft, Hochschulbildung, Deutsche Kolonie, Reichsdeutsche, politische Beziehungen, soziale Integration, Exil, Wissenschaftsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur deutschsprachigen wissenschaftlichen Emigration in die Türkei (1933-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die deutschsprachige wissenschaftliche Emigration in die Türkei zwischen 1933 und 1945. Der Fokus liegt auf dem sozialen Umfeld der Emigranten, insbesondere ihrem Verhältnis zu bereits in der Türkei lebenden Deutschen ("Deutsche Kolonie") und den türkischen Behörden. Die komplexen Beziehungen zwischen der nationalsozialistischen Regierung, den Emigranten und der türkischen Regierung werden beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die deutsch-türkischen Beziehungen im Kontext der politischen und militärischen Entwicklungen (1933-1945), die Rolle der Emigranten bei der Modernisierung der Türkei und ihren Beitrag zur türkischen Wissenschaft, die sozialen und politischen Herausforderungen der Emigranten, das Verhältnis der Emigranten zur "Deutschen Kolonie" und die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der Emigranten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Forschungsstand und Aufbau), Von der Militärhilfe bis zur Kriegserklärung: Die deutsch-türkischen Beziehungen bis 1945, Atatürks moderner Staat: ein neues Betätigungsfeld für die Deutschen in der Türkei, Die Emigranten als isolierte Minderheit gegenüber den Reichsdeutschen und den Türken und Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet den bisherigen Forschungsstand, der die deutschsprachige Emigration in die Türkei in diesem Zeitraum aufgrund der geringen Anzahl an Emigranten und dem Fehlen prominenter Namen bisher vernachlässigt hat. Sie führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Emigration (nationalsozialistische Repressionen, "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums") sowie die Bedeutung der Emigranten für die Modernisierung der Türkei.
Was wird im Kapitel über die deutsch-türkischen Beziehungen behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen von der Militärhilfe bis zur Kriegserklärung 1945. Es untersucht die Beziehungen im Ersten Weltkrieg, in den 1920er Jahren und die Verschlechterung nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Der Fokus liegt auf dem Dreimächtebündnis und dem Freundschaftsvertrag von 1941, und beleuchtet die politischen und strategischen Erwägungen bis zum Kriegseintritt der Türkei.
Was wird im Kapitel über Atatürks modernen Staat behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der deutschen Emigranten in der Modernisierung der Türkei unter Atatürk, beleuchtet die kemalistischen Reformen und die Bildungsreform (insbesondere die Hochschulbildung). Es analysiert die „offizielle“ deutsche Hilfe, die „Deutsche Kolonie“ und die Beiträge emigrierter Wissenschaftler zur Entwicklung eines modernen türkischen Staates.
Was wird im Kapitel über die Emigranten als isolierte Minderheit behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die soziale Situation der Emigranten, ihre Beziehungen untereinander (wissenschaftliche und politische Gruppierungen), ihr schwieriges Verhältnis zu den Reichsdeutschen der "Deutschen Kolonie" und den Vertretern des Dritten Reiches. Es beleuchtet die Instrumentalisierungsversuche der Reichsbehörden und den Scurla-Bericht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutschsprachige Emigration, Türkei, 1933-1945, Nationalsozialismus, Atatürk, Kemalismus, Modernisierung, Wissenschaft, Hochschulbildung, Deutsche Kolonie, Reichsdeutsche, politische Beziehungen, soziale Integration, Exil, Wissenschaftsgeschichte.
- Quote paper
- Philipp Gaier (Author), 2007, Die deutschsprachige wissenschaftliche Emigration in die Türkei und ihr soziales Umfeld – Das ”deutsch-deutsche“ Verhältnis in der Türkei 1933-1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89452