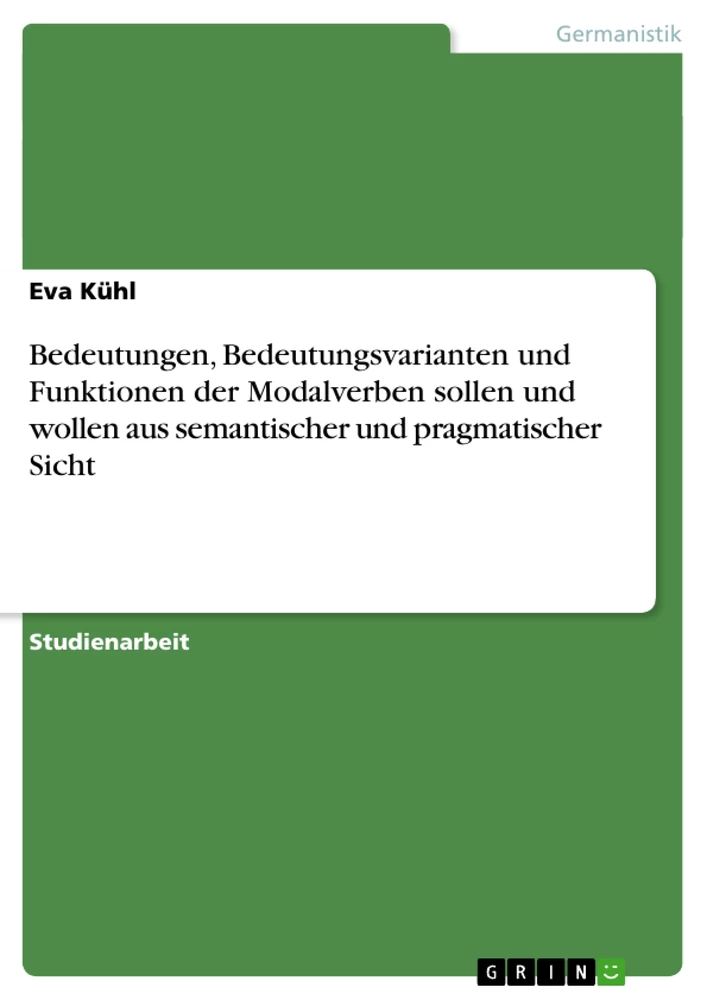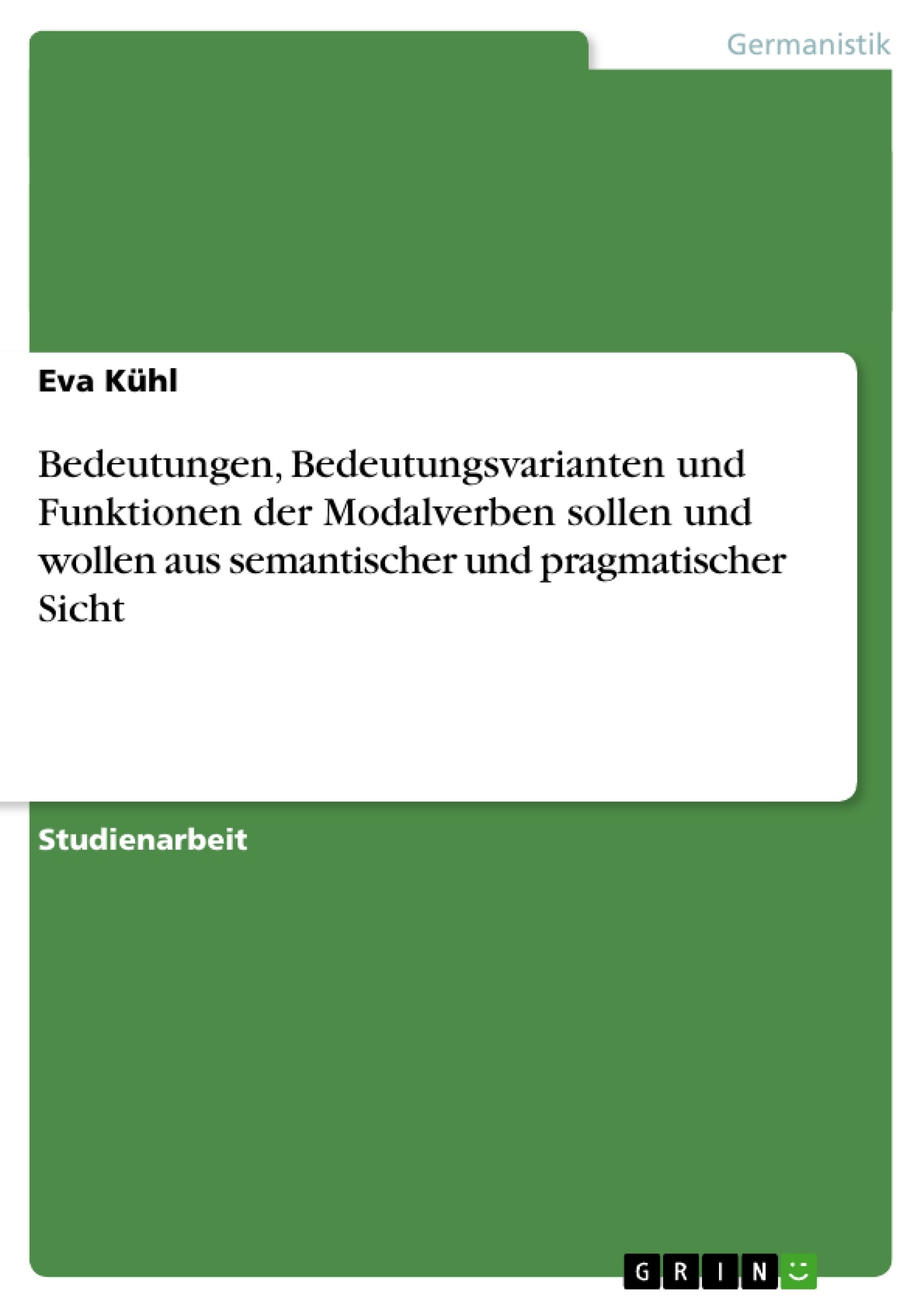Im Rahmen des Hauptseminars „Von Bedeutung“ möchte ich in der vorliegenden Arbeit die Modalverben sollen und wollen und ihre verschiedenen Bedeutungen bzw. Bedeutungsvarianten untersuchen. Dabei soll es nicht nur um semantische Unterschiede in den Verwendungsweisen gehen, sondern auch um die pragmatische Funktion der Modalverben im Bezug auf Sprechakte.
Zunächst werde ich einige Ansätze zur Klassifizierung verschiedener Lesarten vorstellen.
Anschließend folgt ein Überblick über die Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte der behandelten Modalverben sollen und wollen, in dem auch die Wahl für gerade diese beiden begründet wird. Außerdem wird hier der epistemische Gebrauch der Verben gemeinsam behandelt, da die Verwendung sich bei beiden sehr ähnlich ist.
Der größte Teil der Arbeit wird sich dann aus semantischer Sicht mit der Betrachtung der unterschiedlichen nicht-epistemischen Verwendungsweisen beschäftigen, zuerst derjenigen von sollen, anschließend der von wollen.
Schließlich werde ich noch auf die Frage eingehen, welche pragmatische Funktion Modalverben innerhalb von Sprechakten haben, genauer: ob sie die Illokution eines Sprechaktes beeinflussen oder verändern und ob sie als illokutionäre Indikatoren bezeichnet werden können.
Bevor die unterschiedlichen Bedeutungen bzw. Bedeutungsvarianten konkret an den beiden Modalverben sollen und wollen erläutert werden, möchte ich hier zunächst einige Kategorisierungen vorstellen, die die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, eine Äußerung und ihre aktuelle Bedeutung zu verstehen.
Die grundlegende Überlegung von Kratzer (1978) besagt, dass die Bedeutung eines Satzes aus der jeweiligen Äußerungssituation heraus verstanden werden kann (vgl. Kratzer 1978: 10 f). Am Beispiel von müssen erklärt sie, dass es eine Art isoliertes „Bedeutungsskelett“ des Modalverbs gibt, das bei jeder Äußerung unverändert bleibt und durch „im Hinblick auf“-Phrasen in seiner aktuellen Bedeutung spezifiziert wird. Da man solche Phrasen im normalen Gespräch jedoch nicht verwendet, muss die Äußerungssituation die Ergänzung oder Spezifizierung zum Bedeutungsskelett liefern (vgl. 1978: 104): „Modalwörter verlangen für ihre Interpretation in einer Situation einen Redehintergrund.“ (1978: 110). Der Redehintergrund liefert die Basis, auf welcher eine Äußerung verstanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lesarten von Modalverben
- 3. Verwendungsweisen und Bedeutungsvarianten von sollen und wollen
- 3.1. Gemeinsame Eigenschaften und Berührungspunkte
- 3.1.1. Epistemischer Gebrauch von sollen und wollen
- 3.2. Sollen
- 3.2.1. Sollen in Aussagen über eigenes und fremdes Wollen
- 3.2.2. Imperativ und sollen in der 2. Person
- 3.2.3. Weitere Spezifizierungen im Gebrauch von sollen
- 3.2.4. Zusammenfassung
- 3.3. Wollen
- 3.3.1. Zusammenfassung
- 4. Modalverben als illokutionäre Indikatoren
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Modalverben „sollen“ und „wollen“ in Bezug auf ihre semantischen Unterschiede und pragmatischen Funktionen im Kontext von Sprechakten. Die Analyse betrachtet verschiedene Lesarten und Bedeutungsvarianten der Verben, wobei der Fokus sowohl auf epistemischen als auch nicht-epistemischen Verwendungsweisen liegt. Die Arbeit beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modalverben und deren Rolle als potentielle illokutionäre Indikatoren.
- Semantische Analyse der Modalverben „sollen“ und „wollen“
- Untersuchung epistemischer und nicht-epistemischer Verwendungsweisen
- Klassifizierung verschiedener Lesarten und Bedeutungsvarianten
- Pragmatische Funktion der Modalverben in Sprechakten
- Beziehung zwischen Wollen und Sollen im Kontext von Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Modalverben „sollen“ und „wollen“ aus semantischer und pragmatischer Sicht. Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben, der die Vorstellung verschiedener Lesarten, die Analyse gemeinsamer Eigenschaften und Berührungspunkte der beiden Modalverben, sowie eine detaillierte Betrachtung der unterschiedlichen Verwendungsweisen von „sollen“ und „wollen“ umfasst. Schließlich wird die Rolle der Modalverben als illokutionäre Indikatoren thematisiert. Die Wahl der beiden Modalverben wird durch ihre häufige gemeinsame Behandlung in der Literatur und ihre enge semantische Verbindung begründet. Der Fokus liegt auf der Erforschung der komplexen Beziehungen zwischen Bedeutung, Verwendung und pragmatischer Funktion dieser zentralen Elemente deutscher Grammatik.
2. Lesarten von Modalverben: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Kategorisierung von Lesarten von Modalverben. Es werden die Theorien von Kratzer (1978) und Öhlschläger (1989) vorgestellt, welche die Bedeutung von Modalverben im Kontext der Äußerungssituation und den unterschiedlichen Interpretationen beleuchten. Kratzers Konzept des „Bedeutungsskeletts“ und die Rolle des „Redehintergrunds“ werden erklärt, sowie die Unterscheidung zwischen referentiellem und attributivem, epistemischem, deontischem, dispositionellem und buletischem Redehintergrund. Öhlschlägers Einteilung in epistemische und nicht-epistemische Verwendung wird diskutiert, wobei der Fokus auf der Primär- und Sekundärnatur der jeweiligen Lesarten liegt. Die Diskussion dieser Theorien legt den Grundstein für die anschließende Analyse der Modalverben „sollen“ und „wollen“ in ihren verschiedenen Verwendungsweisen.
3. Verwendungsweisen und Bedeutungsvarianten von sollen und wollen: Dieses Kapitel analysiert die Verwendungsweisen und Bedeutungsvarianten von "sollen" und "wollen". Es beginnt mit einer Erörterung der gemeinsamen Eigenschaften und Berührungspunkte der beiden Verben, beispielsweise der "interaktiven Qualität" ihrer Bedeutungen, in der ein Aktant etwas will, das ein anderer tun soll. Die Kapitel 3.2 und 3.3 untersuchen dann die jeweiligen Modalverben einzeln und detailliert, wobei auch die epistemischen und nicht-epistemischen Lesarten behandelt werden. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Darstellung der semantischen und pragmatischen Nuancen, um ein vollständiges Bild der Vielfältigkeit der Verwendungsweisen von "sollen" und "wollen" zu liefern.
Schlüsselwörter
Modalverben, sollen, wollen, Semantik, Pragmatik, Sprechakte, Lesarten, Bedeutungsvarianten, epistemischer Gebrauch, deontischer Gebrauch, illokutionäre Indikatoren, Redehintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Semantische und Pragmatische Analyse der Modalverben „sollen“ und „wollen“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Modalverben „sollen“ und „wollen“ in Bezug auf ihre semantischen Unterschiede und pragmatischen Funktionen im Kontext von Sprechakten. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Lesarten und Bedeutungsvarianten, sowohl epistemischer als auch nicht-epistemischer Verwendungsweisen, sowie der Rolle der Verben als potentielle illokutionäre Indikatoren. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modalverben und ihre Beziehung im Kontext von Interaktion werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine semantische Analyse der Modalverben „sollen“ und „wollen“, die Untersuchung epistemischer und nicht-epistemischer Verwendungsweisen, die Klassifizierung verschiedener Lesarten und Bedeutungsvarianten, die pragmatische Funktion der Modalverben in Sprechakten und die Beziehung zwischen Wollen und Sollen im Kontext von Interaktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Lesarten von Modalverben) präsentiert verschiedene Ansätze zur Kategorisierung von Lesarten, basierend auf Theorien von Kratzer und Öhlschläger. Kapitel 3 (Verwendungsweisen und Bedeutungsvarianten von sollen und wollen) analysiert die Verwendungsweisen und Bedeutungsvarianten beider Verben, inklusive einer detaillierten Betrachtung epistemischer und nicht-epistemischer Lesarten. Kapitel 4 (Modalverben als illokutionäre Indikatoren) untersucht die Funktion der Modalverben in diesem Kontext. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Theorien werden zur Analyse verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Kratzer (1978) und Öhlschläger (1989) zur Kategorisierung von Modalverben. Kratzers Konzept des „Bedeutungsskeletts“ und des „Redehintergrunds“ sowie Öhlschlägers Einteilung in epistemische und nicht-epistemische Verwendung werden diskutiert und angewendet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Modalverben, sollen, wollen, Semantik, Pragmatik, Sprechakte, Lesarten, Bedeutungsvarianten, epistemischer Gebrauch, deontischer Gebrauch, illokutionäre Indikatoren, Redehintergrund.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau beschreibt. Es folgt die Darstellung verschiedener Lesarten von Modalverben, gefolgt von einer detaillierten Analyse der Modalverben „sollen“ und „wollen“ in ihren verschiedenen Verwendungsweisen. Die Rolle der Modalverben als illokutionäre Indikatoren wird ebenfalls untersucht, bevor die Arbeit mit einem Fazit abschließt. Die Arbeit nutzt eine systematische Struktur mit Unterkapiteln für eine klare und übersichtliche Darstellung des Themas.
- Arbeit zitieren
- Eva Kühl (Autor:in), 2007, Bedeutungen, Bedeutungsvarianten und Funktionen der Modalverben sollen und wollen aus semantischer und pragmatischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89366