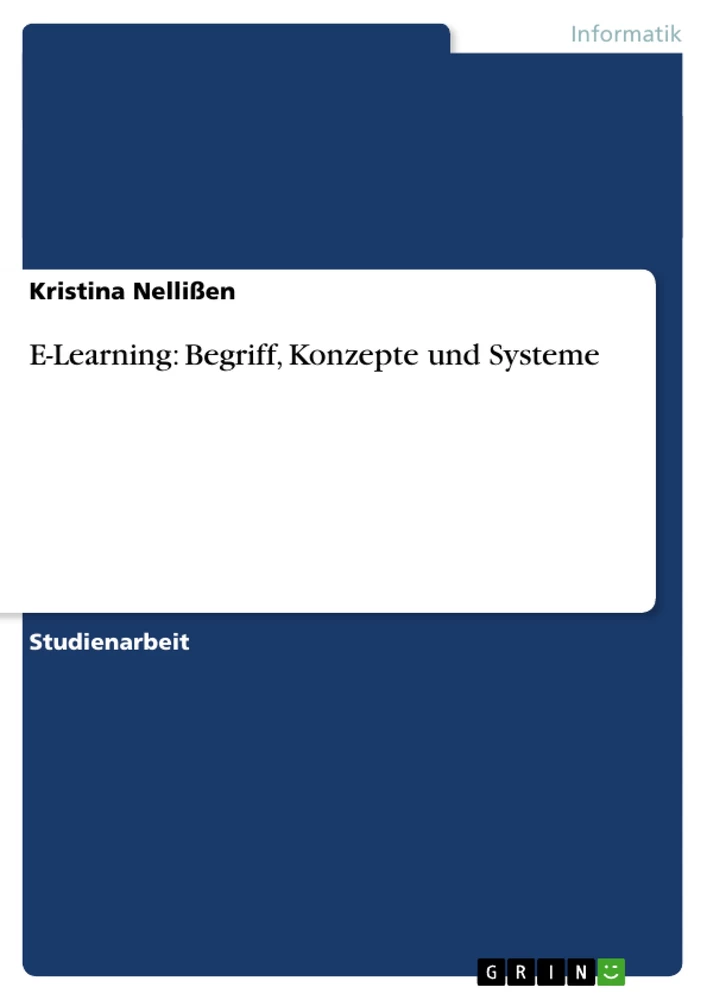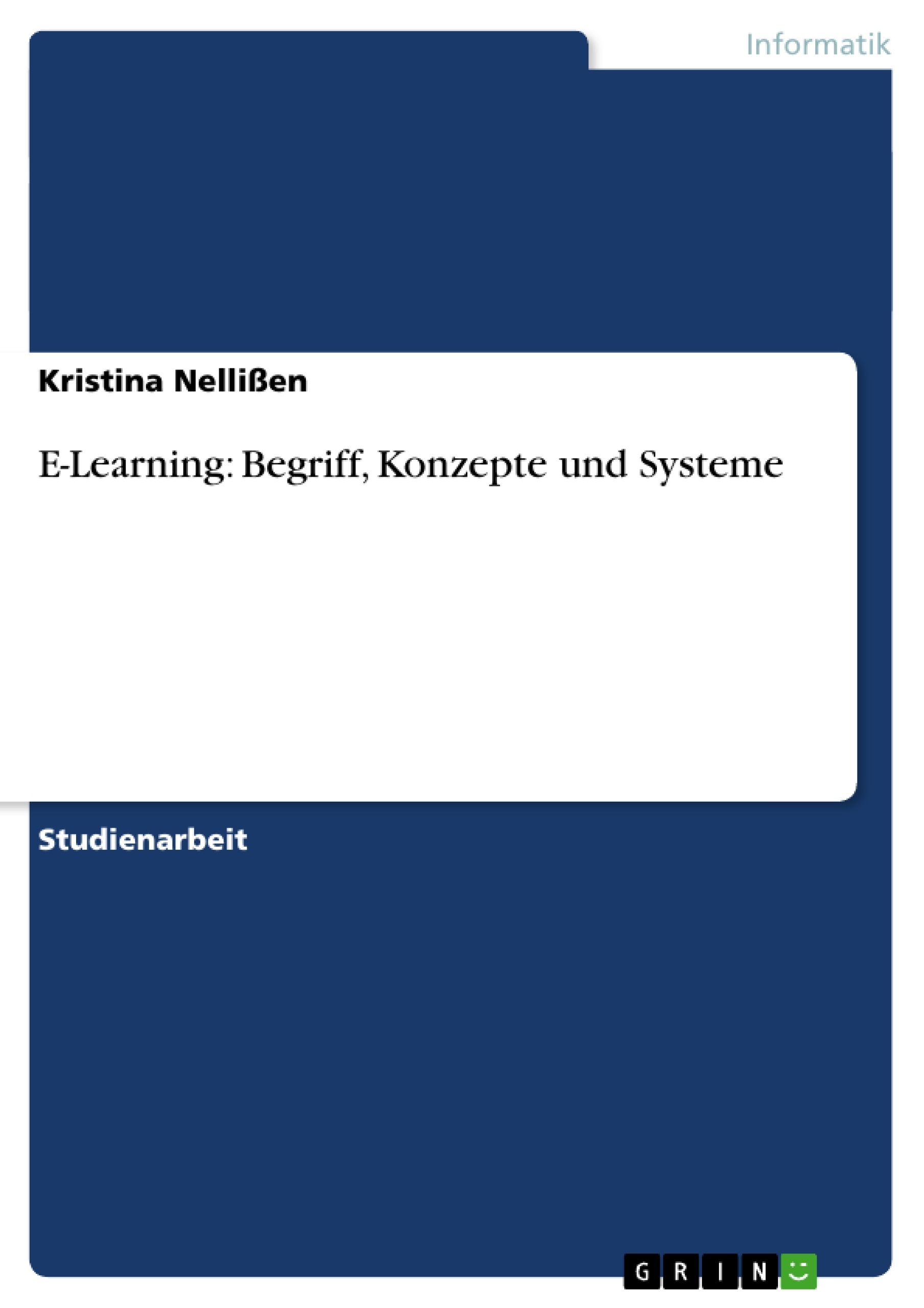Diese Arbeit dient zunächst einer kurzen Begriffsdiskussion der E-Education.
Hiernach wird auf die beiden gängigsten Technologien -das Computer Based Training und das Web Based Training- im Bereich des E-Learning eingegangen. Nachfolgend werden verschiedene didaktische Aspekte dargelegt. Die klassischen Lernparadigmen des Behaviorismus, des Kognitivismus und des Konstruktivismus werden erläutert, bevor die Frage diskutiert wird, ob diese Lernparadigmen für die didaktischen Ansprüche des E-Learning ausreichen oder eine eigne E-Learningdidaktik erforderlich ist. Anschließend erfolgt eine Erörterung zunächst der Potentiale und weiterhin möglicher Problemfelder des E-Learning.
Grundlegende Aufgabe der folgenden Seminararbeit ist es, verschiedene E-Learningsysteme darzustellen und zu diskutieren. Wobei zunächst auf die Anforderungen an E-Learningsysteme eingegangen wird, bevor Learning Management Systeme, Autorensysteme und Content Management Systeme vorgestellt werden. Abschließend soll ein Praxisbeispiel, der Veranschaulichung dieser theoretischen Diskussion dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 E-Education
- 1.2 Technologien
- 2 Didaktik
- 2.1 Behaviorismus
- 2.2 Kognitivismus
- 2.3 Konstruktivismus
- 2.4 Instruktionismus vs. Konstruktivismus
- 2.5 Resümee
- 3 Potentiale des E-Learning
- 4 Problemfelder des E-Learning
- 4.1 Standardisierung
- 4.2 Interoperabilität
- 4.3 Motivation
- 5 E-Learningsysteme
- 5.1 Anforderungen an E-Learningsysteme
- 5.1.1 Präsentation
- 5.1.2 Erstellung
- 5.1.3 Kommunikation
- 5.1.4 Administration
- 5.1.5 Evaluation
- 5.2 Learning Management System (LMS)
- 5.2.1 Moodle
- 5.2.2 ILIAS
- 5.3 Autorensysteme
- 5.3.1 ToolBook
- 5.3.2 Macromedia Director
- 5.4 Content Management System (CMS)
- 5.4.1 Learning Content Management System (LCMS)
- 6 Praxisbeispiel
- 6.1 BASF Weiterbildung
- 6.2 Learnbase
- 6.3 Evaluation mittels Perion
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht E-Learning, seine Konzepte und Systeme. Die Arbeit zielt darauf ab, den Begriff E-Learning zu definieren, gängige Technologien zu beschreiben und verschiedene didaktische Ansätze zu beleuchten. Weiterhin werden Potentiale und Problemfelder von E-Learning erörtert und verschiedene E-Learningsysteme vorgestellt.
- Definition und Abgrenzung von E-Learning
- Vergleich verschiedener didaktischer Modelle im Kontext von E-Learning
- Analyse der Potentiale und Herausforderungen von E-Learning
- Vorstellung verschiedener E-Learningsysteme (LMS, Autorensysteme, CMS)
- Praxisbeispiel zur Anwendung von E-Learning in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Stand des E-Learning Marktes dar und skizziert die zukünftige Entwicklung. Es werden die vielfältigen Einsatzgebiete von E-Learning angesprochen und die Struktur der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf dem Einsatz von E-Learning in Unternehmen, wobei die gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere Bereiche übertragbar sind.
1.1 E-Education: Dieses Kapitel definiert den Begriff E-Education und E-Learning, wobei eine breite Definition gewählt wird, um zukünftige Entwicklungen einzuschließen. Verschiedene Lernformen wie Blended Learning und Distant Learning werden im Kontext von E-Learning erklärt und durch eine Abbildung veranschaulicht. Der Begriff E-Learning wird dabei umfassend erklärt und verschiedene Formen des Lernens eingeordnet.
1.2 Technologien: Dieses Kapitel befasst sich mit den Technologien hinter E-Learning. Es werden Computer Based Training (CBT) und Web Based Training (WBT) als zwei Haupttechnologien vorgestellt, ohne jedoch Details zu einzelnen Systemen zu liefern.
2 Didaktik: Dieses Kapitel beleuchtet die didaktischen Aspekte von E-Learning. Es werden die klassischen Lernparadigmen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus erläutert und miteinander verglichen. Der Vergleich Instruktionismus vs. Konstruktivismus bildet einen zentralen Bestandteil und diskutiert die Eignung der Paradigmen für E-Learning.
3 Potentiale des E-Learning: Dieses Kapitel soll die positiven Aspekte des E-Learning darstellen, wobei jedoch keine konkreten Beispiele genannt werden.
4 Problemfelder des E-Learning: In diesem Kapitel werden die Herausforderungen von E-Learning thematisiert. Standardisierung, Interoperabilität und Motivationsaspekte werden als zentrale Problemfelder identifiziert.
5 E-Learningsysteme: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über verschiedene E-Learningsysteme. Es werden die Anforderungen an solche Systeme dargelegt und Learning Management Systeme (LMS), Autorensysteme und Content Management Systeme (CMS) – inklusive Unterkategorien – detailliert vorgestellt. Das Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Systeme und deren Funktionen.
6 Praxisbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel, welches das E-Learning Konzept der Firma BASF und Learnbase zeigt und diese theoretischen Diskussionen veranschaulicht. Es werden konkrete Beispiele zur Anwendung von E-Learning in einem Unternehmen gegeben, einschließlich einer Evaluation mittels Perion. Die Beispiele sollen die vorherigen Kapitel veranschaulichen.
Schlüsselwörter
E-Learning, E-Education, Blended Learning, Distant Learning, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, Instruktionismus, E-Learningsysteme, Learning Management System (LMS), Autorensysteme, Content Management System (CMS), Standardisierung, Interoperabilität, Motivation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "E-Learning: Konzepte und Systeme"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit E-Learning, seinen Konzepten und Systemen. Sie definiert E-Learning, beschreibt gängige Technologien, beleuchtet verschiedene didaktische Ansätze, erörtert Potentiale und Problemfelder und stellt verschiedene E-Learningsysteme vor. Ein Praxisbeispiel aus der BASF veranschaulicht die Anwendung im Unternehmenskontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von E-Learning, Vergleich verschiedener didaktischer Modelle (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) im Kontext von E-Learning, Analyse der Potentiale und Herausforderungen von E-Learning, Vorstellung verschiedener E-Learningsysteme (LMS, Autorensysteme, CMS), sowie ein Praxisbeispiel zur Anwendung von E-Learning in Unternehmen.
Welche didaktischen Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die klassischen Lernparadigmen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus im Kontext von E-Learning. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich von Instruktionismus und Konstruktivismus und deren Eignung für E-Learning.
Welche E-Learningsysteme werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene E-Learningsysteme vor, darunter Learning Management Systeme (LMS) wie Moodle und ILIAS, Autorensysteme wie ToolBook und Macromedia Director, sowie Content Management Systeme (CMS) und Learning Content Management Systeme (LCMS). Die Anforderungen an solche Systeme werden detailliert dargelegt.
Welche Potentiale und Problemfelder von E-Learning werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt die Potentiale von E-Learning, ohne konkrete Beispiele zu nennen. Als zentrale Problemfelder werden Standardisierung, Interoperabilität und Motivationsaspekte identifiziert.
Wie wird die Anwendung von E-Learning in der Praxis veranschaulicht?
Ein Praxisbeispiel aus der BASF Weiterbildung, Learnbase und die Evaluation mittels Perion veranschaulichen die Anwendung von E-Learning in einem Unternehmenskontext. Diese Beispiele sollen die theoretischen Diskussionen der vorherigen Kapitel veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Learning, E-Education, Blended Learning, Distant Learning, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, Instruktionismus, E-Learningsysteme, Learning Management System (LMS), Autorensysteme, Content Management System (CMS), Standardisierung, Interoperabilität, Motivation.
Was ist der Unterschied zwischen E-Learning und E-Education?
Die Arbeit definiert beide Begriffe, wobei eine breite Definition von E-Learning gewählt wird, um zukünftige Entwicklungen einzuschließen. Verschiedene Lernformen wie Blended Learning und Distant Learning werden im Kontext von E-Learning erklärt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand des E-Learning Marktes darstellt und die Struktur der Arbeit erläutert. Es folgen Kapitel zu E-Education, Technologien, Didaktik, Potentialen und Problemfeldern des E-Learning, E-Learningsystemen und einem Praxisbeispiel. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
- Quote paper
- Kristina Nellißen (Author), 2007, E-Learning: Begriff, Konzepte und Systeme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89319