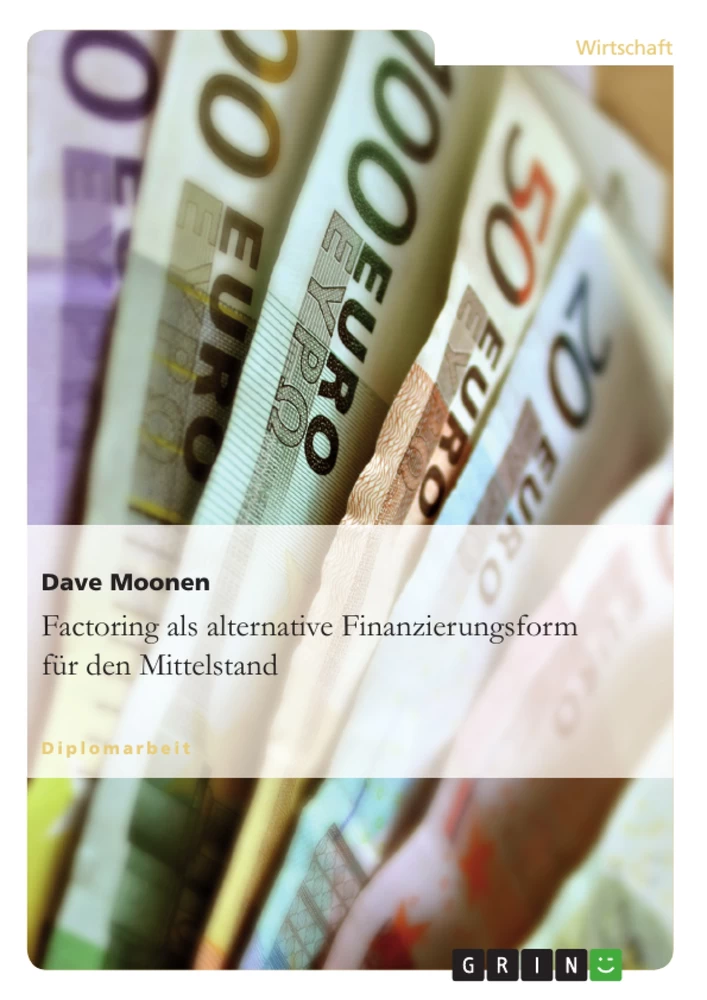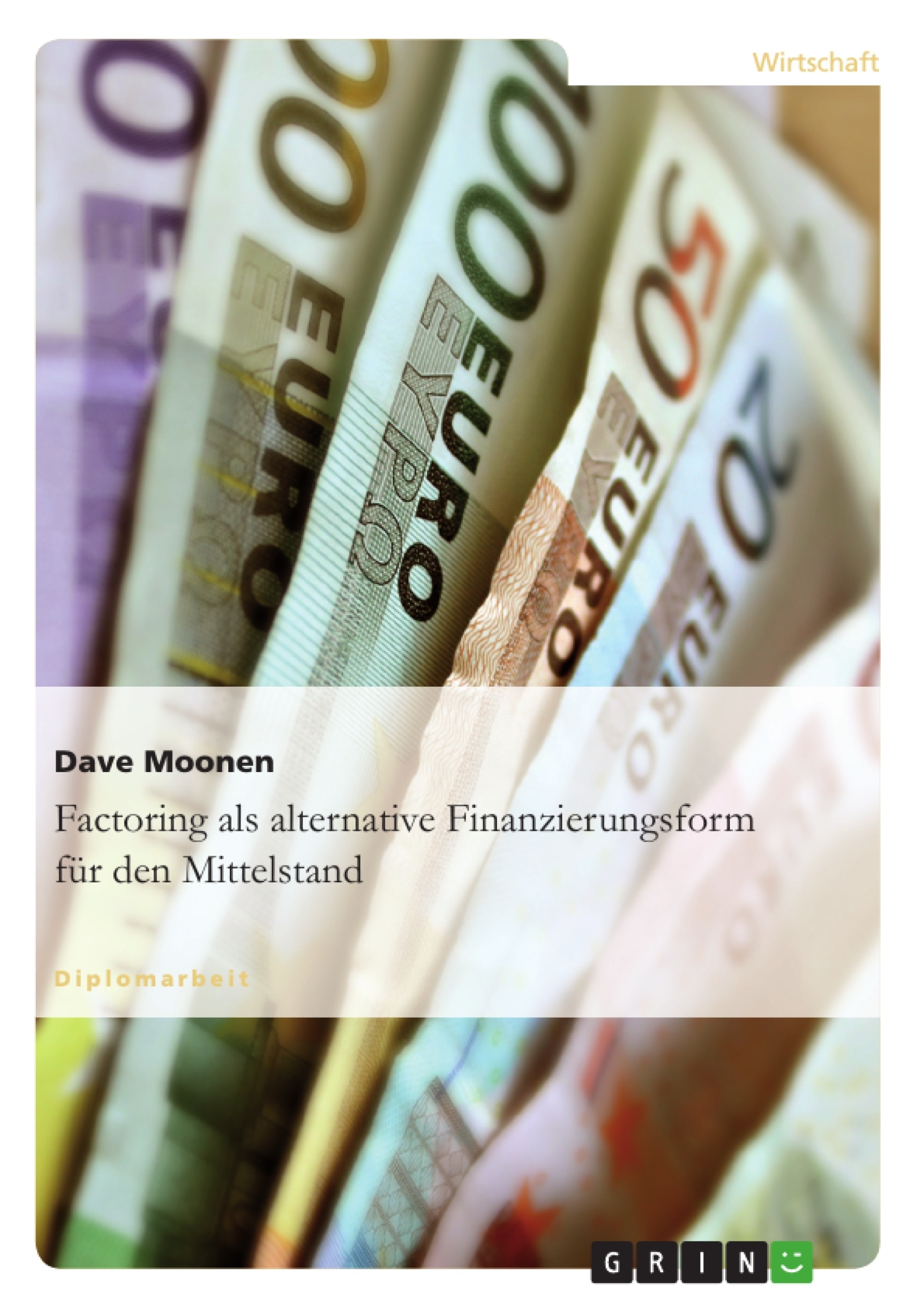In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs bis in die Mitte der 90iger Jahre war es für mittelständische Unternehmen in Deutschland unproblematisch, ihre Betriebsmittelfinanzierung mit Bankkrediten zu realisieren. Das Angebot an Kreditmitteln übertraf die Nachfrage bei den Unternehmen. In der zweiten Hälfte der 90iger Jahre änderte sich der Markt.
Der deutsche Kreditmarkt befand sich im internationalen Vergleich in der Krise, welche einen umfassenden Veränderungsprozess auslöste. Die Banken stellten ihr Firmenkundengeschäft in Frage und wurden durch die die neuen internationalen Richtlinien zur Eigenkapitalhinterlegung bei Bankkrediten (Basel II) dazu gezwungen, ihr gesamtes Kreditportfolio auf den Prüfstand zu stellen. Als Entscheidungsmittel für die Kreditvergabe wurden genaue Bonitätsbeurteilungsverfahren (Rating) eingeführt, und die Einheitszinsen bei den Kreditkonditionen durch risikoabhängige Zinsen ersetzt.
Mittelständische Unternehmen, deren Finanzierung klassischerweise fast ausschließlich bankenorientiert war, sind seitdem besonders von der restriktiveren Kreditvergabepolitik der Banken betroffen.
Oftmals können die Unternehmen die neuen Kriterien bei der Kreditvergabe nicht erfüllen, wodurch der Kreditzugang erschwert, verteuert und teilweise verhindert wird. Auch die anderen Formen der klassischen Mittelstandsfinanzierung, die Eigenfinanzierung und der Lieferantenkredit, können oftmals nur begrenzt zur Finanzierung eingesetzt werden. Immer mehr mittelständische Unternehmen sehen sich dadurch gezwungen, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Eine dieser alternativen Finanzierungsformen, die seit Jahren kontinuierlich wächst, ist das Factoring.
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob das Factoring als Finanzierungsform von mittelständischen Unternehmen als Alternative zur klassischen Mittelstandsfinanzierung genutzt werden kann. Da Factoring neben der Finanzierungsfunktion auch andere Komponenten beinhaltet, wird des Weiteren untersucht, welche zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten sich aus diesen Komponenten für ein mittelständisches Unternehmen ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- Der Mittelstand in Deutschland
- Bedeutung des Mittelstands
- Klassische Formen der Mittelstandsfinanzierung
- Grundlagen des Factorings
- Definition des Factorings
- Funktionen des Factorings
- Finanzierung
- Versicherung
- Service
- Factoringarten
- Echtes und unechtes Factoring
- Offenes und stilles Factoring
- Inhouse-Factoring
- Fälligkeits-Factoring
- Export- und Import-Factoring
- Aktuelle Entwicklungen
- Reverse Factoring
- Privatkunden-Factoring
- Ablauf des Factoring-Verfahrens
- Der Factoringmarkt in Deutschland
- Anwendungsbereiche für Factoring im Mittelstand
- Abgrenzung des Factorings zur klassischen Mittelstandsfinanzierung
- Potentiale und Auswirkungen des Factorings
- Factoring als Finanzierungsinstrument
- Weitere Komponenten des Factorings
- Risikomanagement
- Debitorenmanagement
- Bilanzielle Auswirkungen
- Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen des Factorings
- Factoring als Finanzierungs- und Sicherungsinstrument im Außenhandel
- Grenzen des Factorings
- Die Forderungen des Unternehmens
- Abtretbarkeit der Forderungen
- Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit des Unternehmens
- Unternehmensgröße und -struktur
- Branche und Produkt
- Definition und Funktionsweise des Factorings
- Arten des Factorings und ihre Anwendungsmöglichkeiten
- Vorteile und Nachteile des Factorings für Unternehmen
- Der Factoringmarkt in Deutschland
- Die Bedeutung des Factorings als Finanzierungsinstrument für den Mittelstand
- Das erste Kapitel widmet sich der Bedeutung des Mittelstands in Deutschland. Hier werden verschiedene Definitionsmerkmale des Mittelstands sowie dessen Rolle in der deutschen Wirtschaft beleuchtet.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Factorings. Es werden die Definition, die Funktionen und die verschiedenen Arten des Factorings erläutert. Der Fokus liegt hierbei auf den Möglichkeiten, die Factoring für Mittelständler bietet.
- Im dritten Kapitel werden verschiedene Anwendungsbereiche des Factorings im Mittelstand untersucht. Dabei werden die Unterschiede zum klassischen Bankkredit aufgezeigt, die potentiellen Auswirkungen des Factorings auf die Unternehmensbilanz beleuchtet und die Kosten und Nutzen des Factorings miteinander verglichen.
- Das vierte Kapitel behandelt die Grenzen des Factorings. Hier werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die die Nutzung des Factorings für Unternehmen einschränken können, wie zum Beispiel die Abtretbarkeit der Forderungen und die Kreditfähigkeit des Unternehmens.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Factoring als alternative Finanzierungsform für den Mittelstand. Ziel ist es, die Funktionsweise des Factorings zu erläutern, seine Vor- und Nachteile aufzuzeigen und die Bedeutung dieser Finanzierungsform für den Mittelstand zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Factoring, Mittelstand, Finanzierung, Finanzierungsformen, Bankkredit, Liquidität, Debitorenmanagement, Risikomanagement, Abtretbarkeit, Kreditwürdigkeit, Unternehmen, Branche, Deutschland
- Quote paper
- Dave Moonen (Author), 2007, Factoring als alternative Finanzierungsform für den Mittelstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89313