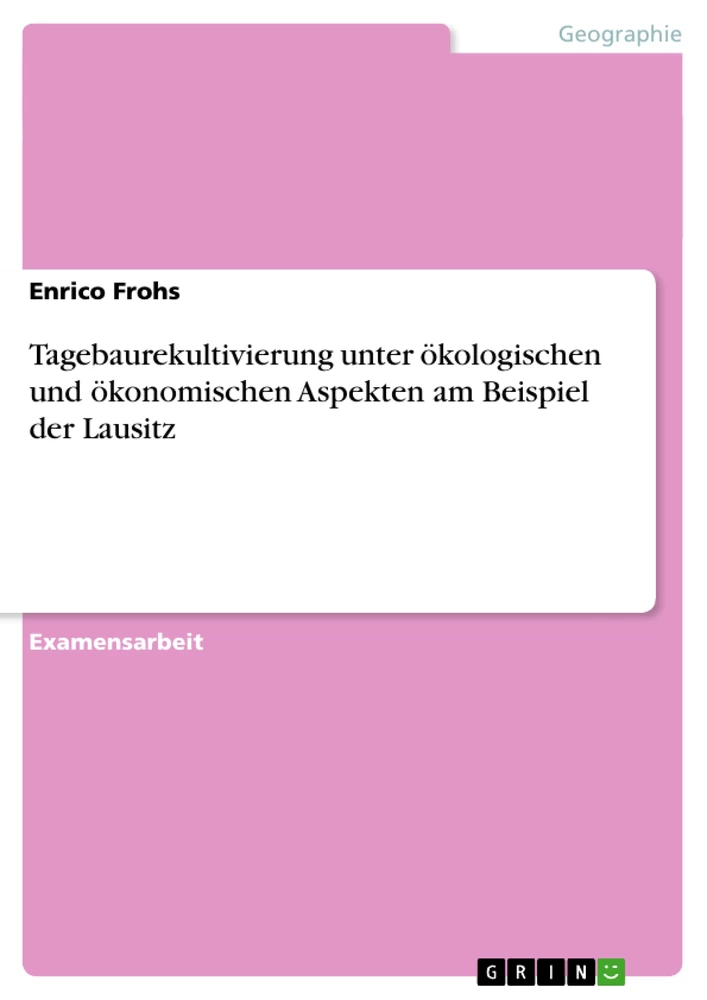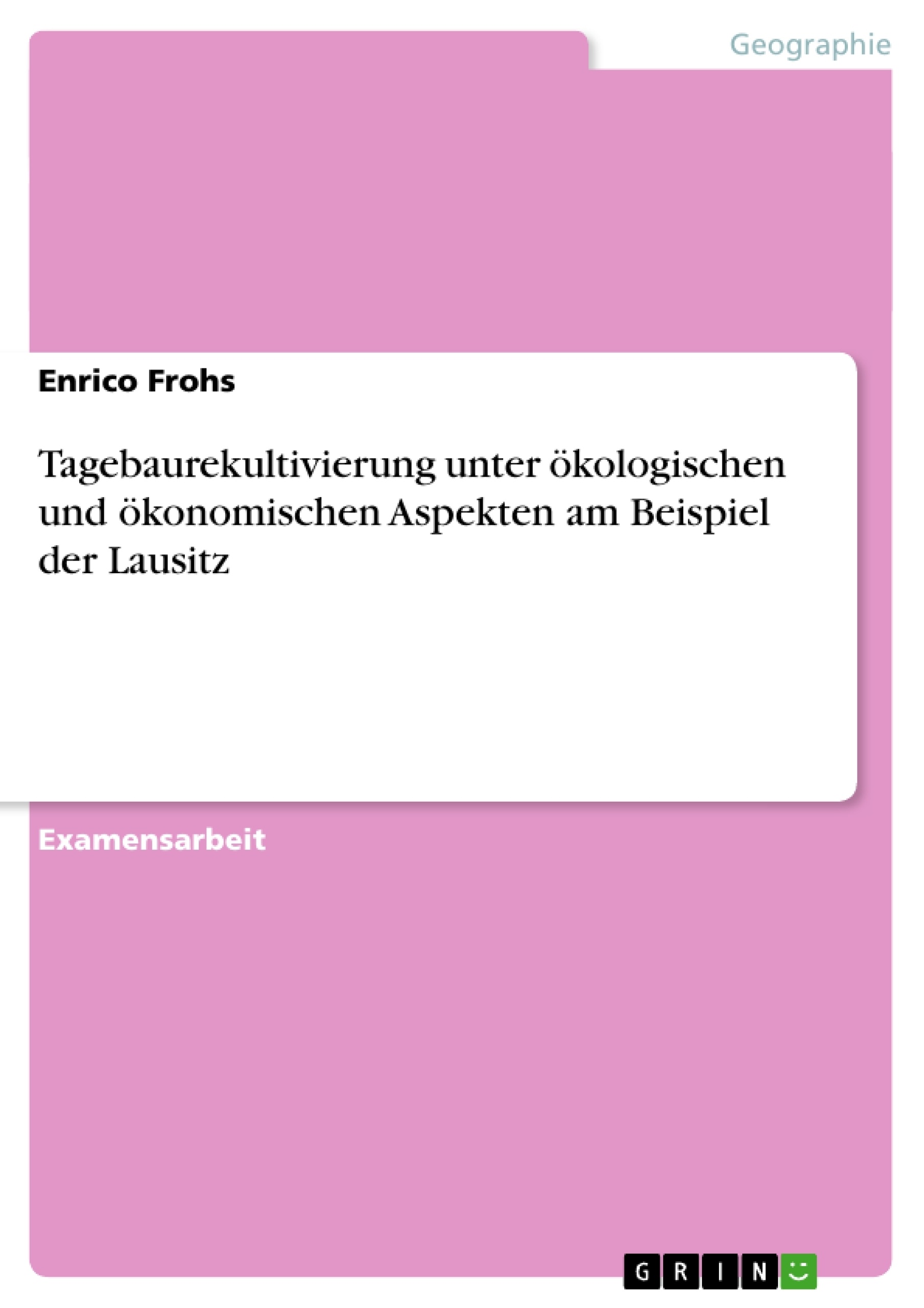„Die Lausitz, das ist die Region beiderseits von Oder und Neiße zwischen der Grenze zu Tschechien und Frankfurt/ Oder, benannt nach dem slawischen Strang der Lusici (Lausitzer), der im 7. Jh. den Raum östlich der Elbe besiedelte“ und sinngemäß Sumpfland bedeutet.
Das Lausitzer Revier zählt als Wirtschaftsregion, die „über 13 Mrd. Tonnen förderfähiger Braunkohle im Tiefland“ besitzt. Seit Beginn des Abbaus ist Braunkohle, auch Schwarzes Gold genannt, ein wichtiger Rohstoff zur Energiegewinnung, der gebraucht und vielseitig genutzt wird. Der Braunkohlebergbau ist ein wichtiges Kapitel der Lausitzer Heimatgeschichte. Früher haben hier tausende ihr tägliches Brot verdient und es geschafft, dass die Lausitz einen Rang als Industriegebiet erreicht hatte. Nicht außer Acht zulassen sind die Folgen des Bergbaus. Die Umsiedlungen der Dörfer, die Umweltbelastung und die Zerstörung der Natur. Quadratkilometerlange Landschaften wurden innerhalb weniger Jahre total umgestaltet. In der Lausitz glichen Tagebaugebiete Mondlandschaften, riesige Flächen wurden bearbeitet, um später wieder rekultiviert zu werden. Ohne menschliches Zutun blieben dort teilweise vegetationsfeindliche, unzugängliche, Wüstenlandschaften ähnliche Gebiete zurück.
Der Tagebau wird immer eine Debatte mit sich führen und solange auch noch künftig Tagebaue, Kraftwerke und andere Industrieanlagen existieren, wird sich die Situation der Landschaftszerstörung nicht ändern. Mit der Rekultivierung gilt es abgebaute Flächen wiederherzustellen und nutzbar zu machen.
Doch wie sah es früher in der Lausitz aus, in wie weit beeinflusste die Braunkohle das Leben der Menschen dort und welche Bedeutung hat die Braunkohle heute?
Wie verlief die Rekultivierung in der Vergangenheit und wie weit ist sie gekommen?
Ist das geplante Konzept für die Rekultivierung in der Lage die Landschaft wieder herzustellen? Wie gestaltet sich die Rekultivierung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten?
Der größte Teil der Braunkohle stammt aus dem Tertiär, der Braunkohlezeit, und ist zwischen 10 und 65 Mill. Jahre alt.
Torfmoore, Sumpf- und Bruchwälder mit Pflanzenmassen und einer reichen Tierwelt beherrschten damals das Braunkohlegebiet. Mammutbäume, Sumpfzypressen, Wasserlilien, Farne, Stechpalmen- oder Magnoliengewächse sind die Pflanzen, die ein abwechslungsreiches Bild boten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung der Braunkohle
- 3. Chronologische Übersicht über den Ablauf des Bergbaus und der Förderung in der Lausitz
- 4. Die Folgen des Tagebaus für Natur und Mensch
- 4.1. Das Wasser
- 4.2. Die Kippen
- 4.3. Die Kohleveredlung in der DDR
- 4.4. Die Umsiedlungen
- 5. Rekultivierung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
- 5.1. Definition und Betrachtungsweisen des Begriffs Rekultivierung
- 5.2. Entwicklung der Rekultivierung von 1900 – über die DDR – bis heute
- 5.3. Die Kostenplanung für die Rekultivierung
- 5.4. Die Gesetze für die Rekultivierung
- 5.5. Neuer Bergbau – Neue Technik und Neue Landschaft – Neue Pläne
- 5.5.1. Wasser
- 5.5.2. Emissionen und Immissionen
- 5.5.3. Das Deponieren von Asche und Gips
- 5.5.4. Halden
- 5.5.5. Ufergestaltung
- 5.5.6. Straßen und Wege
- 5.5.7. Biotopgestaltung
- 6. Einblicke in die Lausitz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Tagebaurekultivierung in der Lausitz unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung des Braunkohlebergbaus und seine Folgen für Natur und Mensch zu analysieren und die Rekultivierungsmaßnahmen im Kontext ihrer wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu bewerten.
- Historische Entwicklung des Braunkohlebergbaus in der Lausitz
- Ökologische Folgen des Tagebaus (Wasserhaushalt, Kippen, Emissionen)
- Sozioökonomische Auswirkungen des Bergbaus (Umsiedlungen, Arbeitsplätze)
- Entwicklung und Umsetzung von Rekultivierungskonzepten
- Ökonomische und ökologische Aspekte der Rekultivierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Tagebaurekultivierung in der Lausitz ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie beschreibt die Lausitz als Wirtschaftsregion mit großen Braunkohlevorkommen und hebt die Bedeutung des Bergbaus für die regionale Geschichte hervor. Gleichzeitig werden die negativen Folgen des Bergbaus, wie Umsiedlungen und Umweltzerstörungen, angesprochen. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Bergbaus, seine Auswirkungen und die Bemühungen um Rekultivierung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten.
2. Entstehung der Braunkohle: Dieses Kapitel befasst sich mit der geologischen Entstehung der Braunkohle in der Lausitz. Es erläutert den Entstehungsprozess aus pflanzlichen Materialien unter Luftabschluss und beschreibt die verschiedenen Braunkohlearten. Die besondere geologische Struktur des Muskauer Faltenbogens, entstanden durch glaziale Prozesse, wird als Einflussfaktor für die Ablagerung der Braunkohleflöze erklärt. Das Kapitel liefert somit das geologische Fundament für das Verständnis der Braunkohlevorkommen in der Region.
3. Chronologische Übersicht über den Ablauf des Bergbaus und der Förderung in der Lausitz: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte chronologische Darstellung der Entwicklung des Braunkohlebergbaus in der Lausitz, beginnend mit den ersten Funden bis zur Wende. Es beschreibt die technischen Innovationen im Bergbau (von Handabbau zu Großgeräten), die Entwicklung der Infrastruktur (Eisenbahn, Kraftwerke), und die soziale Entwicklung der Bergarbeitersiedlungen. Die Auswirkungen von Kriegen und politischen Systemen auf den Bergbau und seine Entwicklung werden ebenfalls thematisiert. Die Kapitel zeigt den Wandel von traditionellen Methoden hin zu industriellem Großabbau.
4. Die Folgen des Tagebaus für Natur und Mensch: Dieses Kapitel analysiert die umfassenden Folgen des Tagebaus in der Lausitz, sowohl für die Umwelt als auch für die Bevölkerung. Es beleuchtet die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Grundwasserabsenkung, Flussverläufe), die Entstehung von Kippen und ihre damit verbundenen Risiken (Rutschungen), die Umweltbelastung durch Emissionen der Kohleveredlung und die Notwendigkeit von Umsiedlungen aufgrund des fortschreitenden Abbaus. Das Kapitel stellt die verschiedenen negativen Folgen des Bergbaus gegenüber, insbesondere im Kontext der DDR-Zeit.
5. Rekultivierung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Rekultivierungsmaßnahmen in der Lausitz. Es definiert den Begriff Rekultivierung und stellt verschiedene Betrachtungsweisen und Zielsetzungen gegenüber. Die historische Entwicklung der Rekultivierung von den Anfängen bis zur Gegenwart wird detailliert dargestellt, inklusive der Rolle von Rudolf Heusohn und seinen Mischwaldkonzepten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Kostenplanung und die technischen Verfahren der Rekultivierung, werden im Detail beschrieben und analysiert. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen und die Entwicklung von der einfachen Wiederherstellung zur komplexen, ökologisch orientierten Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft.
6. Einblicke in die Lausitz: Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf die gegenwärtige Situation in der Lausitz und die erfolgreiche Transformation der Bergbaufolgelandschaft. Es beschreibt verschiedene Projekte und Initiativen, welche die Region attraktiv gestalten und dem Tourismus dienen, z.B. die Entstehung des Lausitzer Seenlandes, verschiedene Museen und touristische Angebote. Es wird ein Bild der Lausitz vermittelt, das zeigt, wie sich die Region durch innovative Ideen und Investitionen weiterentwickelt.
Schlüsselwörter
Tagebaurekultivierung, Lausitz, Braunkohlebergbau, ökologische Folgen, ökonomische Aspekte, Rekultivierung, Renaturierung, Wasserhaushalt, Kippen, Emissionen, Immissionen, Umsiedlungen, Landschaftsgestaltung, Naturschutz, DDR, Wiedernutzbarmachung, Sanierung, Bergbaufolgelandschaft, Seenland, Tourismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Tagebaurekultivierung in der Lausitz
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Tagebaurekultivierung in der Lausitz unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Sie analysiert die historische Entwicklung des Braunkohlebergbaus, seine Folgen für Natur und Mensch und bewertet die Rekultivierungsmaßnahmen in Bezug auf wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung des Braunkohlebergbaus in der Lausitz, die ökologischen Folgen des Tagebaus (Wasserhaushalt, Kippen, Emissionen), sozioökonomische Auswirkungen (Umsiedlungen, Arbeitsplätze), die Entwicklung und Umsetzung von Rekultivierungskonzepten sowie die ökonomischen und ökologischen Aspekte der Rekultivierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Entstehung der Braunkohle, Chronologische Übersicht über den Bergbau in der Lausitz, Folgen des Tagebaus für Natur und Mensch, Rekultivierung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten und Einblicke in die Lausitz. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Kapitel?
Kapitel 1 führt in das Thema ein. Kapitel 2 erklärt die geologische Entstehung der Braunkohle. Kapitel 3 bietet eine chronologische Darstellung des Bergbaus. Kapitel 4 analysiert die negativen Folgen für Natur und Mensch. Kapitel 5 befasst sich detailliert mit der Rekultivierung, ihren Kosten, Gesetzen und Verfahren. Kapitel 6 gibt einen Ausblick auf die heutige Lausitz und ihre Transformation.
Welche ökologischen Folgen des Tagebaus werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Tagebaus auf den Wasserhaushalt (Grundwasserabsenkung, Flussverläufe), die Entstehung von Kippen und deren Risiken (Rutschungen) sowie die Umweltbelastung durch Emissionen der Kohleveredlung.
Welche sozioökonomischen Folgen werden betrachtet?
Die sozioökonomischen Folgen umfassen die Notwendigkeit von Umsiedlungen aufgrund des fortschreitenden Abbaus und die Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der Region.
Welche Aspekte der Rekultivierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und verschiedene Betrachtungsweisen von Rekultivierung, die historische Entwicklung der Rekultivierung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Kostenplanung und die technischen Verfahren. Es wird auch die Entwicklung von einfachen Wiederherstellungsmaßnahmen hin zu komplexen, ökologisch orientierten Gestaltungskonzepten beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Tagebaurekultivierung, Lausitz, Braunkohlebergbau, ökologische Folgen, ökonomische Aspekte, Rekultivierung, Renaturierung, Wasserhaushalt, Kippen, Emissionen, Immissionen, Umsiedlungen, Landschaftsgestaltung, Naturschutz, DDR, Wiedernutzbarmachung, Sanierung, Bergbaufolgelandschaft, Seenland, Tourismus.
Welche Rolle spielt die DDR in der Arbeit?
Die Arbeit berücksichtigt die Rolle der DDR im Kontext des Braunkohlebergbaus und der Rekultivierung. Sie analysiert die Auswirkungen des politischen Systems und der damaligen Technologien auf den Bergbau und die Umwelt.
Wie wird die heutige Situation in der Lausitz dargestellt?
Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf die heutige Situation und die erfolgreiche Transformation der Bergbaufolgelandschaft. Es beschreibt Projekte und Initiativen, die die Region attraktiv gestalten und dem Tourismus dienen, wie z.B. die Entstehung des Lausitzer Seenlandes.
- Quote paper
- Enrico Frohs (Author), 2006, Tagebaurekultivierung unter ökologischen und ökonomischen Aspekten am Beispiel der Lausitz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89233