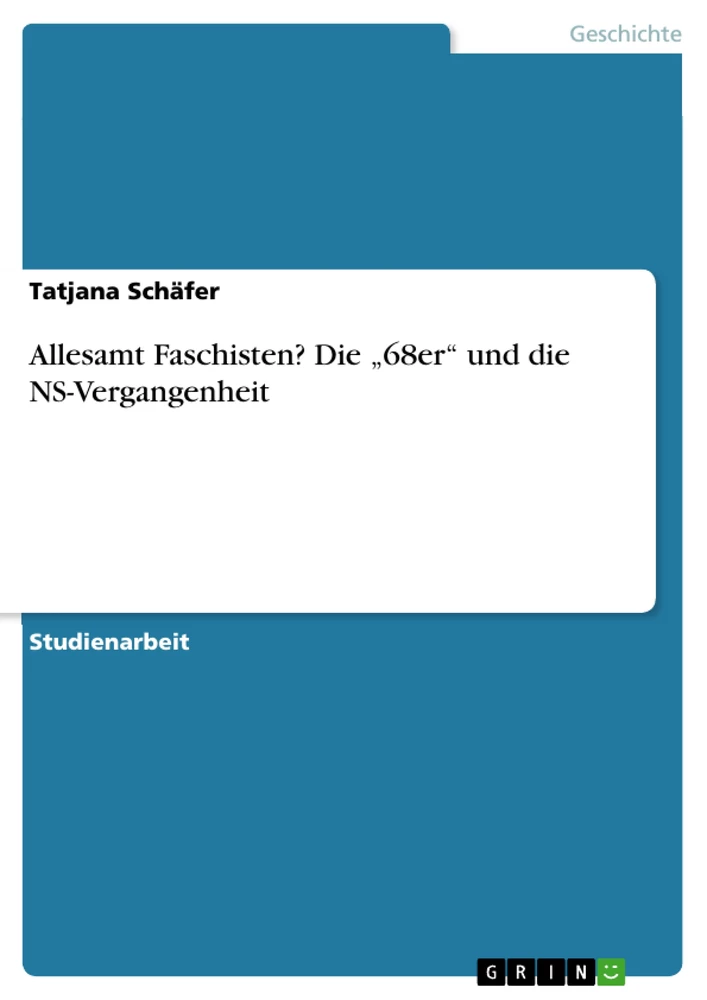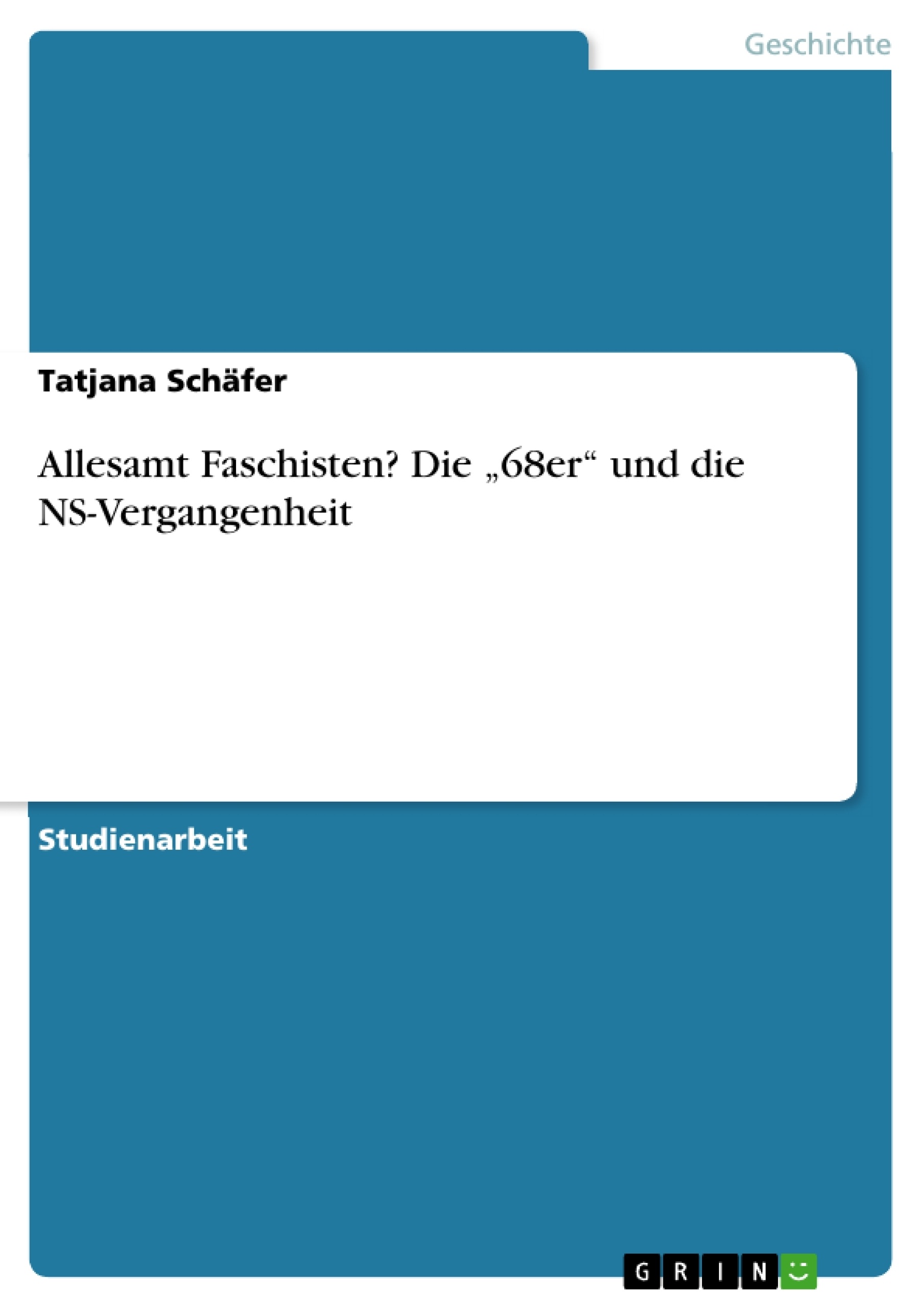Wie an keinem anderen Datum in der Geschichte der Bundesrepublik entzünden sich an dem Jahr 1968 und den von ihm repräsentierten gesellschaftlichen Umbrüchen extrem polarisierte und polarisierende Auseinandersetzungen und Ansichten. Die einen sehen in „68“ ein Jahr des Aufbruchs, das der Bundesrepublik einen umfassenden Modernisierungs- und Liberalisierungsschub brachte. Kritiker jedoch machen die „68er“-Bewegung für Autoritätsschwäche und Werteverfall innerhalb der Gesellschaft und damit letztlich für alles verantwortlich, was ihrer Meinung nach in Deutschland schief läuft, bis hin zu dem grassierenden Rechtsextremismus in den neunziger Jahren. Auch in der Frage, ob es sich bei „1968“ um einen reinen Generationenkonflikt oder um eine soziale Bewegung mit ernsthaften politischen Anliegen gehandelt hat, herrscht Uneinigkeit – selbst in der Wissenschaft. [...] In der Geschichtswissenschaft besteht jedoch mittlerweile Übereinstimmung darin, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit bereits Ende der fünfziger Jahre begonnen hat. Die „68er“ hätten die bereits im vollen Gange befindliche Debatte nur aufgegriffen, intensiviert und letztlich eskaliert. Auch was den Umgang mit dem Holocaust betrifft, stellt die gesamte für diese Arbeit herangezogene Forschungsliteratur in ungewöhnlicher Einhelligkeit den „68ern“ ein schlechtes Zeugnis aus.
Diese Tatsache ist irritierend genug, um zu fragen, was für eine Rolle die NS-Vergangenheit für die „68er“-Bewegung gespielt hat und welche Faktoren und Entwicklungen denn zu der von den Historikern diagnostizierten Eskalation in der Auseinandersetzung um die NS-Vergangenheit geführt haben. Abschließend stellt sich dann die Frage nach dem Anteil, den die „68er“ wirklich an der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte hatten und ob das Urteil von einer zweiten Verdrängung des Holocaust tatsächlich zutrifft.
Zu Beginn ist es erforderlich darzulegen, auf welchem Stand sich die westdeutsche „Vergangenheitsbewältigung“ befand, als sich die Protestbewegung in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zu formieren begann und sich die Thematik aneignete. Darauf folgt ein knapper aber unverzichtbarer Überblick über die theoretischen Grundlagen der Faschismusinterpretation der Bewegung und daran anschließend eine Darstellung des zeithistorischen und gesellschaftlichen Hintergrundes, vor dem sich diese Faschismusdebatte vollzog und der sich aus ihr ergebenden Folgen für den Umgang der APO mit der jüngeren deutschen Vergangenheit
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verdrängung und Bewältigung: Die NS-Vergangenheit in den westdeutschen Diskursen bis Mitte der sechziger Jahre
- Die nationalsozialistische Vergangenheit und die „68er“-Bewegung
- Theoretische Grundlagen der Faschismusinterpretation
- Radikalisierung und Eskalation der NS-Debatte im Laufe der Revolte von „68“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der „68er“-Bewegung in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert, inwieweit diese Bewegung die bereits bestehende Debatte um die NS-Vergangenheit beeinflusst und möglicherweise sogar eine „zweite Verdrängung“ des Holocaust bewirkt hat.
- Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik bis Mitte der 1960er Jahre
- Die theoretischen Grundlagen der Faschismusinterpretation in der „68er“-Bewegung
- Die Eskalation der NS-Debatte im Kontext der „68er“-Revolte
- Der Einfluss der „68er“-Bewegung auf die Aufarbeitung des Holocaust
- Die Frage nach der Verantwortung der „68er“-Generation für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in der „68er“-Bewegung dar und benennt die kontroversen Perspektiven auf diese Zeit. Es wird auf die Diskrepanz zwischen der verbreiteten Annahme, dass die „68er“ die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit vorangetrieben hätten, und den Forschungsergebnissen hingewiesen, die eine „zweite Verdrängung“ des Holocaust konstatieren.
- Das zweite Kapitel analysiert den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik bis Mitte der 1960er Jahre. Es werden die Faktoren wie die Reintegration von NS-Funktionseliten, die Tabuisierung des „Dritten Reiches“ und die Verdrängung der deutschen Schuld beschrieben. Die Rolle des Generationenwechsels und der Verbreitung des Fernsehens für die allmähliche Veränderung des Diskurses wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen „68er“-Bewegung, NS-Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung, Faschismusinterpretation, Holocaust, Bundesrepublik Deutschland, Generationenkonflikt, Revolte, Studentenbewegung, APO.
- Quote paper
- Tatjana Schäfer (Author), 2007, Allesamt Faschisten? Die „68er“ und die NS-Vergangenheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89207