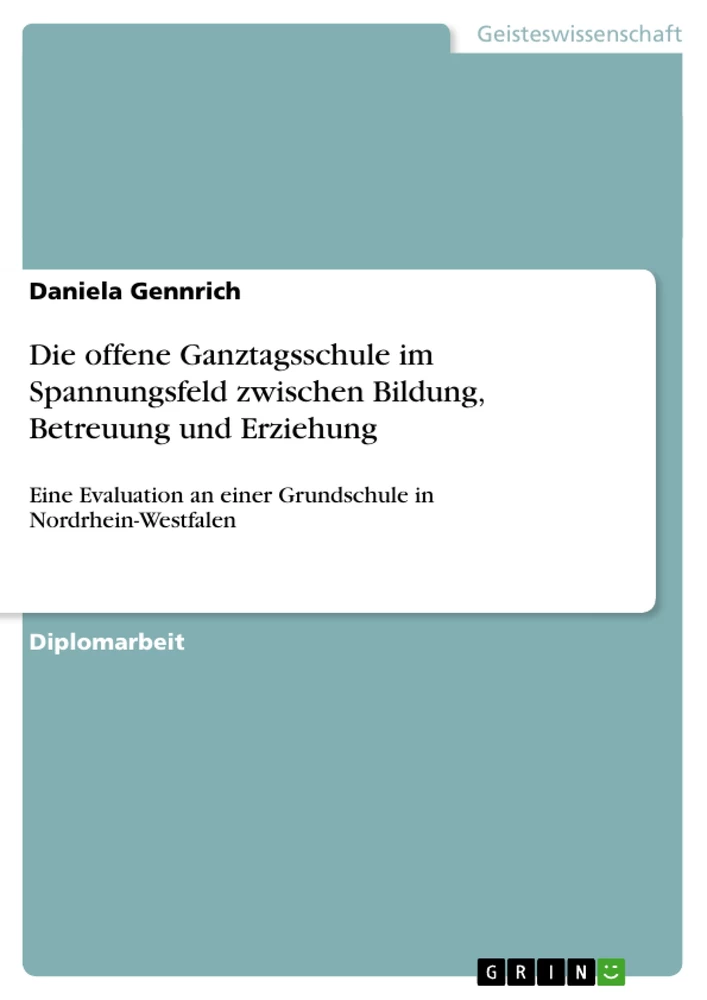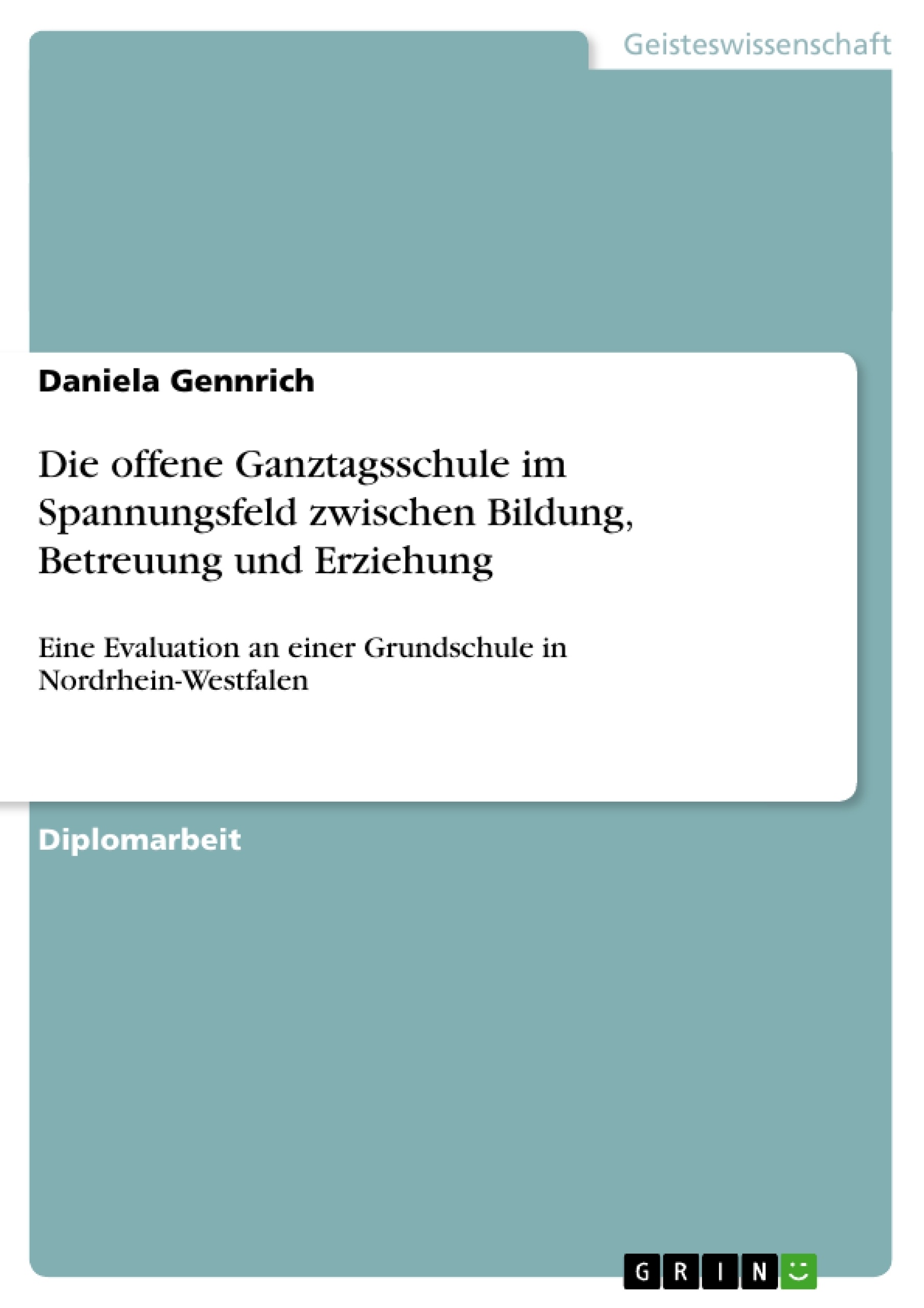Das Thema der vorliegenden Arbeit lautet „Die offene Ganztagsschule im Spannungsfeld zwischen Bildung, Erziehung und Betreuung – Eine Evaluation an einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen“.
Die offene Ganztagsschule wurde zum Schuljahr 2003/2004 von der Bundesregierung eingeführt und ist momentan ein brisantes Diskussionsthema.
Entstanden aus dem Bedarf erhöhter Bildungsqualität, welche durch die PISA Ergebnisse von 2001 deutlich wurden, sowie dem Bedarf an mehr und besseren Betreuungsmöglichkeiten für Kinder berufstätiger Eltern, sollte die offene Ganztagsschule gleich mehrere Probleme zugleich lösen.
Sie soll verschiedene Professionen zusammenführen – die Schule, seit jeher in Monopolstellung, soll nun mit der Kinder- und Jugendhilfe, dem Revier der Sozialen Arbeit, Hand in Hand gehen, um ihre Ziele, unter anderem Chancengleichheit für alle Kinder und bessere Bildungsqualität, zu erreichen.
Soweit die Vorstellung der Bundesregierung. Doch auch die Kritik an der offenen Ganztagsschule wird immer lauter. So ist z. B. von einer „pädagogischen Billiglösung“ die Rede, in der Kinder nicht mehr gebildet, sondern nur verwahrt würden.
Diese Diskussion weckt das Interesse, sich die OGS einmal in der Praxis anzusehen.
Die Arbeit in zwei Teile unterteilt – im ersten, theoretischen Teil geht es um die offene Ganztagsschule in ihrem Spannungsfeld, das zwischen ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag existiert. Dieses Spannungsfeld wird in den Kapiteln zwei und drei erklärt.
Dazu werde ich nach einer begrifflichen Annäherung des Titels dieser Arbeit die Systeme Familie und Kindheit, Schule und Kinder- und Jugendhilfe erklären.
In Bezug auf die Familie wird insbesondere auf die veränderten Lebensbedingungen von Kindern sowie die veränderten Familienstrukturen in unserer heutigen Gesellschaft eingegangen.
Daraufhin wird das Spannungsfeld Jugendhilfe und Schule betrachtet, indem ich die jeweiligen Aufträge, Gemeinsamkeiten und Unterschiede versuchen werde aufzuzeigen und die Schwierigkeiten der Kooperation am Beispiel ihrer unterschiedlichen Berufsgruppen zu verdeutlichen versuche.
Diese theoretische Einführung ermöglicht einen Einblick in die vielfältigen Erwartungen und Anforderungen, die an die offene Ganztagsschule aus unterschiedlichsten Perspektiven gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einleitung und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Bildung, Erziehung und Betreuung – eine Begriffsannäherung
- 2. Veränderte Kindheit und Familienstrukturen
- 2.1 Die Familie
- 2.1.1 Die Funktion der Familie
- 2.1.2 Der Wandel der Familienstruktur in der heutigen Gesellschaft
- 2.1.2.1 Pluralisierung und Individualisierung
- 2.1.2.2 Ein-Eltern-Familien
- 2.1.2.3 Erwerbstätigkeit der Frauen
- 2.2 Kindheit
- 2.2.1 Kindheit als Lebensphase
- 2.2.2 Die Bedürfnisse des Kindes
- 2.2.3 Das 6. bis 10. Lebensjahr - Das Grundschulalter
- 2.2.3.1 Entwicklungsaufgaben
- 2.2.3.2 Kognitive Entwicklung
- 2.2.4 Veränderte Freizeit- und Lebensbedingungen für Kinder heute
- 2.2.4.1 Wandel kindlicher Freizeitgestaltung
- 2.2.4.2 Wandel des Eltern-Kind-Verhältnisses
- 3. Kooperation von Schule und Jugendhilfe
- 3.1 Die Grundschule
- 3.1.1 Wandlungsprozesse
- 3.1.2 Zum Bildungsauftrag der Grundschule: Eigenständigkeit
- 3.1.3 Grundlegende Bildung
- 3.2 Die Kinder- und Jugendhilfe
- 3.2.1 Auftrag und Rechtsgrundlage
- 3.2.2 Träger der Kinder- und Jugendhilfe
- 3.3 Lehrerinnen und SozialpädagogInnen – Ein schwieriges Verhältnis?
- 3.4 Ausblick und Anforderungen an die OGS
- 3.4.1 Das additive Modell
- 3.4.2 Das integrative Modell
- 4. Die offene Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)
- 4.1 Das Rahmenkonzept
- 4.1.1 Zielsetzungen
- 4.1.2 Organisation und Finanzierung
- 4.2 Entstehungsbedingungen der OGS
- 4.3 Bisherige Forschungsergebnisse
- 4.4 Kritik an der OGS
- 5. Vorüberlegungen und Anlage zur Untersuchung
- 5.1 Zielsetzungen
- 5.2 Fragestellung und Operationalisierung
- 5.2.1 Hypothesen
- 6. Forschungsdesign
- 6.1 Die Befragung
- 6.1.1 Das Erhebungsinstrument Fragebogen
- 6.1.1.1 Vor- und Nachteile
- 6.1.2 Das Erhebungsinstrument Interview
- 6.1.2.1 Interviewerverhalten
- 6.1.3 Die Befragung von Kindern
- 6.1.4 Die Erstellung der Fragebögen
- 7. Die Durchführung der Untersuchung
- 7.1 Vorbereitung der Untersuchung
- 7.2 Ablauf der Untersuchung
- 7.3 Die beteiligten Institutionen und ihre Aufgaben innerhalb der OGS
- 7.3.1 Die Grundschule Schulstraße
- 7.3.2 Der deutsche Kinderschutzbund (DKSB) Ortsverband W.
- 7.3.3 Der öffentliche Träger (Stadt W.)
- 8. Auswertung und Interpretation
- 8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fragebögen
- 8.1.1 Ergebnisse der Elternbefragung
- 8.1.2 Ergebnisse der Kursleiter-Befragung (Honorarkräfte)
- 8.1.3 Ergebnisse der Lehrerbefragung
- 8.1.4 Ergebnisse der Befragung des pädagogischen Personals
- 8.1.5 Ergebnisse der Kinderbefragung
- 8.2 Die Interviews
- 8.2.1 Zusammenfassung und Diskussion der Interviews
- 8.3 Überprüfung der Hypothesen
- 8.4 Zusammenfassung & Diskussion der Ergebnisse
- 8.5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der offenen Ganztagsschule (OGS) im Kontext von Bildung, Erziehung und Betreuung. Die Arbeit untersucht die OGS in der Praxis an einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen und analysiert die Spannungsfelder, die zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen der OGS entstehen.
- Veränderungen in der Kindheit und Familienstrukturen
- Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- Die OGS als pädagogisches Konzept
- Evaluation der OGS in der Praxis
- Analyse der Herausforderungen und Chancen der OGS
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Es werden die Begriffe Bildung, Erziehung und Betreuung definiert und in Bezug zueinander gesetzt. Kapitel zwei beleuchtet die veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Familienstrukturen in der heutigen Gesellschaft. Hier werden Themen wie Pluralisierung, Individualisierung, Ein-Eltern-Familien und die Erwerbstätigkeit von Frauen behandelt. Kapitel drei befasst sich mit der Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Die jeweiligen Aufträge, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden aufgezeigt, um die Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Sozialpädagogen zu beleuchten. Das vierte Kapitel präsentiert die offene Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich. Es beschreibt das Rahmenkonzept der OGS, die Entstehungsbedingungen, bisherige Forschungsergebnisse und die Kritik an der OGS.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: offene Ganztagsschule (OGS), Bildung, Erziehung, Betreuung, Familie, Kindheit, Schule, Jugendhilfe, Kooperation, Evaluation, Praxis, Spannungsfeld, Herausforderungen, Chancen.
- Quote paper
- Daniela Gennrich (Author), 2006, Die offene Ganztagsschule im Spannungsfeld zwischen Bildung, Betreuung und Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89152