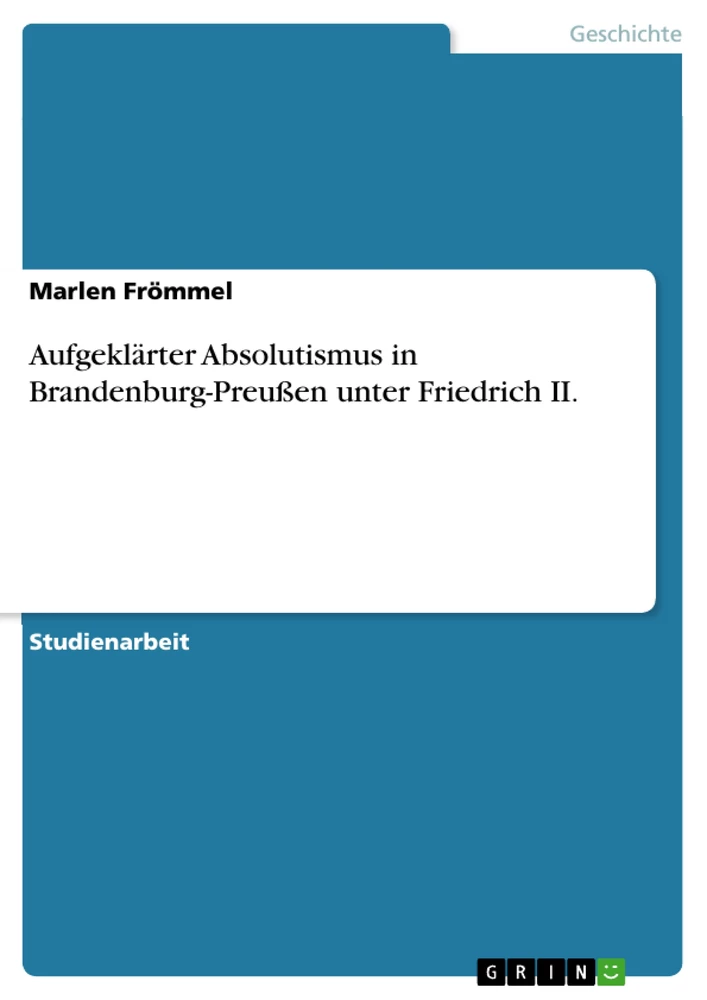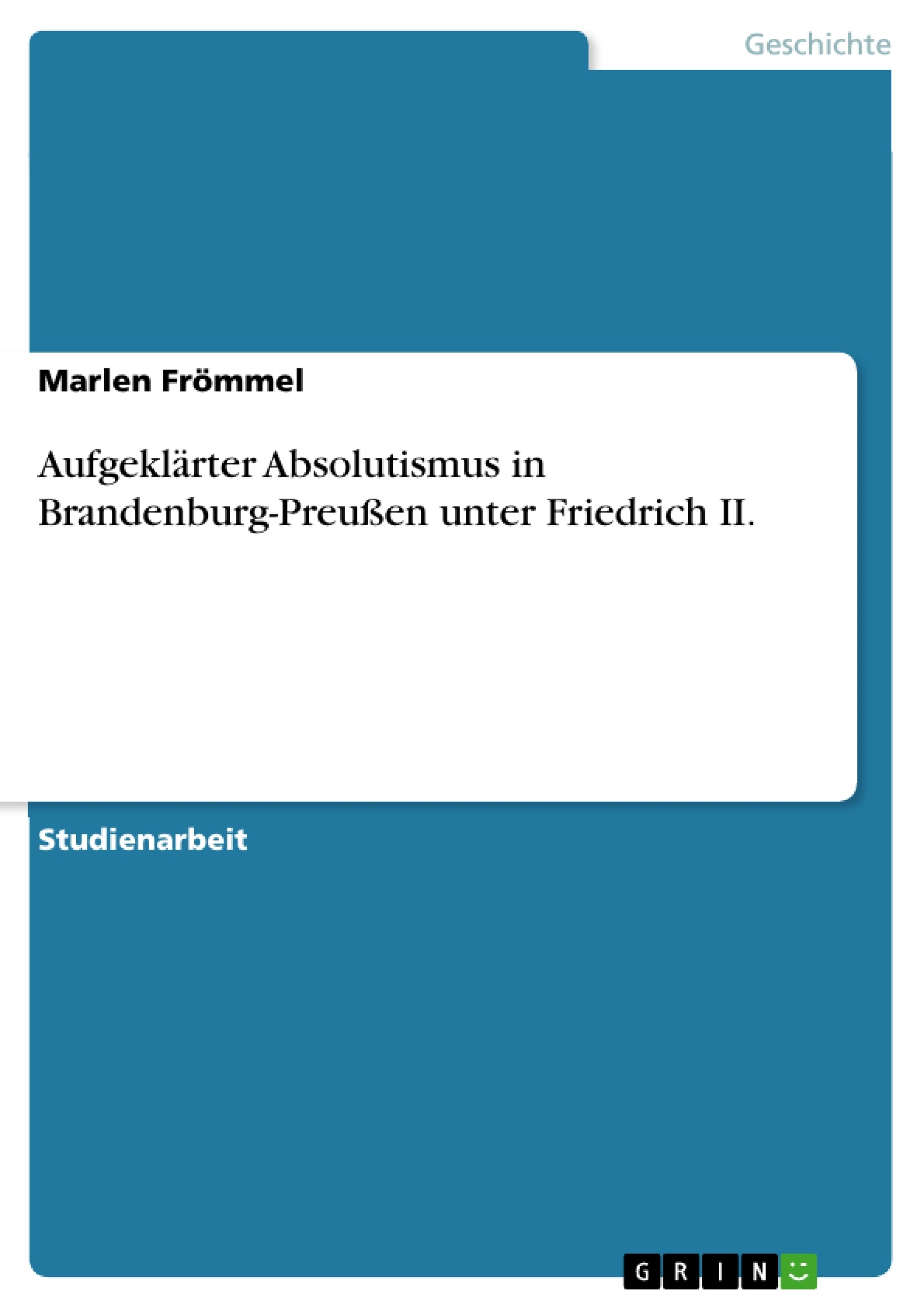Der Absolutismus als Herrschaftsform ist in der Forschung allgemein anerkannt, seine Funktion als Epochenbegriff jedoch nicht bei allen Autoren kritikfrei. Angriffspunkt bildet dabei seine Verwendung für ein gesamteuropäisches Phänomen, welches jedoch nicht zeitgleich und in gleicher Ausprägung einsetzte. [...] Für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation lässt sich dabei festhalten, dass „das Jahr 1648 […] zwar ein Epochenjahr der deutschen Geschichte [ist], aber es leitet nur bedingt das Zeitalter des Absolutismus ein, denn dieser erfasste nicht das Reich insgesamt, sondern in sehr unterschiedlicher Weise lediglich seine Fürstenstaaten“.
Die Entwicklung in diesen anderthalb Jahrhunderten war aber nicht nur von der differenten territorialen Ausbreitung des Absolutismus gekennzeichnet, sondern auch von den Auswirkungen philosophischer Einflüsse geprägt – allen voran durch die der Aufklärung. Diese bewirkte einen Wandel der Herrschaftsauffassungen der absolutistischen Fürsten. So sah sich Friedrich II., der Große, als „erste[r] Diener des Staates“ mit der Verpflichtung, die Wohlfahrt und irdisches Glück zu verwirklichen. Wie dieses Phänomen zu bezeichnen sei – ob aufgeklärter Absolutismus oder Reformabsolutismus –, darüber ist man sich in der Forschung nicht einig. Einerseits weil die Tiefenwirkungen der Aufklärung auf die absolutistische Staatsverwaltung umstritten sind, andererseits weil der „aufgeklärte Absolutismus“, welcher als historiographischer Kunstbegriff 1847 von W. Roschers eingeführt wurde, dazu führe, „die von der Aufklärung ausgehenden reformerischen Impulse zu überschätzen“.
Als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus wird vor allem Friedrich II. von Preußen angesehen. Trotz der kritischen Auseinandersetzung mit diesem Terminus und seiner Ausführung auf Staatsebene verstanden auch seine Zeitgenossen unter einem „aufgeklärten Monarchen“ den absolut regierenden Herrscher, „der aber durch zeitgemäße Reformen die Ideale der Aufklärung in die praktische Politik umgesetzt habe“.
Daher werden zunächst anhand zeitgenössischer Aufklärer die Ideen und die Zielpunkte innerhalb des absolutistischen Staates aufgezeigt. Anschließend soll untersucht werden, inwieweit sich Friedrich II. als aufgeklärter Monarch diesem Gedankengut verpflichtet fühlte, wobei eher auf die Entwicklung der Strukturen Wert gelegt wird als auf eine Ereignisgeschichte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Absolutismus – Aufklärung – Friedrich der Große
- 2. Vom Absolutismus zum Aufgeklärten Absolutismus...
- 2.1 Immanuel Kant: „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (1783)
- 2.2 Andreas Riem: „Aufklärung ist ein Bedürfnis des menschlichen Verstandes“ (1788)
- 2.3 Das Modell des aufgeklärten Absolutismus
- 3. Friedrich der Große
- 3.1 Politik
- 3.2 Die Gesellschaft und ihre Gliederung
- 3.2.1 Bauern und Landbevölkerung
- 3.2.2 Der Adel
- 3.2.3 Die städtische Bevölkerung
- 3.2.4 Die neuen Eliten
- 3.3 Wirtschaft
- 3.3.1 Die Landwirtschaft
- 3.3.2 Gewerbe und Handel
- 3.3.3 Die Formen der Wirtschaftspolitik
- 3.4 Verwaltung
- 3.5 Erziehungswesen
- 3.6 Kirche und Religion
- 3.7 Die Reformierung des Rechtswesens
- 4. Resümee
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem aufgeklärten Absolutismus in Brandenburg-Preußen unter Friedrich II. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Ideen der Aufklärung und der absolutistischen Staatsform. Die Arbeit untersucht, inwieweit Friedrich II. als aufgeklärter Monarch die Ideale der Aufklärung in die Praxis umsetzte und welche Auswirkungen diese auf die Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, das Erziehungswesen, Kirche und Religion sowie das Rechtssystem hatten.
- Die Verbindung von Absolutismus und Aufklärung
- Die Rolle Friedrichs II. als aufgeklärter Monarch
- Die Auswirkungen der Aufklärung auf die preußische Gesellschaft
- Die Reformen des aufgeklärten Absolutismus in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Verwaltung
- Die Bedeutung des Erziehungswesens und der Religion im Kontext des aufgeklärten Absolutismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Absolutismus und der Aufklärung sowie mit der Einordnung Friedrichs II. in diesen Kontext. Es werden die unterschiedlichen Auffassungen zum aufgeklärten Absolutismus diskutiert und die Bedeutung des Begriffs für die Analyse der preußischen Geschichte erläutert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Entwicklung vom Absolutismus zum aufgeklärten Absolutismus und beleuchtet die Ideen der Aufklärung anhand der Schriften bedeutender Denker wie Immanuel Kant und Andreas Riem. Es werden die zentralen Themen der Aufklärung wie Vernunft, Freiheit und Menschenrechte diskutiert und ihre Relevanz für die Veränderung der Herrschaftsformen betrachtet.
Das dritte Kapitel untersucht die Herrschaft Friedrichs II. im Detail. Es werden seine politischen Strategien, die gesellschaftliche Gliederung, die Wirtschaftspolitik, die Verwaltungsstruktur, das Erziehungswesen, die Rolle der Kirche und Religion sowie die Reformen des Rechtswesens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Aufgeklärter Absolutismus, Aufklärung, Friedrich II., Preußen, Vernunft, Freiheit, Menschenrechte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Erziehung, Kirche, Religion, Rechtswesen, Reformen.
- Quote paper
- Marlen Frömmel (Author), 2006, Aufgeklärter Absolutismus in Brandenburg-Preußen unter Friedrich II., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89084