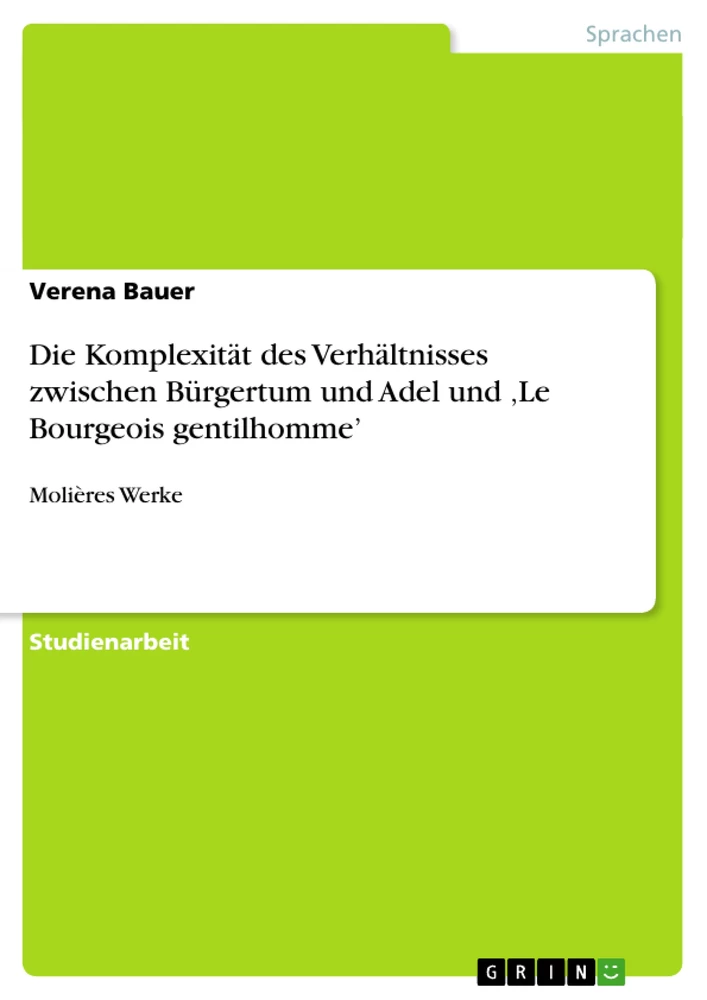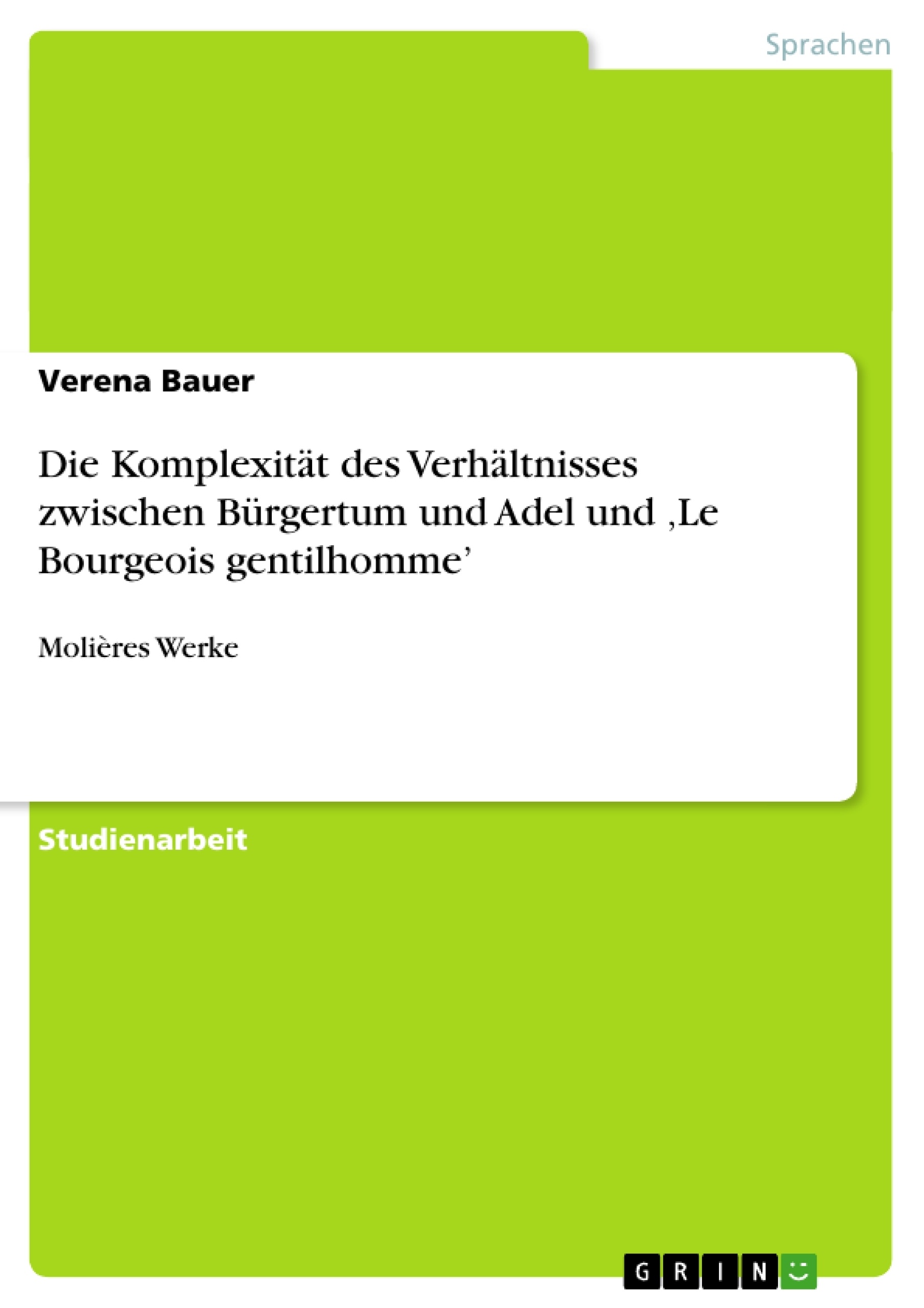Jean-Baptiste Poquelin, der als Schauspieler den Namen Molière annahm, wurde im Januar 1622 in Paris geboren. Nachdem er einige Jahre lang mit einer Theatergruppe herumgereist war, gelangten seine ersten Farcen und Komödien zur Aufführung.
Molière erfreute sich fast ununterbrochen der Gunst Ludwigs XIV., vor dem er oft spielen musste und in dessen Auftrag er seine Komödien und Schauspiele verfasste.
Auch das comédie-ballet „Le Bourgeois gentilhomme“, das am 14. Oktober 1670 in Chambord uraufgeführt wurde, war ein Auftragsstück des Königs.
Im Wörterbuch von Furetière wird Bourgeois wie folgt definiert: „…un homme peu galant, peu spirituel, qui vit et raisonne à la maniere du bas peuple“. Außerdem wurde der Ausdruck bourgeois zur Zeit Molières auch oft als Schimpfwort gebraucht.
In einem Lexikon über die Sprache Molières von Livet findet man unter gentilhomme die Erklärung: „Un personnage noble pouvait n’être pas gentilhomme, si la noblesse, par exemple, lui avait été conférée, comme aujourd’hui la croix de la Légion d’honneur, après vingt ans de services dans certains emplois, ou pour toute autre cause; mais le gentilhomme, c’est-à-dire le noble de naissance, était toujours et nécessairement noble.“
Man sieht also bereits beim Betrachten des Titels, dass er in gewisser Weise in einem Widerspruch steht, da er die Begriffe bourgeois und gentilhomme vereinbaren möchte, was aber nicht wirklich möglich ist.
Dies führt zum eigentlichen Thema dieser Seminararbeit, nämlich der Komplexität zwischen dem Adel und dem Bürgertum zur Zeit Molières.
Inhaltsverzeichnis
- DIE POLITIK LUDWIGS XIV.
- ALLGEMEIN
- DIE STELLUNG DES ADELS
- DIE ENTMACHTUNG DES ADELS – DER AUFSTIEG DES BÜRGERTUMS
- DER EINFLUSS LUDWIGS XIV. AUF DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION
- DER HOF UNTER LUDWIG XIV.
- DIE SITTEN DES HOFES
- HOFFESTE
- DAS THEATER UND MOLIÈRE
- BILDUNG UND LITERATUR
- DIE SALONS
- DIE SPRACHE
- EIN NEUES IDEALBILD: DER HONNÊTE HOMME - DIE HONNÊTETÉ
- LE BOURGEOIS GENTILHOMME"
- ENTSTEHUNG UND INHALT
- WIE KANN MAN DAS GESPRÄCH ZWISCHEN DORANTE UND MADAME JOURDAIN ANALYSIEREN? (III, 5)
- WORAN KANN MAN SEHEN, DASS CLÉONTE DIE IDEALE GEGENFIGUR ZU MONSIEUR JOURDAIN IST? (III, 12)
- THEMATIK MOLIÈRES IMMER NOCH AKTUELL?!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Komplexität des Verhältnisses zwischen Bürgertum und Adel in der Zeit Molières, insbesondere am Beispiel des Stückes „Le Bourgeois gentilhomme“. Ziel ist es, den historischen Kontext und die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu beleuchten, die Molières Werk prägten.
- Die Politik Ludwigs XIV. und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Rolle des Adels und des Bürgertums im Frankreich des 17. Jahrhunderts
- Der Aufstieg des Bürgertums und die Entmachtung des Adels
- Die Bedeutung des Hofes und seiner Sitten für die gesellschaftliche Ordnung
- Die Darstellung von Bürgerlichkeit und Adel in Molières „Le Bourgeois gentilhomme“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Politik Ludwigs XIV. und der zentralen Rolle, die er für die politische und gesellschaftliche Entwicklung Frankreichs im 17. Jahrhundert spielte. Es beleuchtet die Herausforderungen, die Ludwig XIV. bewältigen musste, um Frankreich zu einen, und die wichtigen Ereignisse wie die Fronde, die seinen Aufstieg zur Macht prägten. Kapitel 1.2 analysiert die Stellung des Adels im Frankreich des 17. Jahrhunderts und die Rolle des Hofes. Kapitel 1.3 erklärt den Aufstieg des Bürgertums und die Entmachtung des Adels unter Ludwig XIV., wobei auch die Rolle von Persönlichkeiten wie Colbert beleuchtet wird. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Hof unter Ludwig XIV. und seinen Sitten, sowie der Bedeutung des Theaters und Molières für die höfische Kultur.
Schlüsselwörter
Ludwig XIV., Adel, Bürgertum, Fronde, Absolutismus, Hof, Versailles, Molière, Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet, Honnête homme, Honnêteté, Frankreich, 17. Jahrhundert.
- Quote paper
- Verena Bauer (Author), 2006, Die Komplexität des Verhältnisses zwischen Bürgertum und Adel und ‚Le Bourgeois gentilhomme’, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88885